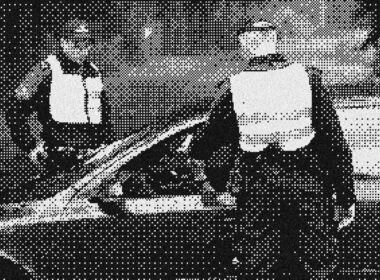Seit dreissig Jahren lautet das Motto der Rasierklingenmarke Gillette: „Das Beste im Mann.“ Ein neuer Werbespot der Marke fragt selbstkritisch: Wie soll ein Mann denn im besten Fall sein? Und stellt fest: Die Antwort auf die Frage hat sich in den letzten dreissig Jahren verändert. Der Clip zeigt grapschende Männer und machohafte Chefs. Er nimmt Bezug auf die MeToo-Debatte und die Diskussion um toxische Männlichkeit. Die Aussage ist deutlich: Alte Ideale von Männlichkeit sind schädlich. Neue müssen her. Es hat sich etwas getan: „Toxische Männlichkeit“ war bis vor Kurzem ein Begriff, den nur Professor*innen für Gender Studies verwendeten. Was ist passiert?
Like a girl
Dass sich ein Werbespot so kritisch mit Männlichkeit befasst, ist neu. Das Weiblichkeitsideal hingegen wird in der Werbung seit einiger Zeit verhandelt. Im H&M‑Spot für die Herbstkollektion 2017 waren Frauen unterschiedlicher Hautfarbe und mit unterschiedlichen Körpergrössen zu sehen. Frauen, die Chefinnen sind und Frauen, die Pommes essen. Im Werbespot für die Frühlingskollektion 2018 sind Frauen gelangweilt von galanten, aber einschläfernden Herren auf der Tanzfläche – und tanzen lieber miteinander. Der Spielzeughersteller Mattel brüstet sich seit Jahren mit seinen Barbiepuppen, die als gute Vorbilder für kleine Mädchen gelten: Die Ärztinnenbarbie oder die Ingenieurinnenbarbie etwa. Ein grosser Erfolg war auch die Kampagne „Like a girl“ vom Damenhygieneproduzenten Always. Er entlarvt die Redewendung „Wie ein Mädchen“ als gefährlich für das Selbstwertgefühl junger Frauen. Ein Lidschattenset der Firma L’Oréal trägt den Namen „Feminist”. Und in einem Weihnachtswerbespot prangerte der Autohersteller Audi gegendertes Spielzeug an: Ein kleiner Junge wünscht sich neben einem Modell-Audi auch eine Puppe. Der Slogan: „The presents you open can open your mind.“
Freiheit wurde gefordert – Neoliberalismus geliefert
Auch wenn wir gerade einen Boom erfahren – die Vermischung von feministischen Idealen und Markt ist nicht neu. Sie entstand vielleicht schon vor sechzig Jahren.
Die US-Philosophin Nancy Fraser hat eine These: In den 1960er Jahren lieferte die feministische Bewegung eine Berechtigung für die neoliberale Ideologie, die sich damals rasant ausbreitete. Feminist*innen forderten Freiheit und Selbstbestimmung. Das bot den Mächtigen von damals die Möglichkeit, mit ihrer eigenen Version von Freiheit zu antworten: mit der Deregulierung der Märkte und der Privatisierung von staatlichen Organisationen. Die Forderung nach gesellschaftlichen Reformen setzten die Regierungen in erster Linie in der Wirtschaftspolitik um.
Die feministischen Ideale wurden so umgedeutet, dass sie den Frauen letztlich schadeten, aber der Wirtschaft nützten: Statt dass Männer arbeiteten und Frauen zuhause blieben, mussten neu beide Elternteile arbeiten, um eine Familie zu ernähren. Ein kapitalistisches Interesse gebar sich als Gleichstellung. Die politischen Forderungen wurden entkräftet.
Femvertising
Heute ist Feminismus ein Verkaufsgag. „Femvertising“ heisst das in der Marketingsprache. Es geht hier nicht um einen Feminismus, der einen kollektiven Aufstand provoziert, um eine politische Bewegung für mehr Gleichberechtigung. Sondern um einen „Feminismus als Identität, die du dir zulegst, weil du sie interessant findest“, wie es die US-Autorin Andi Zeisler einmal treffend formulierte. Es geht hier nicht um Ermächtigung in einem politischen Sinn, um einen kollektiven Aufstand. Sondern um individuelle Selbstermächtigung. „Femvertising“: „Wenn du auch Pommes isst und dir deine Cellulitis egal ist, dann kauf bei H&M ein!“ oder: „Wenn du auch ein neuer Mann bist, einer, der nicht grapscht oder Frauen ins Wort fällt, dann kauf Gillette!“
Deswegen tun sie das auch nicht. Stattdessen verarbeiten solche Werbekampagnen den Feminismus zu praktischen Produkten. Sauber eingeschweisste Rasierklingen. Hübsche bunte Make-Up-Paletten. Damenbinden mit geruchsneutralisierender Technologie. Die man kaufen kann, wenn man sie braucht. Und wieder wegwerfen, wenn man sie benützt hat. Folgenlos und nicht bedrohlich. Was in den 1960er-Jahren stimmte, stimmt noch immer: Gleichberechtigung lässt sich nicht verkaufen. Und die Gefahr besteht, dass auch heute die Vermischung uns letztlich schadet: Statt mehr Freiheit kriegen wir mehr Konsumzwang.
Es mag sein, dass Werbekampagnen wie die von Gillette ein Bewusstsein fördern. Sie stossen Debatten an. Die Reaktion auf den Spot zeigt ausserdem erneut: Es ist noch viel zu tun. Denn neben Lob hagelte es auch Zorn von verletzten männlichen Egos auf den Rasierklingenhersteller. Unter dem Hashtag #boycottgillette werfen Männer ihre Rasierer demonstrativ in den Müll.
Am eigentlichen Problem rütteln sie aber nicht. Die Antwort auf die Frage „Wie soll ein Mann im besten Fall sein?”, lautet für Gillette auch nach dem neuen Werbespot: Am besten ist ein Mann glattrasiert. Nicht mehr und nicht weniger kann man von einem Rasierklingenhersteller erwarten.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 14 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 988 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 490 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 238 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?