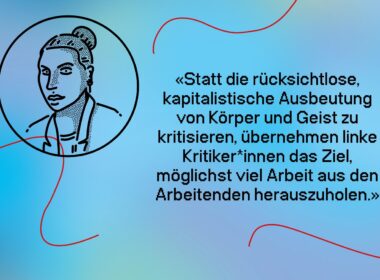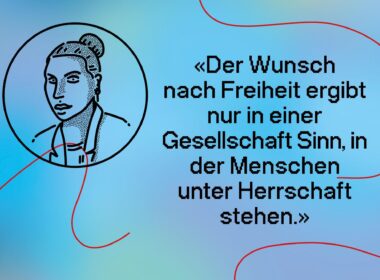Es gibt ein Buch, dessen Sprachgewalt und Dringlichkeit mich beim Lesen zutiefst erschrocken hat. In „Müllmann auf Schafott” vom algerisch-französischen Schriftsteller Abdel Hafed Benotman geht es um Faraht, genannt Fafa, der in einer armen algerischen Familie in Paris aufwächst und auf die schiefe Bahn gerät.
Am Ende des Buches, Vorsicht: Spoiler, landet Fafa in einem Pariser Jugendgefängnis – und spürt, als er seine Zelle betritt, ein unbändiges Gefühl von Freiheit. Das erste Mal in seinem Leben hat er einen eigenen Raum nur für sich. In der Passage heisst es:
Im Gefängnis fühlt sich Fafa so frei wie noch nie. Er macht den Fehler, die Gefängnisrealität mit seiner Erfahrung als misshandeltes Kind zu vergleichen. Er glaubt, dass er fertig ist mit dem Schmerz, dem Leid und endlich Frieden finden kann. Dass niemand, noch nicht einmal er selbst, ihm etwas anhaben kann. Er kennt die Gefahr noch nicht, das äussere Gefängnis mit der inneren Freiheit zu vermischen. Diese Ehe bringt Hybridwesen hervor, und weil das Gefängnis das Leben noch im härtesten Keim hasst, gebärt es nichts als Monster.
Diese Zeilen am Ende der Geschichte um Fafa haben mich weinen lassen. So, dachte ich, kann nur jemand schreiben, der weiss, wovon er spricht. Eine solche Wahrheit lässt sich nicht ausdenken. Es ist unmöglich, derartige Literatur zu produzieren, ohne diese Gefühle selbst gespürt, ohne diese Gedanken selbst gedacht zu haben.
Ich recherchierte Benotmans Geschichte und erfuhr, dass er 2015 mit 54 Jahren an Krebs gestorben war. Davor verbrachte er wegen Raubüberfällen insgesamt 17 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Aber nicht nur das, er engagierte sich gegen Rassismus und war Herausgeber einer Gefängnis-kritischen Zeitung namens L’Envolée (dt. der Flug).
Benotman war nicht nur weite Teile seines Lebens militant, er ist auch ein politisch engagierter Künstler gewesen, der sein Leben in den Dienst des gesellschaftlichen Kampfes gestellt hat.
Etwas derart Drastisches erlebt zu haben und es dann noch auf eine so eindringliche Weise zu verarbeiten, macht Benotman zu einer seltenen Spezies. Für den normalen Künstler oder politisch interessierten Menschen sind die Kosten eines solch extremen Lebens zu hoch.
Die Ästhetik der Militanz
Heute wächst auf der einen Seite der Wunsch nach politischem Ausdruck, etwa in der zeitgenössischen Kunst- und Kulturwelt. Auf der anderen Seite fällt den meisten Leuten Engagement schwer. Das Ergebnis: Man versteht sein Leben als ein politisches – aber macht daraus nichts.
Der Historiker Anton Jäger schlägt für das Phänomen des mit Bedeutung und politischem Bewusstsein aufgeladenen Alltags den Begriff der „Hyperpolitik“ vor. Im gleichnamigen Buch schreibt Jäger, dass die Atomisierung und Beschleunigung Hand in Hand gehen: „Die Menschen sind im neuen Jahrhundert einsamer, auch aufgeregter; atomisierter, aber auch vernetzter; wütender, aber auch verwirrter.“
Wie es Benotmans Lebensweg zeigt: Militanz verdammt einen zu einem Leben am äussersten Rand der Gesellschaft.
Hyperpolitik nach Jäger habe die Wirkung einer Neutronenbombe. „Eben noch demonstrierten Tausende Menschen auf einem Platz – schon sind sie wieder verschwunden, doch die Probleme und Machtverhältnisse sind immer noch da bzw. unverändert intakt.“
Mit „Hyperpolitik“ ist Jäger eine treffende Zeitdiagnose gelungen. Schaut man sich an deutschsprachigen Universitäten und im progressiven kulturellen Milieu um, ist die Politik überall – und zugleich nirgendwo. Wie viele Studierende, in der Black-Block Ästhetik gekleidet, die Universitäten bevölkern, deren Kleidung suggeriert: Hier meint es jemand absolut ernst. Wie viele Frontkämpfer*innen auf Instagram, aber wie wenige, die wirklich langfristig organisiert sind.
Es ist das Gegenteil von dem, wofür Benotman steht. Die Ästhetik der Militanz zu benutzen anstatt militant zu sein. Denn wie es Benotmans Lebensweg zeigt: Militanz verdammt einen zu einem Leben am äussersten Rand der Gesellschaft. Die modernen Grossstädter*innen unter 35 wollen die Bedeutung eines kompromisslosen Lebens, aber der Preis eines kompromisslosen Leben ist ihnen zu hoch.
Was da wartet: Gefängnis, Schulden, ein verfrühter Tod, das wollen sie nicht – und das ist verständlich. Für die meisten gibt es die Möglichkeit frei zu entscheiden, welcher Lebensweg genommen wird, vielleicht anders als bei Benotman.
Auf die Gefahr, Leser*innen über einen Kampf zu scheren, machen wir den Text eine Nummer persönlicher. Wer sich nach kritischer Selbstüberprüfung nicht gemeint fühlt, hört jetzt weg.
Ihr wollt nicht die Verletzungen, die körperliche Arbeit einem zufügt, ihr wollt die Ästhetik der Handwerkerhose und des Karabiners an der Hose, an dem ihr eure Schlüssel befestigt, weil sie euch etwas Bodenständiges geben. Ihr wollt die Adidastrainingshose, die gerade nach dem bisschen sexy Prekariat riecht, zu dem ihr immer genug Abstand halten könnt. Ihr geht am Wochenende aus einem freiheitlichen Verständnis in die Second-Hand-Läden – nicht weil ihr darauf angewiesen seid. Die, die darauf angewiesen sind, die können sich euretwegen die Klamotten dort nicht mehr leisten.
Ihr zitiert lieber, als dass ihr tatsächlich etwas darstellt. Wenn ihr in eurer Kunst von „Komplizenschaft“ sprecht, von „bildet Banden“, von „Konspiration“ dann meint ihr nicht Komplizenschaft, Banden und Konspiration, ihr meint Treffen mit befreundeten Künstler- und Sexualpartner*innen. Denn wer tatsächlich Banden bildet, der spricht nicht darüber, der lungert mit der Bande. Wer konspirativ agieren muss, weil seine Aktionsform ihm das diktiert, der trötet es nicht in die Welt. Wer Komplizenschaft sucht, der findet sie bei denjenigen, die handeln – und darüber schweigen.
Es ist okay, dass ihr seid, was ihr seid: Grossgewordene Kinder aus dem Bürgertum, die versuchen, ihr Leben mit Bedeutung aufzuladen.
Das alles ist eure Sache nicht und das ist okay. Wir brauchen keine Hunderttausenden militanten Revolutionär*innen, als die ihr euch ausgebt. Denn ihr wollt nicht Gaspistolen aufbohren und mit ihnen losziehen, um Geld für „Revo“ zu erbeuten, ihr wollt Leute, die hören, wie ihr „Revo“ sagt. Wie ihr es sagt, nicht wie ihr es macht. Weil diejenigen, die es machen, im Untergrund sind, in der von Benotman so eindringlich beschriebenen Einzelzelle, im Asyl.
Es ist okay, dass ihr seid, was ihr seid: Grossgewordene Kinder aus dem Bürgertum, die versuchen, ihr Leben mit Bedeutung aufzuladen. Dass viele von euch in den nächsten zehn Jahren Erben werden. Dass ihr Hausbesitzer*innen werdet und nicht Hausbesetzer*innen. Dass ihr für eure Kinder in „grüne“ Fonds anlegt, dass ihr Lastenräder kauft und E‑Autos und dafür keinen Kredit aufnehmen müsst.
Politik ist kein Hobby
Das hier ist kein „Wie checke ich meine Privilegien”-Text, das ist ein „Macht euch wahr“-Text. Und wenn dieses Wahrmachen ausserhalb politischer Arbeit oder politischer Kunst liegt, dann macht euch besser früher wahr als später. Eine sozial engagierte Literatur braucht nicht noch weitere Tausende Autor*innen, die ihr Schreiben mit politischer Sprache aufladen, dann aber nicht liefern. Politische Gruppen brauchen nicht noch mehr Menschen, die suggerieren, auf der Seite der Beherrschten zu stehen und Worte der Beherrschten benutzen, um sich dann, wenn es eng wird, verbeamten zu lassen oder in den bürgerlichen Unibetrieb zu retten.
Für wen Politik ein Spiel ist, hat in ihr nichts zu suchen. Politik ist die Entscheidung über Leben und Tod. Wer darf an den EU-Aussengrenzen rein und wer muss im Schlauchboot ersaufen? Welches Milieu lässt auf dem Bau sein Leben, wenn es von Baggern zerdrückt, oder vom Baugerüst gepustet wird? Bei wem ist die psychische Erkrankung vorbestimmt und bei wem ist sie Ausdruck eines verschwenderischen Lebensstils? Hinter diesen Fragen steckt Politik und mit Politik schmückt man sich nicht.
Meine Tante, die jahrzehntelang militante Politik gemacht hat, erzählt heute noch von dem Moment, in dem sie verstanden hat, dass Politik für die wohlhabenden Frauen aus ihrer Gruppe ein Hobby gewesen ist, bevor sich eine nach der Anderen für ihre Karrieren entschieden hat. Für sie war diese Erfahrung ein Verrat. Herauszufinden, dass Menschen sagen können: Hausbesetzung ja, aber bitte nicht in der wohlhabenden Strasse meiner Eltern – das ist für sie eine Frechheit. Und ich kann sie verstehen.
Hört auf mit eurem proletarischen Cosplay, zieht euch die tatsächlichen Klamotten eures Milieus an, in das ihr euch zurückzieht, sobald der Gegenwind ein bisschen stärker weht.
Also, macht euch locker. Schreibt Yuppieliteratur. Lebt euren Hedonismus. Teilt Petitionen. Und schämt euch dafür nicht, Scham ist nur von Unten eine sozial relevante Kategorie. Der Scham des Bürgertums ist – ähnlich wie das Sprechen über Privilegien – Teil eines Ablasshandels, der da lautet: Ich schäme mich, dafür behalte ich meine soziale Position, die mir Dinge erlaubt, die dir nicht zustehen. Ich checke meine Privilegien und versuche sie zu teilen, aber nur unter meinen Bedingungen und meist nicht dann, wenn es darauf ankommt.
Oder macht alles ganz anders. Bei Gott, es gibt einen grossen Anteil in mir, der nicht mehr Teil konstruktiver Gespräche sein will. Und dieser Teil, der will diese verdammten Banden endlich sehen, der will die angekündigte, aber nicht gelieferte Militanz, der will die Gewalt. Aber dieser Teil in mir steht jeden Tag wie ein Kind an der Bushaltestelle und wird nicht abgeholt.
Es gibt übrigens noch einen Mittelweg, einen Weg zwischen den radikalen Benotmans und dem Weg des So-tun-als-ob. Er lautet: Hört auf mit eurem proletarischen Cosplay, zieht euch die tatsächlichen Klamotten eures Milieus an, in das ihr euch zurückzieht, sobald der Gegenwind ein bisschen stärker weht.
Sucht euch ein (meinetwegen politisches) Projekt und arbeitet in dem, was ihr macht, ernsthaft und stringent an einer besseren Welt. Nicht bis ihr eine*n Partner*in gefunden habt, oder euch mit dreissig zu alt fühlt dafür, sondern als verankerter Teil der eigenen Identität. Ich würde dann meinerseits die Polemik einstellen. Haben wir einen Deal?
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?