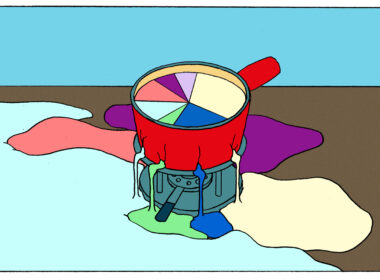Wir erreichen Meriame Terchoun bei der Arbeit. „Entschuldigen Sie die Verspätung, ich musste noch etwas erledigen”, sagt sie zu Beginn. Sie sei gerade noch ein wenig müde von der Vorbereitung für die Rückrunde, aber auch von der Booster-Impfung, die sie am Tag zuvor verabreicht bekommen hat. Doppel- und Dreifachbelastungen überall – das ist die Norm im Schweizer Frauenfussball, wo Höchstleistungen erwartet und Minimalbeträge bezahlt werden.
Das Lamm: Frau Terchoun, 2019 erlitten Sie bereits Ihren dritten Kreuzbandriss. Und das im Alter von 24. Was geht einem da durch den Kopf?
Meriame Terchoun: Zuerst einmal war ich sehr deprimiert. Die Verletzung geschah eine Woche vor dem Cupfinal, was die Verletzung noch viel schlimmer machte. Zwar hatte ich Glück im Unglück und zog mir neben dem Kreuzbandriss keine weitere Verletzung zu, etwa am Meniskus. Trotzdem habe ich mich in der Zeit oft gefragt, wie es weitergehen soll, ob ich überhaupt noch auf diesem Niveau spielen möchte.
Als die Saison 2020 dann wegen Covid unterbrochen wurde und ich von einer Reise nach Hause kam, habe ich die spielfreie Zeit für mein Aufbautraining genutzt.
Meriame Terchoun ist eine Schweizer Fussballspielerin, die beim FC Zürich unter Vertrag steht. In ihrer Karriere gewann sie sieben Mal die Schweizer Meisterschaft und acht Mal den Schweizer Cup. Nach über zweieinhalb Jahren stiess sie im November 2021 wieder zum Kader des Schweizer Nationalteams hinzu, mit dem sie an der Europameisterschaft 2017 teilnahm.
In Ihrem ersten Spiel im Herbst 2020 haben Sie dann gleich in der letzten Minute ein Tor erzielt – und das gegen Ihren Exclub.
Ja, das war ein besonderer Moment. Nicht wegen dem FC Basel oder dem Spiel an sich, sondern wegen der spürbaren Freude und Unterstützung im Team. Mit einem Mal fiel die ganze Last der letzten Monate von meinen Schultern. Das hat mir auch die Lockerheit gegeben zu sagen: Alles, was jetzt noch kommt in meiner Karriere, ist ein schöner Bonus.
So reden sonst nur Spieler:innen kurz vor dem Karriereende. Dabei stehen Sie mit dem FC Zürich auf Platz 1 der Tabelle und mit Ihren sechs Toren in neun Spielen an zweiter Stelle der Torschütz:innenliste.
Dass ich nach drei schweren Verletzungen immer noch auf diesem Niveau spielen kann, grenzt an ein Wunder. Auch wenn die Verletzungen irgendwann geheilt sind: Der Körper verändert sich. Deswegen versuche ich am Boden zu bleiben und meine körperliche Fitness realistisch einzuschätzen.
Die Verletzungen waren zudem auch psychisch sehr belastend. Ich war zum Beispiel selbst für meine Aufbauarbeit verantwortlich. Und weil man als Spielerin in der höchsten Liga der Schweiz beim Bund nicht automatisch als Spitzensportlerin gilt, bedeutete das auch, dass ich meine Intensiv-Reha selbst organisieren musste.
Aber ja, diese Saison läuft es sehr gut. Der Wechsel der Trainerin hat mir gutgetan, ich kenne Inka Grings von früher und verstehe mich gut mit ihr. Sie gibt mir die nötige Zeit, mich körperlich auf die Spiele vorzubereiten. Solange ich die aktuelle Form halten kann und fit bleibe, werde ich alles dafür geben, dass wir die Saison auch auf dem 1. Platz beenden.
Mit Ihrer Leistung haben Sie auch Nationaltrainer Nils Nielsen überzeugt. Für das letzte Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2022 wurden Sie nachnominiert. Rechnen Sie damit, dass Sie im Sommer mit dem Nationalteam nach England fahren?
Nein, ich mache mir nicht allzu viele Gedanken über eine mögliche Teilnahme an der Europameisterschaft. Wie gesagt: Jeder Erfolg, der jetzt noch kommt, ist nicht selbstverständlich.
Die Schweiz hat aktuell ein sehr starkes Team, viele Spieler:innen verdienen ihr Geld im Ausland und sind im Gegensatz zu mir Vollprofis. Ich persönlich konzentriere mich auf die Saison mit dem FC Zürich und möchte mit meiner Leistung dazu beitragen, dass wir die Meisterschaft gew:innen. Aber natürlich: Wenn ich für das Kader in England aufgeboten werde, werde ich alles geben.
Es ist nach der EM 2017 erst die zweite Teilnahme des Schweizer Frauenfussballteams an einer EM. Was bedeutet das für den Schweizer Frauenfussball?
Es ist ein Riesenerfolg und gleichzeitig eine grosse Chance für den Frauenfussball. Wir können der Welt und der Schweiz zeigen, dass wir Fussball auf hohem Niveau spielen können. Mit dem Turnier rückt der Frauenfussball dieses Jahr auch in die mediale Aufmerksamkeit, was hoffentlich auch viele Mädchen dazu motiviert, selbst Fussball zu spielen.
Zudem sind grosse Turniere immer auch mit Investitionen vom Verband in die Infrastruktur und das Team verbunden. Mit der Kandidatur für die EM 2025, die der Kanton Zürich auch unterstützt, zeigt der Schweizer Fussballverband, dass er in Sachen Frauenfussball endlich vorwärtsmachen will. Deswegen bin ich verhalten positiv gestimmt für die Zukunft.
Und trotzdem: Von Ländern wie Frankreich oder Deutschland ist die Schweiz noch meilenweit entfernt. Warum tun wir uns so schwer mit dem Frauenfussball?
Das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle. Natürlich hat die Schweiz langsame bürokratische Prozesse, Veränderungen brauchen hier länger, sind aber dafür nachhaltiger. Die Schweiz ist aber nicht wirklich eine Sportnation, mit Ausnahme natürlich des Skisports. Selbst beim Männerfussball sehen wir nicht die Fanszenen, die es in anderen Ländern gibt. Und natürlich ist die Schweiz sehr kleinräumig und hat dadurch einen eingeschränkten Fernsehmarkt, was sich auf die Finanzen der Vereine auswirkt.
Das Ziel muss sein, dass Spieler:innen für die hohe Leistung, die ihnen abverlangt wird, auch entsprechend entlohnt werden. Und davon sind wir leider aktuell noch weit entfernt. Das ist vielen Leuten nicht bewusst: Sie gehen davon aus, dass eine Spielerin, die in der höchsten Liga spielt, automatisch auch vom Sport leben kann.
Gibt es somit auch viel Unwissen rund um den Frauenfussball?
Ja, ganz klar. Deswegen ist es so wichtig, dass die Spiele nicht nur im Fernsehen übertragen, sondern auch vermehrt durch Hintergrundberichterstattung über die Spieler:innen begleitet werden. Wir alle in der Schweizer Liga sind neben den vielen Trainings noch berufstätig.
Solche Geschichten interessieren die Zuschauer:innen und machen deutlich, wie gross die Leistung von Spieler:innen ist, die jede Woche auf hohem Niveau Fussball spielen. Und so können Fussballer:innen auch Vorbilder für junge Frauen sein, die sich für den Sport interessieren.
Es gibt auch Diskussionen, dass der Frauenfussball mit geänderten Regeln attraktiver gemacht werden könnte für jene, die sich bisher nur für Männerfussball interessiert haben. Etwa mit einem kleineren Ball oder Feld…
Ja, die gibt es, aber diese Vorschläge zielen am Kern des Problems vorbei. Der Frauenfussball wäre deutlich schneller und attraktiver, wenn Frauen im selben Masse wie Männer gefördert und so bezahlt würden, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Das und eine weitere Professionalisierung würde helfen, dass sich Frauenfussballer:innen, die fast alle täglich einem Beruf nachgehen oder studieren, sich voll auf den Sport konzentrieren können.
Aber selbst wenn der Frauenfussball besser bezahlt würde, wäre der Vergleich mit dem Männerfussball nicht sinnvoll. Es sind zwei Angebote auf dem selben Markt, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Frauenfussball muss man anders schauen als Männerfussball.
Wie meinen Sie das – Frauenfussball „anders schauen”?
Wer ein Frauenfussballspiel anschaut und die Qualität nur an der Geschwindigkeit und an der Physis misst, ist im Vergleich mit dem Männerfussball vielleicht enttäuscht. Wer aber Aspekte wie technische Finesse oder Taktik ins Zentrum stellt, merkt, dass der Frauenfussball mindestens gleichwertig wie der Männerfussball ist.
Ganz zu schweigen davon, dass wir fairer, toleranter und ehrlicher sind und trotzdem immer 100 Prozent Einsatz geben.
Birgt aber die Professionalisierung, die Sie sich wünschen, nicht auch die Gefahr, dass die negativen Aspekte des Männerfussballs übernommen werden?
Die Gefahr besteht, ja. Ich selbst schaue gerne Männerfussball, aber wie viel Geld dort im Spiel ist und wie dort mit Spielern auch in der Schweiz zum Teil umgegangen wird, grenzt an unmenschlich. Wo viel Geld fliesst, gehen die Werte anscheinend schnell verloren.
Wenn ich von Professionalisierung spreche, dann beziehe ich das vor allem auf das Trainingsumfeld und auf die Bezahlung: Mehr Einzeltrainings, bessere medizinische Betreuung, fairere Bezahlung. Aber ich hoffe, dass die menschliche Nähe, die den Frauenfussball bisher ausmacht, beibehalten werden kann.
Ist es so betrachtet nicht auch eine zusätzliche Chance, dass die Frauenfussball-EM in England im selben Jahr wie die umstrittene Männerfussball-WM in Katar stattfindet?
Ja, das ist durchaus eine Chance. Wobei wir uns nichts vormachen müssen: Trotz den Nebengeräuschen rund um die WM in Katar wird die grosse Mehrheit der Fussballfans die Männer-WM schauen. Aber für die Minderheit, die aus moralischen Gründen darauf verzichtet, ist die Frauen-EM im Sommer natürlich eine willkommene Alternative.
Ganz im Gegensatz zu vielen Sportler:innen scheinen Sie kein Problem damit zu haben, sich politisch zu positionieren, auch ausserhalb des Sports. So haben Sie sich letztes Jahr etwa zur Abstimmung über das Burka-Verbot geäussert. Wieso sind sie unverkrampfter als so manche anderen Spitzensportler:innen?
Ich habe nur eine begrenzte Zeit auf der Erde und möchte diese möglichst sinnvoll und erfüllend gestalten. Dazu gehört für mich, dass ich für meine Werte einstehe. Wir Spitzensportler:innen haben eine öffentliche Plattform und ich bin davon überzeugt, dass wir eine Pflicht haben, diese zu nutzen. Gerade auch, weil viele Menschen in anderen Staaten diese Chancen nicht haben.
Ich spreche aber nur zu Themen, über die ich mich im Vorfeld gut informiert habe und bei denen ich auch zu meiner Meinung öffentlich stehen kann. Aber dort, wo ich kann, möchte ich mich dafür einsetzen, dass alle die gleichen Chancen erhalten.
Dieses Interview ist zuerst bei der P.S.-Zeitung erschienen. Die P.S.-Zeitung gehört wie Das Lamm zu den verlagsunabhängigen Medien der Schweiz.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 15 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1040 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 525 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 255 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?