Liebe ist auch Aktivismus. Das schreibt die französische Autorin und Politologin Emilia Roig, die sich weltweit für Gerechtigkeit und Gleichheit einsetzt. Bekannt ist sie vor allem für ihre Haltung zur Liebe: Denn diese ist für sie kein intimes privates Gefühl, das allein zwischen zwei Menschen entsteht. Sie versteht die romantische Liebe als Teil des Patriarchats. Jenem System, das Männer bevorzugt und Frauen benachteiligt.
Nachdem sie in ihrem ersten Buch Why we Matter Rassismus und soziale Ungleichheit beleuchtete, verschrieb sie sich danach der Liebe. Dazu gehört auch Roigs Forderung, dass die Ehe abgeschafft werden soll. Sie sei eine der wichtigsten Säulen der patriarchalen Ordnung, schreibt sie in ihrem zweiten Buch Das Ende der Ehe. In ihrem aktuellen, dritten Werk Lieben löst sie die Emotion schliesslich von der reinen Partnerschaft und weitet sie auf Freundschaft, Natur und Kosmos aus.
„Wir alle sind in einem System gefangen, das aus Normen, Gesetzen und traditionellen Vorstellungen besteht, die sich zwangsweise auf unsere Liebe auswirken.”
Neben der gesellschaftlichen Perspektive gibt Roig auch einiges über sich preis. Sie wuchs in einer „patriarchalen Kleinfamilie” – mit einer Mutter aus Martinique und einem jüdisch-algerischen Vater – in Paris auf. Roig war zudem selbst vier Jahre verheiratet und hat einen Sohn. Heute ist sie geschieden und lebt mit ihrem Sohn in Berlin.
Emilia Roig kritisiert und polarisiert – sei es mit ihren Ansichten zur Ehe oder zuletzt zum Nahostkonflikt. Zwar verurteilte sie den Angriff der Hamas, machte aber schnell klar, dass sie trotz ihrer jüdischen Abstammung nicht auf der Seite Israels stehe. Roig versteht sich selbst jedoch nicht als Aktivistin. Sie sagt aber: „Wenn aktivistisch bedeutet, dass ich den Status Quo nicht akzeptiere, dann bin ich wohl aktivistisch.”
Das Lamm: Emilia Roig, Sie kritisieren die heteronormative Liebe. Aber wenn zwei Menschen sich lieben und füreinander entscheiden, was spricht Ihrer Meinung nach dagegen?
Emilia Roig: Gegen die Liebe an sich spricht nichts. Es ist aber wichtig zu verstehen, in welchem Kontext diese stattfindet. Wir alle sind in einem System gefangen, das aus Normen, Gesetzen und traditionellen Vorstellungen besteht, die sich zwangsweise auf unsere Liebe auswirken.
Wie sieht dieses System aus?
Das kapitalistische Patriarchat beruht auf der Vorstellung, dass das Männliche dem Weiblichen übergeordnet ist. Auch in Liebe und Beziehungen entsteht dadurch ein Ungleichgewicht, da Lohn- und Care-Arbeit unterschiedlich bewertet werden. In heterosexuellen Ehen führt dies oft zu finanzieller Abhängigkeit der Frau – eine Abhängigkeit, die jedoch durch Erzählungen verschleiert wird, wie etwa, dass sich eine Frau durch die Beziehung mit einem Mann „vervollständigt”. Männern hingegen wird vermittelt, sie verlören durch eine feste Bindung ihre Autonomie. Tatsächlich zeigen Studien aber, dass Frauen als Singles glücklicher sind und Männer, wenn sie verheiratet sind. Denn Männer sind stärker auf romantische Beziehungen angewiesen, da sie von Frauen nicht nur emotionale Unterstützung erhalten, sondern auch tägliche Unterstützung im Haushalt.
In gleichgeschlechtlichen Beziehungen gibt es diese Unterschiede nicht. Ist ihre Liebe frei von patriarchalen Strukturen?
Nicht ganz. Wir alle sind in dieser Gesellschaft sozialisiert und eingebettet. Keine Liebe oder Beziehung ist deshalb frei von patriarchalen Strukturen. Das gilt für queere Paare, aber auch für Mutter-Kind-Beziehungen oder Freundschaften.
Sie waren selbst vier Jahre lang verheiratet. Wann haben Sie diese Muster in Ihrer Ehe bemerkt?
Ich habe sie sehr lange nicht erkannt, obwohl ich ein grundsätzliches Unwohlsein gespürt habe. Erst als wir zusammengezogen sind und dann nochmal stärker, als unser Sohn zur Welt kam, wurde mir bewusst, dass ich viel mehr Care-Arbeit übernehme als mein Mann und ich habe mich ausgebeutet gefühlt.
Haben Sie mit ihm darüber gesprochen?
Ja, aber es waren keine einfachen Gespräche. Er ist in einer traditionellen Familie aufgewachsen, in der er der einzige Sohn unter fünf Kindern war. Er hat die patriarchalen Rollenbilder – genau wie ich – tief verinnerlicht.
Führte das schliesslich zum Ende Ihrer Ehe?
Zum einen ja. Wir haben uns zwar geliebt, aber dieses Problem war unüberwindbar. Zudem wollte ich mit Frauen sein.
„Die Abschaffung der Ehe bedeutet einen Paradigmenwechsel auf politischer, kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene.”
Unabhängig von Ihrer eigenen Geschichte gibt es viele Menschen, die heiraten wollen oder sagen, sie führten eine glückliche Ehe. Was würden Sie dem entgegenhalten?
Ich will niemanden vom Heiraten abhalten. Im Gegenteil, wenn ein Paar sich sehr traditionell patriarchal organisiert, die Frau ihre Lohnarbeit reduziert und mehr Care-Arbeit übernimmt, rate ich ihr sogar, zu heiraten. Denn es ist für sie die einzige Möglichkeit, sich finanziell abzusichern.
Trotzdem haben Sie in Ihrem Buch die Abschaffung der Ehe gefordert.
Das heisst aber nicht, dass heiraten verboten werden soll. Die Abschaffung der Ehe bedeutet vielmehr einen Paradigmenwechsel auf politischer, kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Der Staat soll nicht mehr in die Hierarchie der menschlichen Beziehungen eingreifen. Warum soll die Ehe über allem stehen? Weshalb ist sie die einzige Möglichkeit, um abgesichert zu sein? Wieso können Fürsorgegemeinschaften oder Freundschaften nicht dieselbe Funktion übernehmen? Darum geht es mir.
Welche Rolle spielt hierbei das binäre Geschlechtersystem?
Eine grosse. Die Ehe basiert in ihrem Grundsatz nach wie vor darauf, dass es zwei voneinander getrennte, biologisch unveränderbare Geschlechter gibt. Diese stehen in einer klaren Hierarchie zueinander. Zwar wurde dieses Modell durch die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare teils erweitert, trotzdem bleibt die rechtliche Organisation vieler Staaten in weiten Teilen binär. Wissenschaftlich wurde jedoch längst bewiesen, dass die Vorstellung eines binären Geschlechts keine biologische Grundlage hat, sondern durch soziale, politische und kulturelle Faktoren geprägt ist.
Sie sagen, es gibt biologisch gesehen kein weibliches und männliches Geschlecht?
Es gibt Vaginas und Penisse, aber unsere Anatomie und Geschlechtsorgane sollten nicht bestimmten, wie viel Macht wir in der Gesellschaft haben, wie sehr wir uns um andere kümmern oder wie viel wir verdienen. Wenn wir zudem an dieser starren Einteilung in zwei Geschlechter festhalten, bedeutet es, dass Menschen, die in keine dieser Kategorien passen, keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.
„Wir sollten Platz für verschiedene Beziehungsformen schaffen. Damit durchbrechen wir die Hierarchie der menschlichen Beziehungen, in der die heterosexuelle Monogamie nach wie vor an der Spitze steht.”
Geschlechter sind für Sie auch zentral, wenn es um Sexualität geht. Können Sie das erklären?
Das patriarchale System gibt uns vor, dass es nur eine Form von „natürlicher” Sexualität gibt: die Heterosexualität. Sie bestimmt, mit wem wir leben, wie wir den Haushalt organisieren und wer sich um die Kinder kümmert. Wenn wir aber in die Tierwelt schauen, gibt es keine Norm. Für die Fortpflanzung braucht es zwar in den meisten Fällen Männchen und Weibchen – doch selbst das ist nicht bei allen Tierarten so. Zudem haben die meisten Tiere auch gleichgeschlechtlichen Sex. Somit dient Sex in der Tierwelt nicht ausschliesslich der Fortpflanzung. Und auch bei Menschen ist es so: Der meiste Sex geschieht aus reinem Vergnügen, und nicht, um Kinder zu zeugen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, die Penetration sei ein Mittel patriarchaler Unterdrückung. Ist das nicht etwas extrem?
Ohne Kontext mag es extrem klingen. Der Akt selbst ist nicht das Problem, sondern das System, in dem er stattfindet. Es basiert auf patriarchalen Machtverhältnissen, in denen Frauen strukturell benachteiligt sind und Opfer von Gewalt durch Männer werden. Die Penetration steht in diesem System symbolisch für die Ausübung von Macht, die tief in der Gesellschaft verankert ist – in Medien, Normen und Beziehungen. Die Tatsache, dass alle zweieinhalb Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex getötet wird, zeigt die Tragweite dieser Gewalt. Sie lässt sich nicht isoliert betrachten, sondern ist Ausdruck eines Systems, das Sexualität mit Kontrolle und Dominanz verbindet.
Aber nicht alle Männer sind gewalttätig.
Das stimmt. Aber jene, die gewalttätig sind, sind fast immer Männer. Männer verfügen kollektiv über patriarchale Macht, auch wenn sie selbst nicht gewaltvoll sind. Jede Frau weiss, dass sie potenziell Gewalt durch einen Mann erfahren kann oder Angst haben muss, wenn sie nachts allein nach Hause läuft.
Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine offene Beziehung oder Polyamorie. Ist das ein Weg, um aus diesem System auszubrechen?
Ich plädiere nicht für die eine oder andere Beziehungsform. Aber wir sollten Platz schaffen für verschiedene Formen. Damit durchbrechen wir die Hierarchie der menschlichen Beziehungen, in der die heterosexuelle Monogamie nach wie vor an der Spitze steht. Und wir sollten die Liebe von der reinen Paarbeziehung lösen.
Das heisst?
Die Liebe ist eine Kraft, die uns immer und überall begleitet. Eine, die wir auch auf andere Teile des Lebens ausweiten sollten, wie etwa Freundschaften, Natur, Tiere oder Kosmos.
„Das Patriarchat ist im Grunde das Gegenteil von Liebe. Es ist voller Hass auf Frauen, auf nichtbinäre Menschen und auf Männer selbst.”
Trotzdem erleben viele von uns dieses Gefühl von Herzklopfen und starkem Verlangen vor allem in der romantischen Liebe zu einer anderen Person. Müssen wir dieses Gefühl aufgeben oder sogar unterdrücken?
Nein, dieses Gefühl ist wunderschön und wir sollten es voll und ganz ausleben. Aber wir dürfen nicht verleugnen, dass es in einem System voller Ungleichheit, Unterdrückung und Gewalt stattfindet. Wir alle müssen gegen dieses System ankämpfen. Auch innerhalb von Beziehungen.
Denken Sie, auf diese Weise können wir patriarchale Strukturen aus der Liebe fernhalten?
Solange das Patriarchat existiert, wird das kaum möglich sein. Ich denke aber, das Patriarchat wird langfristig nicht überleben.
Was macht Sie zuversichtlich?
Die politischen Zeichen weltweit zeigen zwar derzeit eher in eine andere Richtung, aber ich glaube, das sind die letzten Widerstände, bevor wir in eine neue Ära kommen.
Welche Rolle spielt die Liebe für die Abschaffung des Patriarchats?
Für jede Veränderung, jeden Fortschritt und jede Revolution braucht es die Liebe. Das Patriarchat ist im Grunde das Gegenteil von Liebe. Es ist voller Hass auf Frauen, auf nichtbinäre Menschen und auf Männer selbst. Letzteren nimmt es die Chance, anderen auf Augenhöhe zu begegnen – eine wesentliche menschliche Erfahrung. Die Abschaffung des Patriarchats bedeutet deshalb Liebe für alle Menschen.
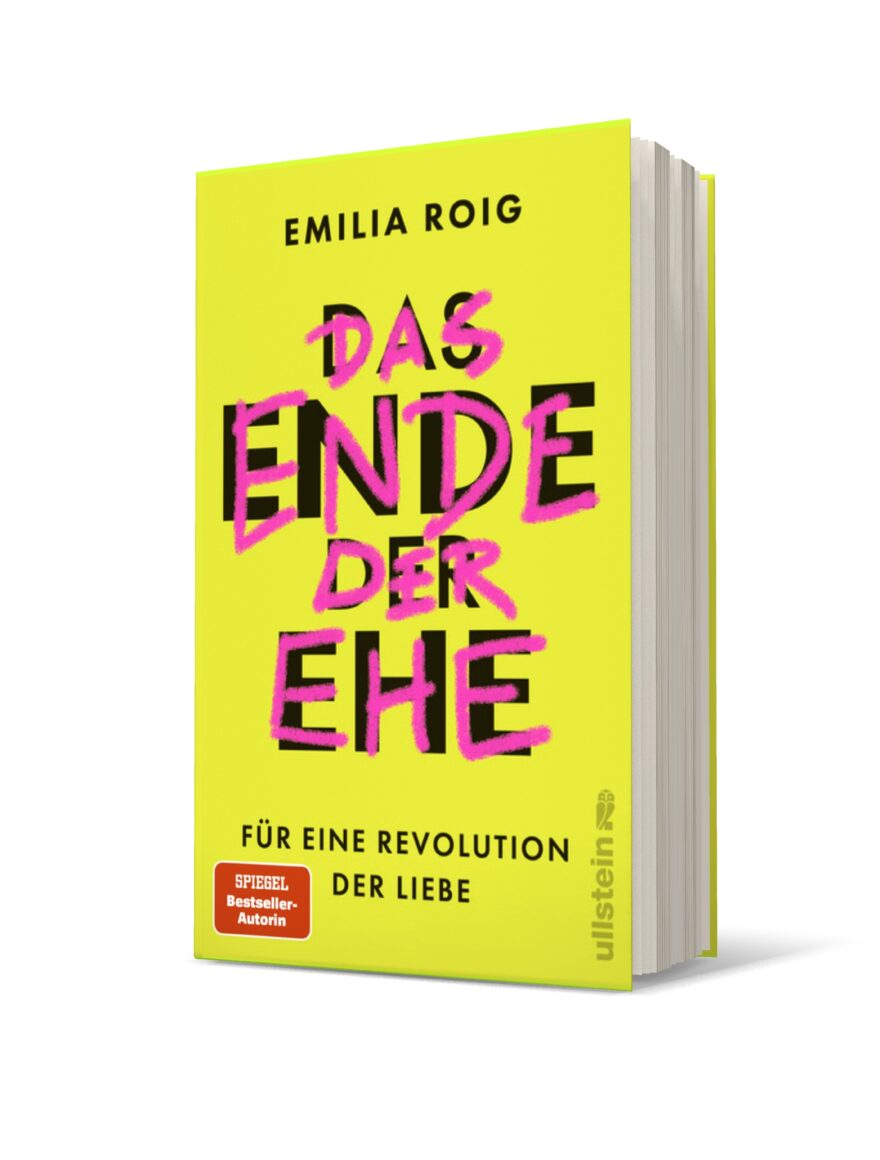
Emilia Roig: Das Ende der Ehe. Ullstein, 2023. S. 384.
Jetzt bei der Paranoia City Buchhandlung bestellen oder direkt an der Ankerstrasse 12 vorbeigehen.
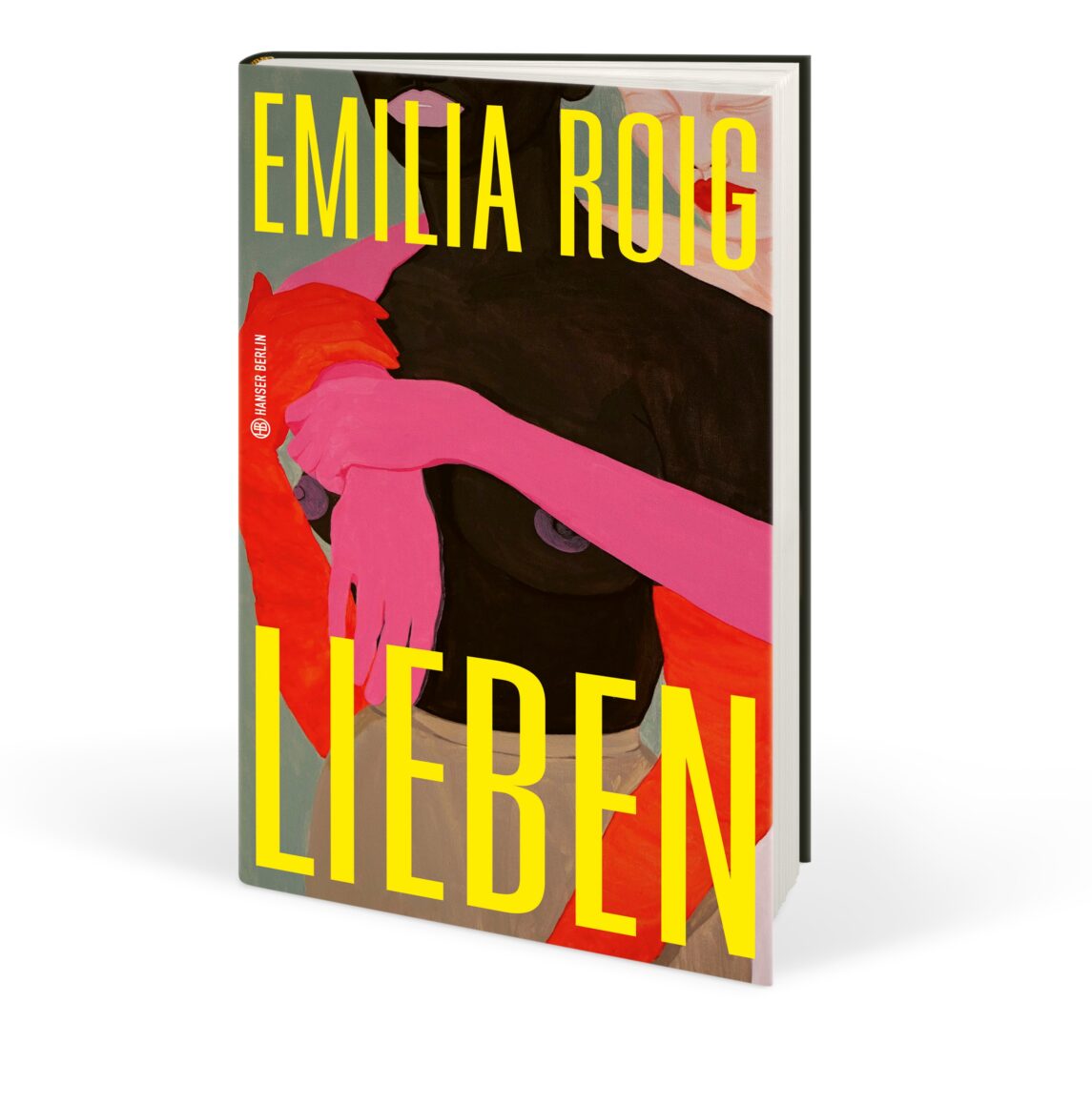
Emilia Roig: Lieben. Hanser Berlin, 2024, S. 128.
Jetzt bei der Paranoia City Buchhandlung bestellen oder direkt an der Ankerstrasse 12 vorbeigehen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?














