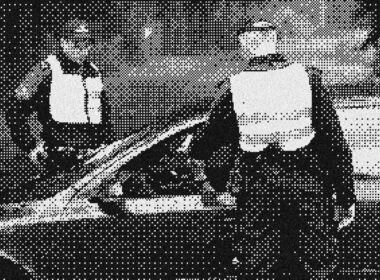Wären Frauen und Männer gleichgestellt, würden seit dieser Woche und für den Rest des Jahres nur noch Männer zur Arbeit erscheinen. Denn ab Mittag des 21. Oktobers leisten Frauen ihre Lohnarbeit gänzlich unentgeltlich.
Laut Bundesamt für Statistik verdienten Frauen im privaten Sektor im Jahr 2016 durchschnittlich 19,6% weniger als ihre männlichen Kollegen. Am 21. Oktober sind jeweils 80% Prozent des Jahres vorüber und die entlohnte Arbeitszeit von Frauen somit erschöpft. Dabei wird diejenige Arbeit, die Frau das gesamte Jahr über wie selbstverständlich gratis leistet, nicht einmal mit einberechnet: Reproduktions‑, Haus‑, und Care-Arbeit.
Diskriminierung durch Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern war bereits ein zentrales Thema des Frauenstreiks 1991 – die Beseitigung dieser strukturellen Ungerechtigkeit eine nachdrückliche Forderung des diesjährigen feministischen Streiks am 14. Juni.
Dennoch: Bisher hat sich nur wenig getan. Dafür macht sich seit einiger Zeit ein unliebsamer Trend bemerkbar: In den kläglichen Versuchen, das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern und deren Ursprünge zu beschreiben, wird zwischen „erklärbaren” (56%) und „unerklärbaren” (44%) Auslösern differenziert. Ausschliesslich Letztere seien von „potenziell” diskriminierenden Ursprungs, so das eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann.
In den erklärbaren Teil, so das Bundesamt für Statistik, fielen die sogenannten „Besonderheiten der weiblichen Erwerbstätigkeit”, zu denen längere berufliche Unterbrüche „aus familiären Gründen” zählten, die wiederum das Dienstalter sowie die Berufserfahrung von Frauen beeinflussen würden – und somit die Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern. Zudem sei der Lohn von „verschiedenen Merkmalen” wie „Ausbildung, beruflicher Stellung und Anforderungsniveau” abhängig. Das eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau ergänzt diese Liste mit den Punkten Branche, Dienstjahre und Ausbildungsniveau.
Die Bezeichnung „familiäre Gründe” lässt diesen strukturellen und gesamtgesellschaftlichen Missstand der Ungleichstellung als etwas Individuelles, gar Privates erscheinen. So, als sei Reproduktion und die damit einhergehende Arbeit eine rein persönliche (und ausschliesslich weibliche!) Angelegenheit, die in vereinzelten, karrieretechnisch unglücklichen Fällen vorkommen könnte, wie etwa ein Blinddarminfekt.
Ganz davon abgesehen, dass „Besonderheiten der weiblichen Erwerbstätigkeit” so klingt, als hätte man es mit einem bis heute unbekannten und beinahe ausserirdischen Phänomen zu tun, das in seiner Andersartigkeit unergründlich ist und die damit einhergehenden Probleme unveränderbar macht. (Das erinnert übrigens schmerzlich – und wahrscheinlich nicht ganz zufällig – an die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem weiblichen Orgasmus.)
Deine Schuld, Frau!
So werden die „erklärbaren” Faktoren – da individuell und somit selbst verschuldet – gerade deshalb diskriminierend, weil sie vermeintlich erklärbar sind. Die Unterschiede in Bereichen wie „Ausbildung, Branche und Dienstjahre” werden nicht etwa als mögliche Konsequenz, sondern als reine Ursache des Lohngefälles behandelt.
Diese Herangehensweise „erklärt”, also rechtfertigt, die bestehende Differenz und reproduziert sie sogleich. Denn persönliche Probleme erfordern lediglich persönliche Lösungen. Oder wie der Tagesanzeiger schreibt: „Wenn die Lohnungleichheit nur von privaten Entscheidungen innerhalb der Partnerschaft herrührt, sind öffentliche Eingriffe im Arbeitsmarkt nutzlos.” In private Entscheidungen möchte sich niemand einmischen, die persönliche Freiheit darf – ganz nach neoliberaler Manier – niemand einschränken. Und schon scheint alles geklärt.
Die unerklärten Faktoren, die beinahe 50% der Differenz ausmachen, lediglich als „potenziell” diskriminierend zu betrachten verharmlost die Situation aufs Neue. Zwar scheint es naheliegend zu glauben, dass man bei unbekannten Gründen schlichtweg (noch) nicht bestimmen kann, ob es sich um strukturelle Benachteiligung handelt.
Welcher Glaube wäre allerdings die Alternative? Genau, die Selbstverschuldung. Vielleicht liegt es einfach nicht in der Natur der Frau, für gleiche Arbeit gleichen Lohn zu erhalten? Vielleicht wollen sie es nicht genug? Liegt es in ihren Genen oder doch an den persönlichen Vorlieben?
Natürlich könnte man argumentieren, dass ein traditionelles Familienmodell, in welchem die Frau vermehrt berufliche Unterbrüche in Kauf nimmt, um sich zum Beispiel um den Nachwuchs zu kümmern, eine Frage des persönlichen Geschmacks sei. Jedoch zeigen Studien, dass die Lohndiskriminierung bereits beim Einstieg ins Berufsleben beginnt.
„Bemerkenswert an dieser unerklärten Lohndifferenz ist, dass es sich um junge kinderlose Erwachsene handelt, die über dieselbe Qualifikation verfügen und in vergleichbaren Berufen und Branchen arbeiten”, stellte der Tagesanzeiger im bereits zitierten Artikel fest. Das Argument der privaten Selbstverschuldung hält demnach nicht Stand.
Dabei wäre es schon irrsinnig genug zu behaupten, es läge rein an den Frauen oder den Paaren, sich für ein progressiveres Familienmodell zu entscheiden, während man einen essenziellen Teil der Reproduktionsarbeit – Schwangerschaft, Geburt etc. – eben nicht gleichwertig aufteilen kann.
Hinzu kommen die erhöhten („unerklärten”) Lohndifferenzen je weiter Frau auf der Karriereleiter nach oben klettert. Oder etwa das Phänomen des „Muttermalus” und „Vaterbonus”, also die Lohneinbussen der Frau und der Lohnanstieg des Mannes, sobald der Nachwuchs da ist.
Wenn immer grösser werdende Lohndifferenz zu männlichen Kollegen die Aussicht für Frauen ist, wie gross mag da der Reiz zu einer Entscheidung für eine anstrengende und zeitintensive berufliche Karriere sein? Und welche junge Familie kann es sich leisten, sich für ein progressives Familienmodell zu entscheiden, dass nur ökonomische Nachteile bringt?
Um den Wahnsinn komplett zu machen, werden Frauen selbst in den Berufen – den sogenannten „Frauenberufen”, die ohnehin schon schlechter bezahlt werden als andere Tätigkeiten – schlechter bezahlt als Männer, die derselben Tätigkeit nachgehen.
„Karriere-” und „Powerfrauen” lösen keine strukturellen Probleme
Wann wird sich nun endlich etwas ändern? Gute Frage. Was feststeht ist, dass die Unterdrückung von Frauen zumindest für die sakrosankte Wirtschaft durchaus lukrativ ist. Die Doppelbelastung von unbezahlter Arbeit Zuhause und schlecht bezahlter Lohnarbeit in oftmals marginalisierten Sektoren entlastet Konzerne und KMU. Die doppelte Ausbeutung ermöglicht es zudem auf (männliche) Arbeitskräfte zurückzugreifen, die Zuhause unentgeltlich versorgt, gehegt und gepflegt werden.
Deshalb ist die Ungleichheit der Geschlechter vielschichtig, politisch und strukturell. Sie durchzieht alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft, zementiert veraltete Rollenmuster und setzt Frauen vermehrt dem Problem der Armut aus.
Es ist ein Teufelskreis: Die von vornherein auf dem Arbeitsmarkt schlechter gestellte Frau leidet an den Folgen eines veralteten Gesellschaftsmodelles, das strukturelle Probleme privatisiert und somit unlösbar macht. Die dadurch entstehenden Nachteile begünstigen die Reproduktion desjenigen Systems, das Frauen in der Berufswelt von Beginn an diskriminiert und ausbeutet.
Zum Schluss möchte ich auch noch jenen eine Frage stellen, die bei einer Argumentation wie dieser sofort all die „aussergewöhnlichen” Gegenbeispiele ins Feld führen. All jene „Powerfrauen*” und „Supermamis” die beides, steile Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen scheinen: Wer springt ein, wenn Frau, das Paar, die Betreuungsarbeit selbst nicht leisten kann? Die massiv überbelastet Betreuerin im Hort? Die Babysitterin für 19 Franken die Stunde? Eine migrantische Haushaltshilfe ohne gültige Papiere vielleicht? Und sollte es unser Ziel sein, eine Doppelbelastung stemmen zu können?
Solange ein System besteht, das von prekären Arbeitsverhältnissen und Ausbeutung profitiert, wird sich durch private Intervention nichts Grundlegendes ändern.
Das Ziel in der Bekämpfung der Ungleichheit sollte nicht sein, ihre Ursachen von der „unerklärten” auf die „erklärte” Seite und somit vom Tisch zu schieben. Erklärt bedeutet eben weder fair, noch selbst verschuldet oder privat. Die Suche nach den Gründen muss ernstgenommen, Ursache und Wirkung aber nicht verwechselt und gesamtgesellschaftliche Missstände auf keinen Fall individualisiert werden.
Bis zur gesellschaftlichen Gleichstellung muss noch viel getan werden und dabei ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit das Mindeste und bloss der Anfang. Was wir tun können ist uns zu vernetzen, die Missstände ernst zu nehmen, sie zu thematisieren und in die Gesellschaft hinaus zu tragen: am 14. Juni, am 21. Oktober und an jedem anderen Tag im Jahr.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 6 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 572 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 210 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 102 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?