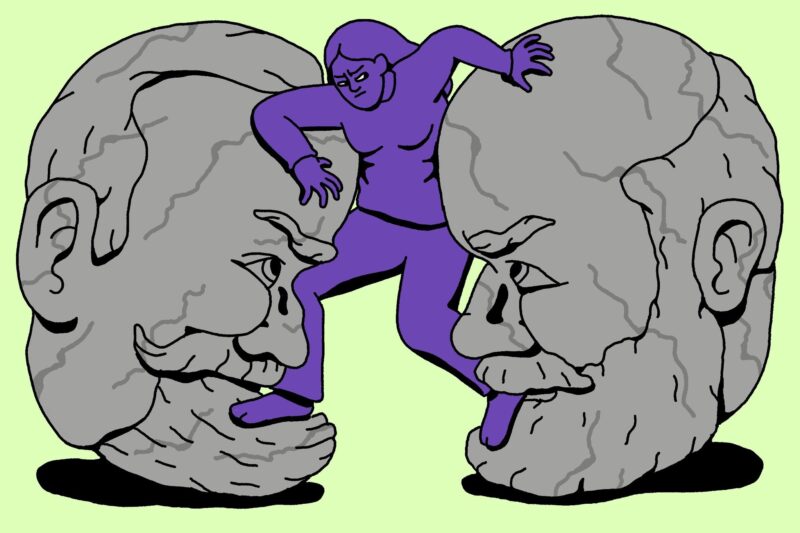Inhaltswarnung: Dieser Beitrag enthält Schilderungen eines Femizids.
Am 24. Mai 2024 verurteilte das Bezirksgericht Lenzburg einen Mann zu 14 Jahren Haft. Er hat im März vor drei Jahren seine Frau ermordet.
Laut Polizei ist der Notruf um 00.50 Uhr eingegangen. Die Tochter des Ehepaars meldet, sie habe die Mutter schreien gehört. Als Polizei und Sanität eintreffen, ist die Schlafzimmertür von innen verschlossen. Nachdem der Mann sie öffnete, sehen sie die Frau leblos im Bett liegen. Sie wurde laut Bericht mehrere Minuten gewürgt. Trotz Reanimation stirbt sie wenige Tage später im Spital.
Was sich wie ein Einzelfall liest, ist leider keiner: Allein im selben Monat wurden in der Schweiz mutmasslich vier weitere Frauen durch die Hände von Männern getötet. So viele zählte zumindest das freiwillige Rechercheprojekt Stop Femizid auf Basis von Polizei- und Medienberichten.
Offizielle Zahlen zu Femiziden in der Schweiz gibt es nicht.
Nur jene freiwilliger Kollektive, die aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Trotzdem sind ihre Zahle alarmierend: Stop Femizid erfasste für das Jahr 2023 vier versuchte und 18 vollendete Tötungen von Frauen durch Männer. Das Netzwerk Contre les Femicides spricht gar von 24 Femiziden. Zur Relation: Im selben Jahr gab es schweizweit insgesamt 53 Tötungsdelikte.
Mehr als jede dritte Tötung in der Schweiz ist also ein Femizid.
Der Ruf nach Zahlen
„Ich frage mich, warum Femizide in der Schweiz einfach hingenommen werden”, sagt Pia Allemann von der Beratungsstelle BIF für Frauen gegen Gewalt. Draussen rüttelt der Wind an den Fenstern des Beratungszimmers. Wenn in Spanien eine Frau getötet werde, gingen die Leute auf die Strasse und die Politik diskutiere sofort über Massnahmen. Ähnlich wie vergangenen März in Zürich, als ein orthodoxer Jude niedergestochen wurde. „Einen solchen Aufschrei bräuchte es auch bei jedem Femizid”, sagt Allemann.
Aktivist*innen, Expert*innen und einzelne Politiker*innen fordern deshalb seit Jahren, dass der Bund Femizide statistisch erfasse. Nur was man beziffere, könne man bekämpfen, so der Appell.
Eine offizielle Kategorie für Femizide könnte dazu beitragen, dass Gewalt an Frauen nicht als „private” Ausnahmefälle wahrgenommen werden.
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) dagegen argumentiert, versuchte und vollendete Tötungsdelikte würden jährlich in der polizeilichen Kriminalstatistik veröffentlicht. Die Daten basierten auf den Strafbeständen des Strafgesetzbuches. Dort existiere der Begriff „Femizid” nicht.
Die Statistik weise jedoch von Täter*innen wie Opfern das Geschlecht aus, so das EDI weiter. In der Statistik zur häuslichen Gewalt erfasse man zudem die Beziehung von beiden. Letztere zeigt: Im Schnitt stirbt alle zwei Wochen eine Frau durch ihren Partner, Ex-Mann oder ein anderes Familienmitglied.
Aber genügen diese Zahlen?
Andrea Isabel Frei hat in ihrer Masterarbeit untersucht, was es bedeutet, wenn Femizide nicht offiziell erfasst werden. UN-Organisationen verstehen Femizide als geschlechterbasierte Gewalt, unabhängig vom öffentlichen oder häuslichen Bereich. Der Begriff „Tötungen im häuslichen Bereich” ist laut Frei daher ungenügend, wenn die Öffentlichkeit über die anerkannte Ursache dieser Gewalt informiert werden soll. Eine offizielle Kategorie für Femizide könnte dazu beitragen, dass Gewalt an Frauen nicht als „private” Ausnahmefälle wahrgenommen werden, sondern als alltägliches, gesellschaftliches Phänomen der strukturellen Ungleichheit zwischen Mann und Frau, so das Fazit von Frei.
Ein Begriff, viele Definitionen
Im April 2022 wurde eine Ostschweizerin mutmasslich von ihrem Stalker getötet. Die Mutter der 21-Jährigen sagte gegenüber den Medien, der Täter habe ihre Tochter auf einer Party kennengelernt. Die beiden hätten nie eine Beziehung geführt. Stattdessen habe er sie gestalkt. Als sie für ihr Studium nach Hamburg zog, reiste er ihr nach, erschoss erst sie und anschliessend sich selbst.
Der Begriff „Femizid” ist nicht klar definiert. Die Soziologin Diane Russell übersetzte ihn 1976 als die vorsätzliche Tötung von Frauen durch Männer aufgrund ihres Geschlechts. Etwas weiter gefasst ist das spanische Wort „Feminicido”, auf Deutsch Feminizid. Bekannt wurde der Begriff durch die feministische Bewegung „Ni una menos”. Eine Reihe von Protestmärschen, die 2015 in Argentinien begannen, nachdem eine 14-Jährige von ihrem Freund getötet wurde, weil sie nicht abtreiben wollte.
„Trans Frauen sind von besonders viel Gewalt betroffen, da ‚Trans-Sein’ aus Sicht der Täter die patriarchale Ordnung infrage stellt.”
Sim Eggler, Expert*in für geschlechterspezifische Gewalt
Auch in Zürich und Basel ziehen Aktivist*innen regelmässig durch die Strassen. Mit dem Aufruf „Ni una menos” (zu Deutsch: nicht eine weniger) fordern sie vom Staat, dass er patriarchale Gewalt verhindert.
„Nicht alle verstehen dasselbe unter dem Begriff Femizid, es geht aber immer um patriarchale Machtverhältnisse”, sagt Sim Eggler. Eggler befasst sich seit 15 Jahren mit geschlechterspezifischer Gewalt und erklärt: Dahinter stecke die Vorstellung, dass es zwei Geschlechter gebe, die in klarer Hierarchie zueinander stehen. „Das weibliche Leben ist dabei weniger wert und der Mann darf darüber verfügen.”
In dieses Konstrukt hinein spielen auch Gewaltdelikte gegen trans Personen – vor allem gegen trans Frauen. „Sie sind von besonders viel Gewalt betroffen, da ‚Trans-Sein’ aus Sicht der Täter die patriarchale Ordnung infrage stellt. Dazu kommt der Hass auf ihre Weiblichkeit”, so Eggler.
Eggler geht davon aus, dass die Zahl der Femizide in der Schweiz gar noch höher sei, als vermutet. Unter anderem, weil Femizide nicht klar als solche erfasst werden. Dazu kommt: Auch in der Schweiz werden nicht alle Verbrechen erkannt. So ist etwa Gift als Tötungsmittel schwer nachzuweisen, wie ein Fall in der NZZ zeigte. Die Schweiz führt zudem keine systematischen Obduktionen durch.
Geht es nach Eggler, so müssten potenzielle Femizide genauer untersucht werden. „Wir müssen verstehen, wie es dazu kommen konnte, damit wir künftige Tötungen verhindern können.”
Täter gibt’s in allen Milieus
Mit der Übernahme der Istanbul-Konvention 2018 hat sich die Schweiz verpflichtet, häusliche Gewalt sowie Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und zu verhindern.
Seither hat sich einiges getan: So wurden etwa kantonale Opferhilfestellen eingerichtet. Bis Ende 2025 soll zudem allen Gewaltbetroffenen eine nationale Hotline zur Verfügung stehen. Im selben Jahr will der Bund auch einen Bericht veröffentlichen, der die Tatbestände aller Tötungsdelikte genauer darlegt.
Im Kanton Zürich läuft derzeit ein Pilotversuch für eine elektronische Überwachung. Dabei werden die Beschuldigten wie auch die Opfer 24 Stunden am Tag überwacht. Im Falle einer Annäherung wird, wenn nötig, die Polizei alarmiert. Der Pilotversuch läuft noch bis 2026, danach wollen Bund und Kantone entscheiden, wie es weitergeht.
Pia Allemann von der Opferhilfe begrüsst diese Form der Überwachung. Sie war mit vor Ort, als nach dem parlamentarischen Vorstoss von Sibel Arslan eine Schweizer Delegation nach Spanien reiste und sich ein Bild über den Einsatz elektronischer Hilfsmittel machte. „Obwohl die Geräte für die Frauen einen grossen Eingriff bedeutet, haben fast alle Opfer gesagt, dass sie froh darüber sind, weil sie sich so wieder freier bewegen können”, so Allemann.
Jede Einsparung in der Gleichstellungspolitik und jeder Entscheid gegen eine Aufstockung der Mittel für die Gleichstellung erhöht das Risiko für einen weiteren Femizid.
Im Ernstfall können die Geräte tatsächlich Leben retten. Denn Femizide in Beziehungen zeichnen sich oft ab, indem es früher schon Gewalt gab. „Heikel wird es dann, wenn es zur Trennung kommt”, sagt Allemann. Da schwinge dann oft der Gedanke mit: Wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben.
Doch wer sind die Täter?
Rechte Parteien verorten das Thema geschlechterspezifische Gewalt gerne bei Migrant*innen. Und tatsächlich zeigt die Statistik: Als Ausländer*innen erfasste Personen sind sowohl bei den Tätern als auch den Opfern tendenziell übervertreten. „Hier spielen jedoch viele Faktoren hinein, die Gewalt generell begünstigen, wie Armut, soziale Unsicherheit oder enge Wohnverhältnisse”, sagt Allemann. Gewalt und Femizide gebe es jedoch in allen Gesellschaftsschichten – auch in bürgerlichen Kreisen.
Das prominenteste Beispiel hierzu ist die Schweizer Skirennfahrerin Corinne Rey-Bellet. Sie wurde 2006 mit ihrem Bruder vermutlich von ihrem Ehemann in einem Chalet erschossen. Vermutungen zufolge hatte sich das Paar kurz zuvor getrennt. Zwei Tage später tötete sich der Ehemann selbst.
Viel getan, aber nicht genug
„Wir müssen verstehen, dass Menschen auch in der Schweiz aufgrund ihres Geschlechts getötet werden”, sagt Eggler. Jede Einsparung in der Gleichstellungspolitik und jeder Entscheid gegen eine Aufstockung der Mittel für die Gleichstellung erhöhe deshalb auch das Risiko für einen weiteren Femizid. Ein Verständnis, das noch nicht überall angekommen sei.
Zu einem ähnlichen Schluss kommt die Expertengruppe Grevio. Sie prüfte die Schweiz 2022 zur Umsetzung der Istanbul-Konvention und lobte unter anderem den nationalen Aktionsplan und die Massnahmen, die die Schweiz ergriffen hat, vor allem zur Verhinderung von häuslicher Gewalt. Die Strategie müsse jedoch auf geschlechterspezifischer Perspektive erweitert werden und alle Formen von Gewalt gegen Frauen einschliessen, so das Fazit. Es brauche zudem mehr finanzielle und personelle Ressourcen, etwa für frauenspezifische Opferhilfezentren oder Notunterkünfte.
„Familiendrama”, ein verharmlosender und irreführender Begriff, den man heute zum Glück immer weniger liest – auch dank der Hartnäckigkeit von Expert*innen und Aktivist*innen.
Seit Inkrafttreten der Konvention hätten Bund und Kantone den Fokus von häuslicher Gewalt auf alle Gewaltformen ausgeweitet, schreibt der Bund auf Anfrage. „Dabei wird zunehmend eine breite Definition verwendet, die auch strukturelle Ursachen wie ungleiche Machtverhältnisse und fehlende Gleichstellung berücksichtigt.”
Die Finanzen würden zudem regelmässig überprüft. Seit 2021 stehen jährlich drei Millionen Franken zur Verfügung für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
Man denke noch zu wenig langfristig, meint dagegen Eggler. „Menschen kommen nicht als Täter*innen zur Welt. Wir müssen deshalb so früh wie möglich verhindern, dass jemand überhaupt zum*zur Täter*in wird.” In der Pflicht sieht Eggler etwa die Bildung, wo die Gleichstellung der Geschlechter sowie Gewaltprävention zu wenig thematisiert werde.
Als zweites Beispiel nennt Eggler die Gerichte: Väter hätten im Falle einer Scheidung oft noch immer ein Sorge- und Besuchsrecht für ihre Kinder – selbst wenn sie gegenüber der Mutter Gewalt anwenden. „Und das, obwohl wir wissen, dass Kinder aus einem gewalttätigen Elternhaus später eher dazu neigen, selbst Gewalt anzuwenden”, so Eggler.
Staat in der Verantwortung
Am 21. März 2023 stach in Siders im Wallis ein 88-jähriger Mann mutmasslich auf seine 79-jährige Ehefrau ein. Sie starb in der Folge, der Mann wurde festgenommen. Die Walliser Kantonspolizei schrieb dazu: In einer Wohnung in Siders habe sich ein „Familiendrama” ereignet.
Ein verharmlosender und irreführender Begriff, den man heute zum Glück immer weniger liest – auch dank der Hartnäckigkeit von Expert*innen und Aktivist*innen.
Wer hingegen durch die Kommentare von Online-Plattformen und sozialen Medien scrollt, liest immer wieder, dass Beziehung Privatsache sei und die Opfer vielleicht auch ihren Teil zur Gewaltdynamik beisteuerten.
„Das trägt sicher dazu bei, dass wir nicht mehr über Femizide sprechen”, sagt Allemann von der Opferhilfe. Bei der Bekämpfung von Femiziden, sieht sie vor allem den Staat in der Pflicht: Er habe die Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen. Das gilt auch für Frauen.
Bei diesen Beratungsstellen und Telefon-Hotlines finden Betroffene von Gewalt Hilfe.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?