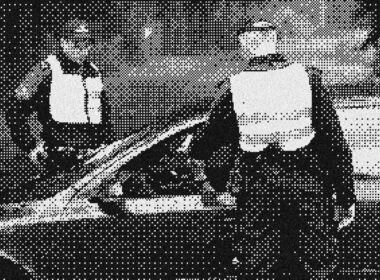Als sich am vorletzten Samstag über achttausend Personen in Bern zu einer nationalen Palästina-Demo versammelten, waren zwei Jahre vergangen, in denen Israel seine Angriffe auf Gaza nicht beenden wollte. Laut Menschenrechtsorganisationen hat die israelische Armee mittlerweile mindestens 100’000 Palästinenser*innen getötet, 80 Prozent davon sind Zivilist*innen. 95 Prozent der Bevölkerung Gazas ist vertrieben worden, im Extremfall über 20-mal. Die gesellschaftlichen Infrastruktur ist fast vollständig zerstört: Laut eines UN-Berichts liegt Gaza dermassen in Schutt und Asche, dass 105 Lastwagen 22 Jahre bräuchten, um die Überbleibsel aus dem Küstenstreifen abzutransportieren.
In diesen letzten zwei Jahren haben Menschen in der Schweiz – wie weltweit – unaufhaltsam versucht, ihre Regierungen zum Handeln zu bewegen: mit Besetzungen, Demonstrationen, Kundgebungen, Petitionen, Hungerstreiks, Hilfsflotten und vielen weiteren Aktionen. Immer wieder appellierten sie an die Schweizer Politik, das zerstörerische Vorgehen der rechtsextremen israelischen Regierung endlich zu sanktionieren. Doch die meisten dieser Bemühungen blieben ohne Wirkung: die Schweizer Politik reagierte weitgehend tatenlos und profitiert weiterhin wirtschaftlich vom Krieg, während die Zerstörung Gazas unvermindert anhält.
Vor diesem Hintergrund versammelten sich Tausende zu einer Demonstration, zu der der Berner Kantonspolizei bereits im Vorfeld ein grosses Repressionsaufgebot ankündigte. Dafür zog sie Unterstützung aus den Polizeikonkordaten Nordwestschweiz, Zentralschweiz, Ostschweiz und Westschweiz zusammen, wie sie der Republik erklärte. An der Demonstration waren schliesslich 27 verschiedene Polizeikorps im Einsatz, darunter auch die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein.
Die Demonstrant*innen sprechen von über 300 Verletzten durch Polizeigewalt.
Einige hundert der über achttausend Demonstrant*innen formierten sich zu einem schwarzen Block – eine Demotaktik, um sich vor Repression zu schützen. Diese liess auch nicht lange auf sich warten: Die Demonstrant*innen sprechen von über 300 Verletzten durch Polizeigewalt, teilweise durch Geschoss auf Augenhöhe. Amnesty Schweiz prüft derzeit 200 Meldungen wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen.
In den hunderten Medienberichten zur Demonstration fand der Kontext des anhaltenden Genozids in Gaza und die Schweizer Beteiligung nahezu keine Beachtung. So rissen bürgerliche Medien die Vorkommnisse an der Demonstration aus ihrem Zusammenhang. Mit grosser Lust an linker Denunzierung stürzten sie sich auf den Umfang der Sachbeschädigung und stellten dubiose Forderungen zur Kriminalisierung von linken Demonstrant*innen. Den tausenden Teilnehmer*innen am Samstag warfen sie vor, nicht für «Frieden» zu protestieren, sondern aus reinem «Spass an der Action». Mit Demonstrant*innen hat allerdings kaum ein Medium gesprochen.
Die Sprache war von zerstörten Schaufenstern und Schäden in Millionenhöhe, aber nicht von den Millionensummen, die Schweizer Banken am Töten der Palästinenser*innen mitverdienen oder dem anhaltenden Unwillen der Schweiz, Sanktionen gegen Israel zu verhängen.
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Stattdessen war die Demonstration ein gefundener Anlass, das realitätsferne Verbot «der Antifa» und «des schwarzen Blocks» erneut aufs Parkett zu bringen. Und nicht nur das: Der FDP-Sicherheitsdirektor des Kantons Bern, Philippe Müller, forderte in der NZZ, die blosse Teilnahme an unbewilligten Demonstrationen mit Gefängnis zu bestrafen. SVP-Präsident Marcel Dettling plädierte im Blick dafür, alle Namen der Demoteilnehmer*innen öffentlich zu machen, damit beispielsweise ihre Arbeitnehmende informiert würden. Die Weltwoche schlug vor, schon im Vornherein mögliche künftige Demonstrant*innen zu «infiltrieren», also auf technischem Weg in ihre Handys und Computer einzudringen, um ihr Verhalten zu überwachen und von linken Protestaktionen abzuhalten.
Auch über Antisemitismus im Zusammenhang mit der Demonstration und der gesamten Palästina-Bewegung diskutierten Medien im Nachgang ausgiebig. Die NZZ unterstellte der Solidaritätsbewegung gegen den Genozid, sie würden sich «gegen Jüdinnen und Juden» engagieren und verkehrte den Protest gegen die israelische Politik in antisemitisches Engagement. Selbst die linke Wochenzeitung WoZ veröffentlichte einen Artikel, dessen Titel auf Instagram lediglich «Antisemitismus» lautete, wodurch der Eindruck entstand, die gesamte Solidaritätsdemo sei ausschliesslich unter diesem Aspekt zu betrachten und deshalb abzulehnen.
Es ist unbestritten, dass es – wie in allen Schichten und politischen Spektren – auch linke Exponent*innen gibt, die antisemitische Haltungen zeigen oder mindestens unwissend reproduzieren. Aus antifaschistischer Sicht ist die Hamas – und jede andere reaktionäre, religiös-fundamentalistische Organisation – nichts, mit dem Linke auf Tuchfühlung gehen sollten. Das ist den meisten propalästinensischen Aktivist*innen bewusst. Potential für Kritik und Reflexion bleibt dennoch – die Frage ist nur, wann und auf welche Weise sie geäussert wird.
Die Sprache ist von zerstörten Schaufenstern und Schäden in Millionenhöhe, aber nicht von den Millionensummen, die Schweizer Banken am Töten der Palästinenser*innen mitverdienen.
In den derzeitigen Umständen, in denen propalästinensische und die Anti-Genozid-Bewegung auf der ganzen Welt von der Polizei unter dem Vorwand der Antisemitismusbekämpfung niedergeprügelt wird, muss Kritik in den eigenen Reihen sorgfältig formuliert und platziert werden. Sonst schlägt sie in die gleiche Kerbe wie reaktionäre, rechte Kräfte.
Die USA hat ein Verbot antifaschistischer Bewegungen bereits umgesetzt, die Niederlande und Ungarn machen sich auf den selben Weg und auch in Deutschland und der Schweiz wird darüber diskutiert. Zwar ist unklar, was sich genau verbieten lässt, da es «die Antifa» als einheitliche Organisation bekanntlich nicht gibt, aber es braucht auch keine formelle Einheit, um Repressionen zu ermöglichen. Fragwürdige Berichterstattung erweist sich wiedermal als wirksames Mittel, um staatliche Gewalt zu legitimieren und zu fördern.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?