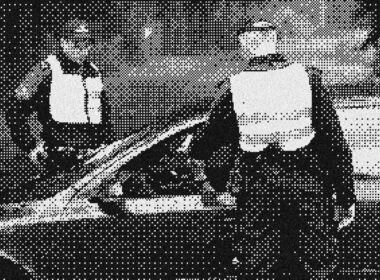Trotz steigender Fallzahlen kündigte der Bundesrat am 14. April Lockerungen der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus an. Und zwar ohne Rücksicht auf das im März angekündigte Drei-Phasen-Modell, mit dem die Pandemie unter Kontrolle gehalten werden soll. Dazu zählten unter anderem eine 14 Tagesinzidenz von unter 350 Fällen pro 100 000 Einwohner:innen, ein R‑Wert unter 1,15 und eine Intensivstationenbelegung unter 300 Betten. Bisher ist nur der letzte Punkt erreicht.
Möglich gemacht worden sei diese aussergewöhnliche Entscheidung durch das verantwortungsbewusste Verhalten der Bevölkerung und den Fortschritt der Impfkampagne. Zudem hätten die bisherigen Lockerungen nicht zu einem drastischen Anstieg der Fallzahlen geführt.
Selbst die NZZ zeigte sich „überrascht“ und sprach von „antizyklischem Verhalten“. So reiben wir uns die Augen: Hat der Bundesrat noch immer nicht begriffen, dass das, was in der Wirtschaft funktioniert, sich nicht einfach auf die Gesundheit übertragen lässt?
Doch nicht nur von bürgerlicher Seite kommt verhaltener Applaus für die „mutige Entscheidung“. Selbst die SP unterstützt den Beschluss, sprach von „einer Perspektive“ und davon, dass man nun die „Impfkampagne vorantreiben“ solle.
Dass die schleichende Kampagne nun als Ausrede für die Öffnung der Wirtschaft missbraucht wird, zeigt vor allem eines: Die Schweiz hat mal wieder nichts gelernt. Um das zu verdeutlichen, lohnt sich ein Blick ins entfernte Chile.
Noch vor wenigen Wochen wurde der Andenstaat als Impfweltmeisterin gefeiert. Kaum ein anderes Land impfte zu der Zeit so schnell wie Chile, Ende März hatten bereits etwa 20 % der Bevölkerung zwei Dosen erhalten. In der Euphorie über eine baldige „Perspektive“ öffnete das Land zunehmend so gut wie alle Wirtschaftszweige. Trotz steigender Fallzahlen wurden im Januar interregionale Reisen wieder erlaubt und im Februar gar Schulen, Kinos und Restaurants geöffnet. Auch Präsenzarbeit wurde wieder eingeführt.
Doch schon bald stiegen die Fallzahlen erneut rasant an, selbst aus ländlichen Gebieten wurden Rekordzahlen gemeldet. Wieder waren die Spitäler überlastet und das medizinische Personal rief um Hilfe. Am 27. März wurde ein neuerlicher Lockdown ausgerufen, selbst die Wahlen vom 11. April wurden um einen Monat verschoben.
Nun wird auch behauptet, dass sich die Entwicklung darauf zurückführen lasse, dass Chile vor allem mit der chinesischen Sinovac impft. Eine Studie aus Brasilien weist einzig eine Immunisierungswirkung von 50 % nach. Doch dies ist zu kurz gedacht: Gemäss der gleichen Studie sollte eine Impfung mit Sinovac zu 100 % vor einem Aufenthalt auf der Intensivstation schützen.
Und doch füllen sich seit März die Intensivstationen, während das Alter der dort behandelten Patient:innen fällt. Es sind immer mehr unter 50-Jährige betroffen, während der Anteil an über 70-Jährigen und mittlerweile auch von über 60-Jährigen abnimmt, die beiden Altersgruppen also, die die höchste Impfrate haben.
Grund dafür, dass immer jüngere Menschen auf den Intensivstationen landen, könnten die neuen Varianten aus den USA und Brasilien sein. Diese sind nach ersten Erkenntnissen deutlich gefährlicher als die bisherigen Virusvarianten.
Chile sitzt nach der überhasteten Öffnung in einem zweiten Lockdown, und hierzulande macht sich der Bundesrat daran, den Fehler vom Juli 2020 zu wiederholen, als er ankündigte, Massenevents von über 1 000 Personen zu erlauben. Doch während in Chile im Juni das Erreichen der Herdenimmunität erwartet wird, kann in der Schweiz frühestens im August oder September mit einem ähnlich hohen Anteil geimpfter Personen gerechnet werden.
Während sich also weltweit neue Virusvarianten ausbreiten, die eventuell sogar die Immunität durch die verfügbaren Impfstoffe zunichtemachen, pulverisiert der Bundesrat die Möglichkeit auf einen entspannten Sommer. Die Regierung lässt sich von der Rechten und den Wirtschaftsverbänden vor sich hertreiben, ohne auf warnende Beispiele wie dasjenige von Chile zu achten. Der dritte Lockdown und Fallzahlen wie im November 2020 zeichnen sich ab. Diesmal aber mit jüngeren Menschen auf den Intensivstationen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 6 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 572 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 210 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 102 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?