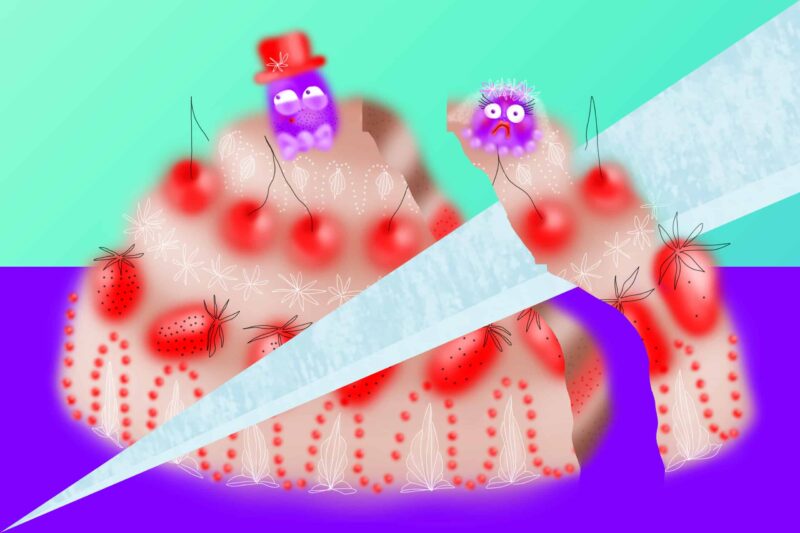Wer in den Tagen nach dem feministischen Kampftag die Zeitungen aufschlug, konnte schnell das Gefühl bekommen, dass das Bundesgericht eigenhändig mit dem traditionellen Familienbild aufgeräumt hat. Die neusten Urteile seien ein Quantensprung für die schweizerische Familienpolitik, meint der Tagesanzeiger; die Ehe sei jetzt kein sicherer Hafen mehr für Frauen, schreibt die NZZ; jetzt werde die Familie modernisiert, hofft die WOZ.
In zwei wegweisenden Urteilen haben die Lausanner Richter – die einzige Bundesrichterin in der Zweiten zivilrechtlichen Abteilung war abwesend – den Anspruch von Unterhaltszahlungen nach einer Scheidung eingeschränkt. Bisher hatten Personen, die sich nach einer sogenannten lebensprägenden Ehe scheiden liessen, Anspruch darauf, den bisherigen Lebensstandard bis zur Pensionierung weiterzuführen. Von einer lebensprägenden Ehe spricht man dann, wenn sie mindestens zehn Jahre dauerte oder das Paar zusammen ein Kind hatte.
In der heteronormativen Praxis bedeutete das meist, dass der Ehegatte für seine ehemalige Partnerin Unterhaltszahlungen leisten musste, sofern diese während der Ehe keiner oder weniger Lohnarbeit nachging. Dasselbe galt bisher für Personen, die bei der Scheidung älter als 45 Jahre alt waren und vor allem unbezahlte Care-Arbeit geleistet haben – auch sie mussten keine neue Arbeitsstelle suchen und hatten Anspruch auf Unterhaltszahlungen bis zum AHV-Alter.
Neu gilt für beide Fälle kein pauschaler Anspruch mehr auf Unterstützung durch den ehemaligen Ehepartner, sondern nur noch in Einzelfällen und für eine zeitlich beschränkte Dauer. Wer sich scheiden lässt, soll danach ökonomisch auf eigenen Beinen stehen. Das setzt insbesondere das traditionelle Familienmodell unter Druck: Wer während einer Ehe die Care-Arbeit übernimmt, steht nun nach der Scheidung vielleicht mit leeren Händen da. Und weil diese in der Schweiz überwiegend von Frauen wahrgenommen wird, lesen viele die Bundesgerichtsurteile als Appell an die finanzielle Eigenverantwortung von Frauen in der Ehe.
Armutsfalle Scheidung
„Damals konnte ich es mir einfach nicht vorstellen, während des Heranwachsens meiner Kinder zu arbeiten”, erinnert sich Monika*. Damals, das war 1991, als sie zusammen mit ihrem Partner Zwillinge bekam, drei Jahre später folgte ein weiteres Kind. Zuvor hatte die gelernte Kauffrau Vollzeit gearbeitet. „Vielleicht liegt es an meiner konservativen Erziehung oder daran, dass ich keine Karriereambitionen hatte, aber für uns beide war klar, dass ich zu Hause bleibe und auf die Kinder schaue.”
Dorian Kessler spricht in solchen Fällen von der Idee der Ehe als Versorgungsinstitution für Frauen. Kessler hat im Rahmen eines SNF-Forschungsprojekts an der Berner Fachhochschule zu Unterhaltszahlungen und zum Armutsrisiko nach Scheidungen geforscht. Die Grundidee hinter Unterhaltszahlungen sei patriarchal: „Im Eherecht war bis 1988 festgeschrieben, dass der Ehemann das Haupt der Familie und somit auch für das Haushaltseinkommen zuständig ist”, erklärt Kessler. Mit den Unterhaltszahlungen sollte die finanzielle Verantwortung des Mannes nach der Scheidung fortgeführt werden.
So sollte auch verhindert werden, dass die Öffentlichkeit für die verarmte Ehefrau einspringen muss. Für Monika und ihre Kinder waren die Unterhaltszahlungen überlebenswichtig. Nach der Scheidung blieb ihr nur das gemeinsame Haus – sie hatte das Bauland einst geerbt.
Mit dem revidierten Scheidungsrecht wurde 2000 dem neuen egalitären Eherecht Rechnung getragen; gleichzeitig wurde auch das Unterhaltsrecht verschärft. Wurde zwischen 1990 und 1992 noch bei jeder zweiten Scheidung Unterhalt für die Frau festgelegt, geschah das zwischen 2006 und 2008 nur noch bei jeder dritten. Kurzum: Immer weniger Frauen erhielten nach dem Ende der Ehe Unterstützungszahlungen.
Doch hat sich dieses striktere Unterhaltsrecht tatsächlich als Gleichstellungsmotor herausgestellt? Eher weniger. Mit dem Wegfallen der Unterhaltszahlung wurde von den geschiedenen Frauen zwar immer mehr ökonomische Selbstständigkeit erwartet. „Das ist aber nicht eingetroffen. Unsere Studie zeigt, dass die Einkommen der Frauen in den Jahren nach einer Scheidung nicht angestiegen sind”, sagt Kessler.
Mit anderen Worten: Der Einbruch in Unterhaltszahlungen ging nicht mit einer verstärkten Erwerbstätigkeit einher. Das bestätigt auch eine Studie aus Deutschland. Frauen haben nach einer Scheidung schlicht weniger Geld. Zwar gebe es keine abschliessenden Daten dazu, aber Umfrageergebnisse würden zeigen, dass das Armutsrisiko für geschiedene Frauen in den letzten Jahrzehnten gestiegen sei. „Ob das durch das Wegfallen der Unterhaltszahlungen erklärt werden kann, muss aber zuerst erforscht werden”, so Kessler.
Der Forscher zweifelt dann auch an der Gleichstellungswirkung der jüngsten Verschärfung im Unterhaltsrecht. Es erinnere ihn ein wenig an die Diskussion rund um die Kürzungen bei der Sozialhilfe: „Die wirtschaftsliberale Idee, dass Menschen durch Unterstützungsleistungen arbeitsscheu werden und sich nur durch Kürzungen zur Arbeit motivieren lassen, lässt sich empirisch kaum nachweisen.”
Abendeinsätze im Gastgewerbe
Trotzdem scheint das Bundesgericht an der Idee festzuhalten – und beweist Realitätsferne: So hält es in einem der beiden Urteile fest, dass die Beschwerdeführerin sich trotz ihrer Care-Arbeit für die drei gemeinsamen Kinder stärker auf dem Arbeitsmarkt hätte bemühen sollen. Das Bundesgericht liefert im Urteil auch gleich mögliche Berufsfelder für die studierte Informatikerin: Gastgewerbe, Detailhandel, Pflegebereich.
„Das ist zynisch”, meint dazu Aline Masé. Sie ist Leiterin der Fachstelle Sozialpolitik bei der Caritas Schweiz. Gerade der Pflegebereich sei ohne Ausbildung prekär: sehr hohe Belastung bei schlechter Bezahlung. „Natürlich wäre es aus Sicht der Armutsprävention gut, wenn Frauen motiviert werden, auch in einer Ehe erwerbstätig zu bleiben.” Da aber Frauen überdurchschnittlich viel Care-Arbeit in der Ehe übernehmen und somit häufig und für lange Zeit aus der Arbeitswelt scheiden würden, sei nach der Scheidung fast nur ein Einstieg in die Tieflohnbranche möglich. Für Monika bedeutete das unregelmässige Abendeinsätze im Gastgewerbe. Gereicht hat das Geld aber nicht, auch nicht mit den Unterhaltszahlungen.
In solchen Fällen greift die Sozialhilfe. Und das nicht selten: Die Wahrscheinlichkeit, erstmals Sozialhilfe beantragen zu müssen, ist für Frauen nach einer Scheidung mehr als 300 Prozent höher als für ihre Ex-Partner; rund jede achte Frau mit schulpflichtigen Kindern ist ein Jahr nach der Trennung von der Sozialhilfe abhängig. Bei den Männern ist es jeder Zwanzigste.
Monika war lange auf Unterhaltszahlungen, Nebeneinkommen und Sozialhilfe angewiesen. Jetzt, da alle ihre Kinder im Erwachsenenalter sind, arbeitet sie in der Verwaltung. „Neben der Erziehungsarbeit und der Lohnarbeit im Restaurant hatte ich schlicht keine Energie mehr, mich auf andere Stellen zu bewerben”, erinnert sich Monika.
Überhaupt sei der Arbeitsmarkt gar nicht bereit, die geschiedenen Frauen mit Kleinkindern aufzunehmen, meint Aline Masé von der Caritas. Für Frauen, die zu Hause einen Grossteil der Kinderbetreuung übernehmen und nur in einem geringen Pensum arbeitstätig sein können, ist es sehr schwierig, eine gut bezahlte Arbeit zu finden.
Es droht die Altersarmut
So sieht es für geschiedene Frauen dann auch nach der Pensionierung düster aus. Monika erwartet, dass sie gerade einmal 3 500 Franken pro Monat erhalten wird – AHV und Pensionskasse zusammen. Der Grund dafür? Der sogenannte „Gender-Pension-Gap”.
Frauen erhalten in der Schweiz rund einen Drittel weniger Rente als Männer. Und zwar aus den immergleichen Gründen: Frauen übernehmen mehr Care-Arbeit für die Familie. Da diese aber nicht bezahlt wird und somit nur kleine Pensionskassenbeiträge geleistet werden, erhalten sie – wenn überhaupt – nur geringe Leistungen aus der beruflichen Vorsorge. Wenn sie neben der Erziehungsarbeit doch noch Teilzeit arbeiten – etwa im Pflegebereich oder im Gastgewerbe – verdienen sie oft weniger als die 21 150 Franken, die den Arbeitgeber zu Beiträgen an die Pensionskasse verpflichten. Besonders einschneidend ist der Gender-Pension-Gap für geschiedene Frauen: Fast ein Drittel von ihnen ist auf Ergänzungsleistungen angewiesen, also zusätzliche finanzielle Unterstützung, weil das Geld im Alter nicht zum Leben reicht.
Was also tun? „Die Scheidung ist der falsche Moment, um Gleichstellung zu schaffen”, ist Kessler überzeugt. Es wäre viel wirkungsvoller, Gleichstellung zu fördern, bevor Paare eine feste Rollenverteilung eingehen. Für Aline Masé liegt der Schlüssel im Ausbau und der stärkeren Subvention von ausserfamiliären Betreuungsangeboten. So fehlte im Dorf, in dem Monika ihre Kinder grosszog, ein Angebot für Fremdbetreuung, Grosseltern gab es keine. „Hätte ich meine Kinder zu einer Tagesmutter gegeben, wäre mein ganzes Einkommen dafür draufgegangen”, sagt Monika.
Doch eigentlich wären sowieso weit tiefgreifendere Veränderungen angezeigt: Aufwertung von prekären Berufen im Pflege- und Betreuungsbereich, finanzielle Wertschätzung von Care-Arbeit, kompromisslose Lohngleichheit und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen von patriarchalen Geschlechterrollen.
Alles Forderungen des feministischen Kampftages, also.
* Name der Redaktion bekannt
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 20 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1300 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 700 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 340 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?