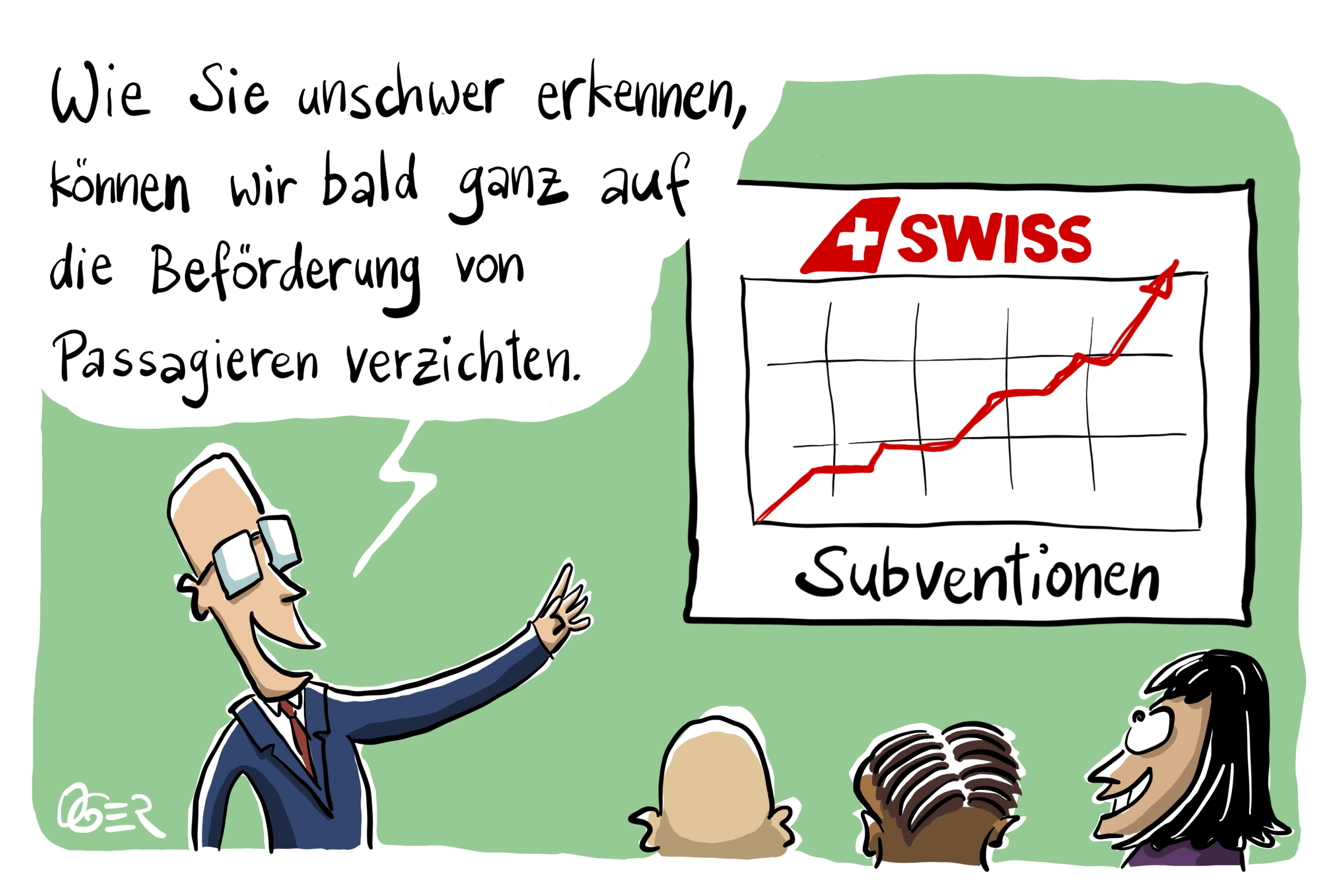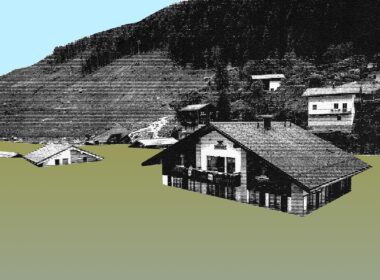„Einige dieser Leute sind unerträglich, so oberflächlich und egozentrisch. Aber sie denken, sie wissen alles”, sagte Ugandas Präsident Yoweri Museveni am 27. September 2022 während des International Oil and Gas Summit in Ugandas Hauptstadt Kampala. Seine Worte galten den EU-Abgeordneten, die ein paar Tage davor, am 14. September 2022, eine Resolution annahmen, die das East African Crude Oil Project (EACOP) verurteilt.
Die Abgeordneten forderten die EU und die internationale Gemeinschaft auf, „maximalen Druck auf die ugandischen und tansanischen Behörden sowie die Projektträger und ‑beteiligten auszuüben, um die Umwelt zu schützen und die Fördertätigkeiten in geschützten und sensiblen Ökosystemen, einschliesslich der Ufer des Albertsees, einzustellen”. Darüber hinaus verlangten sie von Total Energies als grössten Anteilseigner der Pipeline, sich ein Jahr Zeit zu nehmen, um das Projekt zu überdenken.
Der ugandische Präsident Museveni meldete sich dazu auch auf Twitter: „Wir sollten uns daran erinnern, dass Total Energies mich von der Pipeline-Idee überzeugt hat; wenn sie auf das EU-Parlament hören, werden wir einen anderen Partner finden.”
In der Debatte um das Megaprojekt des Ölkonzerns Total in Ostafrika geht es nicht nur um den Schutz der Umwelt und Menschenrechte, sondern auch darum, wer wie von diesem Projekt profitieren wird. Dabei stützt sich die Kritik sowohl der Befürworter*innen als auch der Gegner*innen des Projekts auf neokolonialistische Argumente.
Europas Mangel an Selbstkritik
Federführend in den Verhandlungen im EU-Parlament war der französische Sozialdemokrat Pierre Larraoutoru. Mit der Resolution will er ein Projekt stoppen, das in Frankreich illegal wäre, da sich die Europäische Union in einer Übergangsphase zu grüner Energie befindet und keine Erdölförderung finanziert.
Obwohl das Europäische Parlament keinerlei bindende Befugnisse hat, schon gar nicht gegenüber von Privatunternehmen, die im Ausland tätig sind, haben die afrikanischen Länder die Botschaft der Resolution als Drohung verstanden. So kritisierte auch der stellvertretende Sprecher des ugandischen Parlaments, Thomas Tayebwa, die Europäer*innen dafür, dass sie sich in die Angelegenheiten ihrer Länder einmischen. „Das ist Neokolonialismus und Imperialismus auf höchstem Niveau, der sich gegen die Souveränität Ugandas und Tansanias richtet”, sagte er gegenüber dem ugandischen Boulevard-Magazin RedPepper.
Die von Regierungsvertreter*innen geäusserte Meinung teilen auch einige Jugendliche im Land. „Ich dachte, vielleicht gibt es ein Missverständnis oder sie sind voreingenommen. Ich war verwirrt”, sagt uns Rahma Nantongo zur Resolution des Europäischen Parlaments. Die 23-jährige Studentin der Geologie und Erdölwissenschaften an der Makerere-Universität trinkt einen Schluck schwarzen Kaffee in einem schicken Café in Kampala. Sie ist überzeugt davon, dass ihr Land Öl braucht, um sich zu entwickeln. In zwei Tagen wird sie eine Veranstaltung am Öl- und Gassymposium in Kampala leiten, an dem Akteur*innen des Sektors teilnehmen, darunter auch Philippe Groueix, der Geschäftsführer von Total Energies Uganda.

„Seit die Nord Stream-Pipeline geschlossen wurde, suchen die europäischen Länder Ressourcen in Ländern wie Uganda. Gleichzeitig sagen sie uns, dass wir dieses Projekt, das für unsere Entwicklung sehr nützlich ist, aufgeben sollen”, sagt Nantongo. „Total Energies wird in Katar investieren, und niemand kritisiert das. Was wollt ihr also von uns?”
Die Kritik in Uganda und Tansania gegen diejenigen in Europa, die sich gegen das Projekt aussprechen, zielt auf deren Mangel an Selbstkritik. Im Juli 2022 beschloss Deutschland wegen der Kürzungen der Gaslieferungen von Russland seine Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Die Europäische Union hat derweil Erdgas als grüne Energie eingestuft, um die Finanzierung solcher Erschliessungen zu ermöglichen.
Die von der französischen Total Energies geplante grösste beheizte Ölpipeline der Welt soll ugandisches Öl über Tansania aus dem Kontinent exportieren. Das Projekt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Europa nach Energiealternativen sucht und die Welt darüber debattiert, ob Afrika seine eigenen Ressourcen erschliessen darf. Denn die EACOP gefährdet nicht nur Menschenrechte und sensible Gebiete mit Korallenriffen und Mangrovenwäldern, sondern öffnet auch die Tür für zukünftige Ölprojekte in Ostafrika – und bedroht damit viele weitere Ökosysteme.
Teil 1: Ostafrikas Ölpipeline: Ein Rückschlag für Umwelt und Menschenrechte
Teil 2: Neokolonialismus der EACOP: Ein beidseitiger Vorwurf
Teil 3: Gefährdete Ökosysteme: Kein Ende in Sicht nach der EACOP
Diese Recherche wurde von Journalismfund.eu unterstützt.
Leben ohne Strom
Die europäischen Länder haben drastische Massnahmen ergriffen, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Studentin Nantongo meint dazu, dass in Uganda Energiemangel ganz normal sei. Sie fordert die europäischen Gesetzgeber*innen auf, mal darüber nachzudenken: „Versetzen Sie sich in die Lage von durchschnittlichen Ugander*innen. An manchen Orten gibt es keinen Strom. Darum müssen wir unsere Stromversorgung ausbauen.”
In Uganda und Tansania leben über 60 Millionen Menschen ohne Zugang zu Elektrizität, und die beiden Länder können nicht einmal den Energiebedarf der Hälfte ihrer Bevölkerung decken. 2021 waren immer noch 94 Prozent der ugandischen Haushalte auf Feuerholz oder Holzkohle zum Kochen angewiesen.
Die Kritik aus afrikanischen Ländern bezieht sich aber nicht nur auf den plötzlichen klimapolitischen Richtungswechsel Europas angesichts der Energieknappheit in den eigenen Ländern, sondern vor allem darauf, dass ihnen vorgeworfen wird, zu einem Klimawandel beizutragen, für den sie nicht verantwortlich sind. „Afrika hat die geringsten Emissionen weltweit, während Europa den grössten Teil dazu beiträgt”, sagt Nantongo. „Sie sollten bei sich selbst ansetzen.”
Während auf die EU-Länder 22 Prozent der historischen Emissionen entfallen, hat Afrika als Ganzes mit der doppelten Anzahl von Ländern nur drei Prozent dazu beigetragen – eine Zahl, die auf 0.55 Prozent sinkt, wenn man nur die 46 afrikanischen Länder südlich der Sahara ohne Südafrika und Nigeria berücksichtigt.
Einer der Hauptkritikpunkte der Umweltschützer*innen ist, dass die EACOP 34 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre emittieren und damit die jährlichen Emissionen Ugandas und Tansanias verdreifachen wird. Dennoch wären diese Emissionen fast zehnmal kleiner als die 306 Millionen Tonnen CO2, die Frankreich allein im Jahr 2021 ausgestossen hat.
Neokoloniale Rohstoffgewinnung
Während die Befürworter*innen der EACOP die europäischen Gegner*innen des Projekts als Neokolonialist*innen bezeichnen, verwenden die Gegner*innen der Erdölförderung dasselbe Wort, um die Profiteur*innen des Projekts zu beschreiben. Letztere argumentieren, dass die EACOP afrikanische Ressourcen ausbeutet und Europa wie in der Vergangenheit davon profitieret. Sie kritisieren unter anderem, dass die EACOP mehr als 70 Prozent des ugandischen Rohöls ins Ausland exportieren wird. Nur 60’000 der 216’000 Barrel, die bei maximaler Kapazität täglich gefördert werden würden, sollen in Uganda raffiniert werden – und kein einziges Barrel davon in Tansania.
„Das ist unternehmerischer Neokolonialismus”, sagt Baraka Lenga, ein tansanischer Umweltaktivist, der gegen das Projekt kämpft. Wir treffen ihn für ein Interview am Rande der Stadt Dar es Salaam, wo er mit einem Kollegen eine Grundschule gegründet hat, die das Bewusstsein für den Klimawandel fördern soll. Als er das letzte Mal nach Tanga gereist ist, wo das Hafenterminal gebaut werden soll, hat die Polizei ihn verhört und seinen Reisepass eingezogen.

Baraka sieht in der EACOP eine Fortsetzung des neokolonialen Trends: Rohstoffe exportieren, diese im Ausland raffinieren und zu einem höheren Preis wieder in die Ausgangsländer einführen. Der ugandischen und tansanischen Bevölkerung wird also nicht nur zu wenig Öl zur Verfügung stehen, sondern die unteren und mittleren Schichten werden es sich nicht einmal leisten können.
Ausserdem argumentieren Umweltschützer*innen, dass Total Energies nicht genügend Steuern bezahlen wird. Die ugandische Regierung erklärte sich bereit, die EACOP zehn Jahre lang von der Mehrwerts- und Körperschaftssteuer zu befreien. Letztere liegt für ausländische Unternehmen normalerweise bei 30 Prozent. Darüber hinaus kündigten sowohl Uganda als Tansania an, dass die EACOP die Transitgebühren und Quellensteuern von fünf Prozent nicht bezahlen muss.
So würde der grösste wirtschaftliche Nutzen für die beiden afrikanischen Länder durch ihre nationalen Energieunternehmen entstehen. Die Uganda National Oil Company und die Tanzania Petroleum Development Corporation halten jeweils einen Anteil von 15 Prozent an der EACOP-Gesellschaft. Nach heutigem Stand würde das bedeuten, dass beide Länder bei maximaler Kapazität beim derzeitigen Preis für ein Barrel Rohöl etwa 2.5 Millionen Dollar pro Tag verdienen könnten.
Kein Geld für erneuerbare Energien, keine Arbeitsplätze
Die ugandische Umweltaktivistin Hamira Kobusingye findet das nicht genug, denn ihr Land wird in den kommenden Jahren die Hauptlast der Umweltkosten zu tragen haben. „15 Prozent [der Anteile] ist zu wenig, um die Folgen der Klimakrise bewältigen zu können”, sagt Kobusingye. Wir befinden uns in ihrem Haus in Kampala, das ihr auch als Büro dient, in dem sie Aktionen der Bewegung Fridays for Future plant. „Ich glaube, dass das in fossile Brennstoffe investierte Geld mehr Arbeitsplätze schaffen könnte, wenn es in sauberere Energie umgelenkt würde”, sagt sie und fügt an: „Ohne dass es zu Vertreibungen käme.”
Uganda hat mehr Sonnenschein und mehr Wasser als nötig, um seine Unternehmen und Haushalte mit Strom zu versorgen, sagt die Klimaaktivistin. 5’300 Megawatt pro Jahr beträgt das ugandische Potenzial für erneuerbare Energien – viermal so viel wie die derzeitige Kapazität und siebenmal so viel wie der Energiebedarf. „Dieser Bereich wird sich aber nicht genügend weiterentwickeln, weil er den grossen Unternehmen nicht genug Einkommen einbringt”, sagt Kobusingye.
Obwohl Ostafrika den Klimawandel nicht verursacht hat, ist es eine der am stärksten betroffenen Regionen der Welt. Derzeit erlebt das Horn von Afrika die schlimmste Dürre seit 40 Jahren und weder Uganda noch Tansania sind auf extreme Klimaereignisse vorbereitet.
Kobusingye kritisiert auch, dass die EACOP Arbeitsplätze für Ingenieur*innen mit höherer Ausbildung schaffen wird, aber nicht für die weniger gebildete Bevölkerung. „In Kabaale, dem Startpunkt der Pipeline, haben junge Leute gestreikt, weil sie nicht einmal in der Bauphase beschäftigt wurden.” Sie hätten argumentiert, dass sie in den USA oder Grossbritannien studieren müssten, um in ihrem eigenen Land eine Anstellung zu finden. „Auch das ist Umweltkolonialismus: Wenn ein einfach ausgebildeter Mensch aus Uganda nicht in einem solchen Projekt beschäftigt werden kann”, sagt Kobusingye.
Diese Situation entstand auch in Chongoleani an der Küste Tansanias: Die EACOP-Projektleitung suchte Lkw-Fahrer*innen, um das neue Hafenterminal für den Ölexport bauen zu können. Sechzehn Fahrer wurden in zwei Küstendörfern für den Job interviewt. „Das Problem war aber, dass sie für die nötigen Zulassungspapiere erst in die Hauptstadt Dar es Salaam hätten fahren müssen”, sagt Devotha Cassian, Direktorin der Northern Coalition for Extractives and Environment (NCEE) in Tansania. Den Lkw-Fahrern fehlte das Geld dazu. „Es ist ein schwieriger Prozess, mit internationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten”, sagt sie in der NCEE-Zentrale in der Küstenstadt Tanga, von wo aus die Organisation all ihre Aktivitäten plant.
Die NCEE setzt sich dafür ein, dass die einheimische Bevölkerung über das Projekt informiert wird. Die Organisation übt auch Druck auf die Projektentwickler*innen aus, damit diese die notwendigen Pläne zur Schadensbegrenzung erstellen und einhalten. „Die Fischer*innen waren unsere erste Sorge. Denn wenn sie weiterhin im Projektgebiet fischen wollen, brauchen sie nun spezielle Ausrüstung”, sagt Cassian. Aber diese Ausrüstung könnten sich die meisten Leute nicht leisten.
„Das Problem ist wiederum, dass sich niemand mit den Arbeitsbedingungen der Fischer*innen befasst”, bedauert Cassian. Sowohl die Regierung als auch der Konzern scheinen ihr Projekt fernab der Lebensrealitäten der lokalen Bevölkerung umzusetzen.
Dieser Artikel wurde von Maria-Theres Schuler vom Englischen ins Deutsche übersetzt.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 72 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 4004 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 2520 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 1224 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?