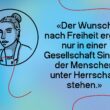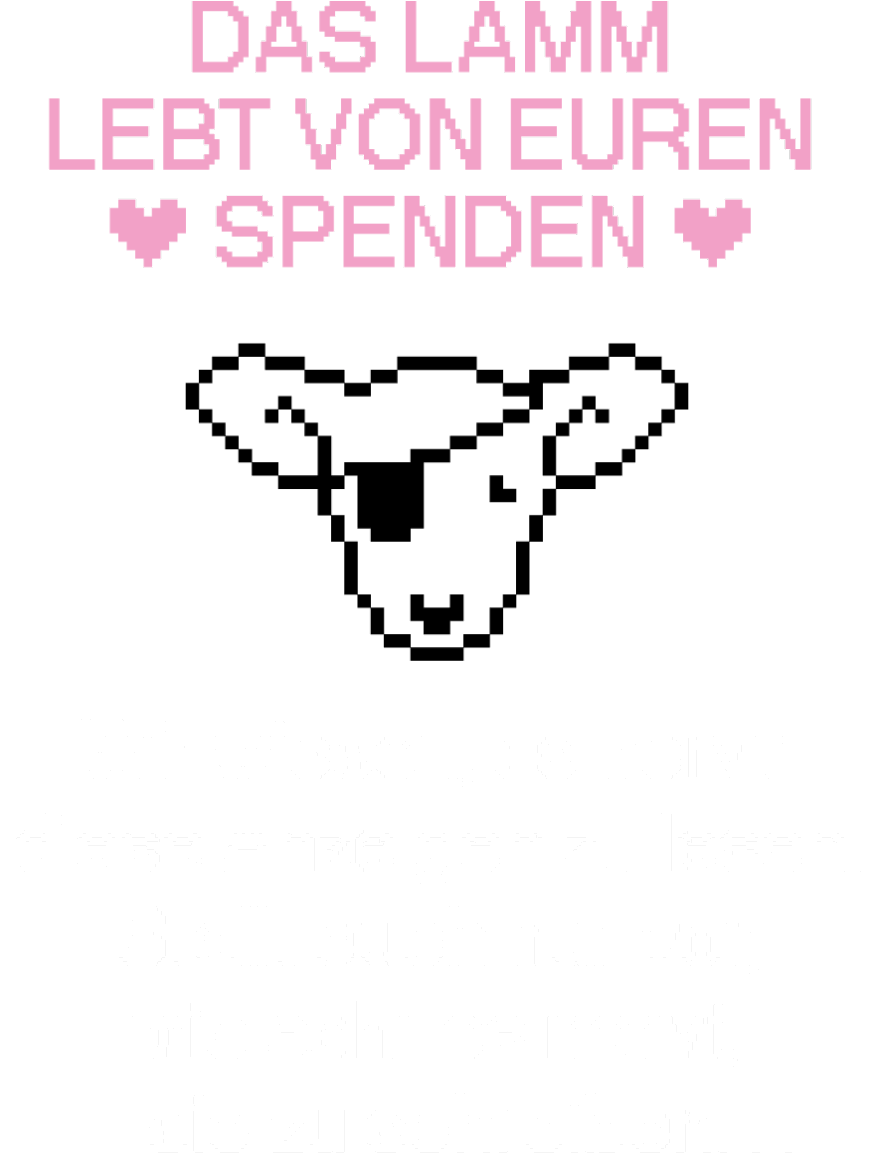Nach einem negativen Asylentscheid über Jahre in der Illegalität und dem zermürbendem Nothilferegime gefangen sein. Trotz einer Aufenthaltsbewilligung auf sich allein gestellt sein – ohne Zugang zu Sprachkursen oder Zukunftsaussichten. Das sind Lebensrealitäten von Menschen im Asylregime. Doch ihre Geschichten bleiben hinter den Türen der Bundesasylzentren verschlossen oder in abgelegenen Nothilfecamps verborgen.
Omid* und Berfin haben diese Strukturen selbst durchlebt. Sie erzählen, wie sie Wege fanden, sich zu organisieren, Unterstützung zu erhalten und selbst aktiv zu werden. Ihre Geschichten zeigen, wie wichtig solidarische Netzwerke und politische Arbeit im Leben von geflüchteten Menschen sind – besonders dort, wo staatliche Strukturen auf Abschottung und Repression setzen.
Dieser Beitrag ist Teil der Reihe “Stimmen aus den Camps“.
Berfin
Viele der kurdischen Frauen können bis heute kein Deutsch. Sie bleiben zuhause, passen auf die Kinder auf und bewegen sich nur in ihren eigenen Communities. Anfangs hatte ich auch einen sehr engen Horizont. Selbst Kurd*innen, die schon seit 15 Jahren in der Schweiz sind, versuchten mir einzureden, ich könnte nichts erreichen. Sie sagten mir, ich hätte keine Chance zu studieren und ich solle lieber Mutter werden. Lange glaubte ich ihnen. Doch irgendwann habe ich gemerkt, dass sie keine Ahnung haben.
Ich hatte das Gefühl, alle haben ihr Leben im Griff, nur ich nicht.
Berfin, Geflüchtete im Kanton Zürich
Mit 17 kam ich in die Schweiz und habe hier Asyl beantragt. Ich war sicher, aus politischen Gründen eine Bewilligung zu bekommen – das war das Gute an meiner Geschichte. Schnell kam ich nach Bülach in ein Camp, wo ich ein Jahr blieb. Heute ist es anders, doch damals war ich die einzige Frau dort. Teenager konnten normalerweise sofort Deutschkurse besuchen, aber ich war auf mich allein gestellt. Die Gemeinde Bülach zahlte keine Kurse. Die Kirche bot zwar einen an, doch er fand nur zwei Stunden pro Woche statt und war nicht besonders hilfreich. Ich wusste von kurdischen Freund*innen in meinem Alter, die an anderen Orten Deutschkurse besuchen konnten. Ich konnte nur selbst lernen, das hat mich damals sehr frustriert.
In der Zeit in Bülach war ich sehr allein und habe kaum mit wem geredet. Hin und wieder ging ich spazieren, doch weit kam ich nicht. Nach Zürich fuhr ich nur einmal im Monat, zu teuer war das ÖV-Ticket. Ich war nur im Camp und hatte nichts zu tun, und das, obwohl ich so viel vorhatte. Auch wenn ich Freund*innen getroffen habe, hatte ich das Gefühl, alle haben ihr Leben im Griff, nur ich nicht.
Im Camp hatte ich das Privileg, ein Zimmer für mich allein zu haben. Täglich kam eine Person zur Kontrolle in mein Zimmer. Sie lief den Korridor entlang und ich konnte schon von weitem das Klacken ihrer Schuhabsätze hören. Sie schaute nur kurz, was ich mache, und ging dann wieder, doch dieses Geräusch ihrer Schuhe macht mich sogar in der Erinnerung verrückt. In jener Zeit ging es mir psychisch nicht sehr gut. Heute noch versuche ich, Bülach zu vermeiden. Viele kurdische Hochzeiten finden in Bülach statt, doch ich will nicht mehr dorthin zurück.
Später ging ich zum Sozialamt und erklärte, dass ich studieren und deshalb einen Deutschkurs besuchen möchte. Der Sozialarbeiter entgegnete, mein fast erreichtes A2-Niveau reiche aus, um bei Coop oder Migros zu arbeiten. Finanzielle Unterstützung für einen Deutschkurs gäbe es nicht, und im Studium hätte ich keine Chance gegen die Konkurrenz mit perfekten Sprachkenntnissen. Er blickte auf mich herab und versuchte, mir Hoffnung und Selbstvertrauen zu nehmen.
Andere zu unterstützen, ist gut – aber die Geschichten, denen man begegnet, sind oft belastend.
Berfin, Geflüchtete im Kanton Zürich
Zehn Monate später begann ich die KV-Ausbildung und wurde im ersten Semester Klassenbeste. Dank Stiftungen konnte ich dennoch einen Deutschkurs besuchen. Während der Ausbildung arbeitete ich unter der Woche in der Buchhaltung und unterstützte am Wochenende Obdachlose in der Winterstube des Stadtklosters Zürich. Letzte Saison übernahm ich sogar die Leitung der Winterstube.
Derzeit bereite ich mich auf ein Mathematikstudium vor und absolviere einen Kurs, um Deutsch zu unterrichten. Da ich bessere Sprachkenntnisse hatte, begleitete ich oft andere Geflüchtete zu Terminen und übersetzte für sie. Dabei wollte ich sie motivieren, selbst Deutsch zu lernen, und ermutigte sie, sich bei Inaya für geflüchtete Frauen, Familien und Queers zu engagieren. Doch das Übersetzen belastete mich.
Ich habe viel Mitgefühl für die Situation anderer. Ihre Hoffnungslosigkeit beeinflusste meinen Alltag so stark, dass ich manchmal nicht mehr aufstehen wollte. Doch mit der Zeit lernte ich, Grenzen zu setzen – und freute mich jedes Mal, wenn ich helfen konnte. Trotzdem fühlte ich mich bei einigen Geschichten weiterhin hilflos und schlecht.
Ich fragte mich, warum ich eine B‑Bewilligung erhielt und andere nicht. Ich bin nicht anders als sie, und doch kann ich heute fast alles tun, während ihnen vieles verwehrt bleibt. Lange suchte ich nach inneren Kompromissen. Andere zu unterstützen, ist gut – aber die Geschichten, denen man begegnet, sind oft belastend.
Bei Inaya möchte ich weiterhin junge Geflüchtete begleiten – ihnen zeigen, dass sie wichtig sind, dass sie nicht heiraten und Mutter werden müssen, um „jemand“ zu sein. Sie haben eine eigene Persönlichkeit, die sie entfalten können. Sie können viel erreichen.

Omid
Ich fürchtete mich immer, wenn ich die Polizei sah. Jede Kontrolle konnte bedeuten, wieder drei Monate ins Gefängnis zu müssen – nur weil ich illegal war. Heute kann mir die Polizei keine Angst mehr einjagen, sie können mir nichts mehr anhaben.
Seit letztem Jahr habe ich eine Bewilligung. Nach drei langen Jahren, zwei Ablehnungen und einem Rekurs haben die Migrationsbehörden mein Härtefallgesuch angenommen. Zwischenzeitlich hatte ich die Hoffnung verloren. Ich dachte, wenn es so lange dauert, wird es abgelehnt. Umso mehr freute ich mich über den positiven Entscheid. Mein Leben hat sich verändert: Nach 10 Jahren als abgewiesener Asylsuchender fühle ich mich endlich frei.
Die Polizei macht immer noch denselben Mist, und ich will etwas gegen diese Repression tun.
Omid, Geflüchteter im Kanton Zürich
Seitdem hat sich viel getan. Ich machte meinen Führerschein, fand einen Job, lebe in einer WG, kann reisen – habe meine Freiheit zurück und keine Angst mehr vor der Polizei.
Heute gehe ich bei Kontrollen direkt auf die Polizei zu. Ich frage: „Was ist los?“ und stelle sie zur Rede. Die Polizei macht immer noch denselben Mist, und ich will etwas gegen diese Repression tun. Niemand kennt das System besser als die, die es selbst durchlebt haben.
Deshalb besuche ich regelmässig ein Bundesasylzentrum und unterstütze die Menschen dort. Die Besuchsgruppen haben mir stets geholfen. Sie kamen wöchentlich ins Camp. Ich machte Frühstück, sie unterstützten mich. Schnell war klar, dass ich auch Teil einer solchen Gruppe sein möchte, um andere zu unterstützen. Durch die politische Arbeit fand ich viele Freund*innen, die mein Leben bis heute begleiten. Wenn es im Camp schwierig wurde, boten sie mir an, ein paar Nächte bei ihnen zu schlafen.
Als Reaktion auf die zunehmende Repression gegen Asylsuchende haben sich Gruppen solidarischer Menschen gebildet, die im Kanton Zürich alle Bundesasylzentren, die sogenannten Rückkehrzentren und einige Durchgangszentren besuchen. Wöchentlich leisten die Gruppen aus Freiwilligen Rechtsberatung und durchbrechen die Isolation der Camps. In Zürich haben sich die Besuchsgruppen zu dem Bündnis „Wo Unrecht zu Recht wird…” zusammengeschlossen.
Diese Freundschaften waren wichtig für mich. Als Ausländer, der nicht in der Schweiz aufgewachsen ist, kannte ich das Leben hier nicht. Meine Freund*innen halfen mir, mich zurechtzufinden. Auch für das Härtefallgesuch waren sie entscheidend. Wer sonst hätte mir Referenzen geschrieben? Eine Arbeitsbestätigung organisiert? Niemand.
Im Camp zu leben, war wie in einem Sumpf zu stecken. Man konnte sich in keine Richtung bewegen.
Omid, Geflüchteter im Kanton Zürich
Durch die Illegalität habe ich viel verloren. Über zehn Jahre arbeitete ich nicht und verlernte das Rechnen. Meine Kinder haben vergessen, dass ich existiere. Ich hatte kaum Kontakt zu ihnen und erzählte ihnen nie vom Leben im Camp. Was hätte ich ihnen auch erzählen sollen? Nun beantrage ich den Familiennachzug und hoffe, meine Kinder bald wiederzusehen.
Im Camp zu leben, war wie in einem Sumpf zu stecken. Man konnte sich in keine Richtung bewegen. Dazu kam die tägliche Demütigung durch die Mitarbeitenden. Sie sagten: „Hey Arschloch, was machst du noch hier? Du musst zurück in dein Land!“ Doch wenn ich könnte, wäre ich längst zurück. Das wussten sie genau. Ich bat um Hilfe, und sie antworteten, ich solle ausreisen – das machte mich fertig.
Auf dem Migrationsamt ging die Demütigung weiter. Immer wieder luden sie mich zu Rückkehrberatungen ein. Zuerst zeigten sie Fotos von glücklichen Menschen, die in ihr Land zurückkehrten und phantasierten schöne Lebensgeschichten. Ich sagte: „Ihr seid Lügner! Wer politisch aktiv ist, kann nicht in den Iran zurückkehren und ein gutes Leben aufbauen.“ Später wurden die Gespräche aggressiver. Die Mitarbeitenden des Migrationsamts wollten mir Angst machen: „Wir schaffen dich aus! Du wirst nie eine Chance auf eine Aufenthaltsbewilligung haben. Deine Haare werden weiss wie deine Zähne, und noch immer wirst du hier im Camp sein.“
Ich kannte einen, der in den Iran zurückkehrte – so hoffnungslos war seine Situation in der Schweiz. Als sein Flug im Iran landete, verhafteten sie ihn sofort und er musste zehn Jahre ins Gefängnis. Es ist gefährlich zurückzukehren, ich darf gar nicht daran denken. Bei mir wäre es noch schlimmer, ich war politisch sehr aktiv!
Ich wollte den Leuten hier keinen Grund geben, mich für einen schlechten Menschen zu halten.
Omid, Geflüchteter Kanton Zürich
Über Jahre hinweg organisierte ich jede Woche Demonstrationen. Von Zürich über Bern bis nach Lausanne war ich in fast allen grossen Städten der Schweiz auf der Strasse. Als die Proteste gegen das iranische Regime auch in die Schweiz kamen, hatte ich kurz Hoffnung, dass ich zurück in den Iran kann. Doch obwohl die Proteste gross waren, bleiben wir zu klein, um gegen das Regime anzukommen. Trotzdem kämpfen wir weiter, denn etwas anderes bleibt uns nicht übrig.
Vor langer Zeit besuchte ich meinen ersten Deutschkurs an der Autonomen Schule Zürich (ASZ). Die Aktivist*innen der ASZ fragten, ob ich mithelfen möchte, und boten mir dafür ein ÖV-Ticket an. Zeit hatte ich viel, doch Geld für den ÖV keines. Die 10.50 Franken Nothilfe reichten nirgendwo hin. So fing ich an, im Schulbüro der ASZ zu arbeiten. Endlich hatte ich etwas zu tun und konnte mit dem Ticket hinfahren, wo immer ich wollte.
Tausende Menschen befinden sich in der Schweiz in Asylverfahren und sind in verschiedenen Arten von Unterkünften untergebracht. Ein grosser Teil der Bevölkerung hört von diesen Orten nur dann, wenn es zu Konflikten kommt oder wenn Missstände aufgedeckt werden. Das Lamm will dem etwas entgegensetzen: In der Reihe „Stimmen aus den Camps” stehen die Menschen in den Asylunterkünften im Zentrum. Dabei sollen insbesondere diejenigen zu Wort kommen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Sie leben in sogenannten Rückkehrzentren oder Camps, wie sie sie selbst oft nennen. Die Beiträge stellen jeweils ein Thema in den Fokus und lassen die Bewohner*innen selbst zu Wort kommen.
Eines Tages verfolgte mich die Polizei auf dem Weg zur ASZ. Sie beobachteten mich, wie ich in Urdorf in den Bus stieg und fuhren hinterher. In Schlieren stoppten sie den Bus, stiegen ein und kontrollierten mich. Vor all den Leuten im Bus führten sie mich in Handschellen ab. Nur weil ich illegal war, denn ein Busticket hatte ich. Es war mir so peinlich, dass ich vor Scham im Boden versinken wollte. Seitdem fuhr ich nur noch mit dem Fahrrad zur ASZ.
Als ich in die Schweiz kam, versuchte ich, alles korrekt zu machen. Ich klaute nicht, auch wenn ich Hunger und kein Geld hatte. Kaufte mir von meinem wenigen Geld immer ein Busticket. Ich wollte den Leuten hier keinen Grund geben, mich für einen schlechten Menschen zu halten. Doch egal, wie du dich verhältst: Wenn du illegal bist, kommst du sowieso ins Gefängnis.
Ich bin nicht berühmt, ich bin nur politisch aktiv.
Omid, Geflüchteter im Kanton Zürich
Neun Monate lang musste ich im Ausschaffungsgefängnis am Zürcher Flughafen ausharren. Unter der Woche hatte ich fast jeden Tag Besuch – von Freund*innen, die mich aus der ASZ kannten oder Teil der Besuchsgruppe waren, die mich in Urdorf besuchte. Nur am Wochenende kam niemand, Besuche sind dann nicht erlaubt. Meine Zellengenossen fragten: „Bist du Präsident, oder was?“ Sie selbst erhielten in den neun Monaten nicht mehr als einen Besuch.
Als ich zuletzt im Gefängnis war, wollten mich so viele Freund*innen besuchen, dass einige nicht mehr reingelassen wurden. Die Gefängnisverwaltung sagte, ich hätte diese Woche bereits drei Besuche gehabt und das reiche. Und selbst als ich weit weg in den Bündner Bergen im Gefängnis Realta war, kamen meine Freund*innen aus Zürich zu Besuch.
Wenn ich in den Strassen von Zürich unterwegs bin, erkennen mich viele Leute und sagen hallo. Meine Freunde aus dem Camp fragen dann immer, wieso ich so berühmt sei. Doch ich bin nicht berühmt, ich bin nur politisch aktiv.
*Name von der Redaktion geändert
Die Reihe “Stimmen aus den Camps“ wird finanziell unterstützt von Migros Engagement („ici. gemeinsam hier“), von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Landis & Gyr Stiftung und von der Stiftung Corymbo.




Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 15 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1040 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 525 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 255 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?