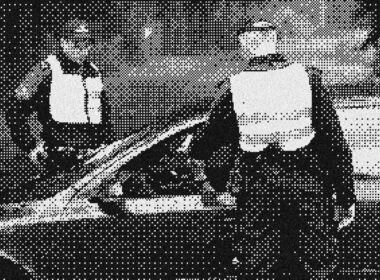Am Anfang der Pandemie applaudierte noch das ganze Land vor lauter Dankbarkeit für die Pflegenden „an der Front” aus ihren Fenstern und von ihren Balkonen. Nun aber sprechen sich Bundesrat und Parlament gegen die von Pflegefachkräften lancierte Volksinitiative „Für eine starke Pflege” (Pflegeinitiative) aus, die am 28. November vors stimmberechtigte Volk kommt. Ihnen ginge die Volksinitiative „zu weit” – vor allem weil diese angemessene Löhne und bessere Arbeitsstrukturen verlangt.
Stattdessen hat das Parlament einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der Teile der Initiative aufnimmt und vor allem die Ausbildung unterstützen will. Auch soll das Pflegepersonal befähigt werden, gewisse Leistungen direkt bei den Krankenkassen abrechnen zu können, ohne den bürokratischen Umweg einer ärztlichen Unterschrift gehen zu müssen. Das wird vonseiten der Pflegenden als wichtiger Schritt verbucht.
Was jedoch aussen vor gelassen wird: die gesetzlich geregelte Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Löhnen. Diese seien zwar wichtig, für deren Umsetzung sollen laut Gegenvorschlag allerdings weiterhin die Kantone, Spitäler und andere Pflegeorganisationen zuständig sein. Mehr Pflegende möchten die Gegner:innen der Initiative also schon – konsequent bessere Entlöhnungen und Strukturen bereitstellen jedoch nicht.
Viel Geld für nichts
Eine gesetzliche Regelung der Löhne und Arbeitsbedingungen in der Pflege finden Bundesrat und Parlament – allen voran die darin vertretenen konservativen Kräfte – zu viel des Guten. Am meisten Bedarf gäbe es bei der Ausbildung der Pflegekräfte, argumentieren die Initiativ-Gegner:innen. Das Geld von einer Milliarde Franken innerhalb der nächsten acht Jahre solle daher Auszubildenden zugutekommen.
„Das ist sehr viel”, betont Gesundheitsminister Alain Berset. Allerdings handelt es sich bei dem Betrag nur um einen Bruchteil des Geldes, das zum Beispiel jährlich ins Schweizer Militär gesteckt wird: In den letzten acht Jahren waren es rund 37,7 Milliarden Schweizer Franken. Die mangelhaften Kampfjets, die sich der Bundesrat für fünf Milliarden kaufen will und deren Unterhalt auf das Fünffache des Kaufpreises geschätzt wird, sind noch nicht mit einberechnet.
Ausserdem nütze es wenig, in die Ausbildung zu investieren, wenn 40 Prozent der Pflegenden aufgrund miserabler Arbeitsbedingungen wieder aus dem Beruf aussteigen, argumentieren Expert:innen. Ein drittel von ihnen ist unter 35 Jahre alt und die Ausbildung noch nicht sehr lange her. Es sind also die Arbeitsumstände, welche die hohe Absprungrate generieren. Aktuell sind über 11’700 Pflegestellen in der Schweiz unbesetzt.
Um das zu verringern, müsste der Bund die Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen und ‑organisationen einheitlich und verbindlich regeln. Dazu gehören zum Beispiel Vorgaben zur Höhe der Löhne. Aber auch familienverträgliche Strukturen müssten gestärkt werden, etwa durch Vorschriften bezüglich der Dienstpläne.
Der Bund möchte diese Aufgabe nicht übernehmen, und Kantone wollen sich wiederum nicht vom Bund in ihre erfolglosen Strategien reinreden lassen. Stattdessen setzen die Initiativ-Gegner:innen, zu denen auch der Krankenkassenverband Santésuisse und der Spitalverband H+ gehören, weiterhin auf die Verantwortung der Arbeitgeber:innen. Ein zweifelhaftes Unterfangen, denn diese haben es bis heute nicht geschafft, den Pflegenotstand zu drosseln.
Weiter argumentieren die Gegner:innen, dass es schneller gehen würde, direkt ein abgeschwächtes Gesetz zu erlassen, statt eine Volksinitiative umsetzen zu müssen. Ein fadenscheiniges Argument, wenn man bedenkt, dass das Parlament auch die Möglichkeit hätte, schnelle, aber wirkungsstarke Massnahmen zu ergreifen, indem es faire Arbeitsbedingungen und faire Löhne verbindlich im Gegenvorschlag inkludiert.
Lieber nicht definitiv
Ausserdem, so Bundesrat und Parlament, sollte die Pflege keine „Sonderstellung” in der Verfassung erhalten. Die medizinische Grundversorgung ist zwar bereits in der Verfassung verankert (übrigens erst seit 2014). Nur reicht diese Erwähnung eben nicht, um die Lebensrealitäten der Arbeiter:innen – und somit der Patient:innen – angemessen zu gestalten. „Ausreichende medizinische Grundversorgung von hoher Qualität” heisst eben auch, dass die Pflegenden nicht konstant am Anschlag sind und es genug Kräfte gibt, die Arbeit zu bewältigen.
Und wieso sollte der Bund Anforderungen zur Berufsausübung sowie Vorschriften zur Aus- und Weiterbildung bestimmen dürfen, jedoch nicht dafür sorgen, dass die Arbeitsverhältnisse angemessen sind?
Der Begriff der „Sonderstellung” illustriert sehr gut, wie der Pflegenotstand in der Schweiz gehandhabt wird: Statt die reale Krise als solche zu behandeln, werden wirkungsvolle Massnahmen als zu krass deklariert oder als Extrawürste bezeichnet. Fast so, als würde eine verbesserte pflegepolitische Situation nur einer vernachlässigbaren Minderheit zugutekommen. Dass solch ein Gegenvorschlag selbst inmitten einer weltweiten Pandemie noch möglich ist, ist ein weiteres Armutszeugnis der parlamentarischen Politik.
In der Einschätzung der Lage sollten wir auf die Pflegenden hören, deren Alltag der anhaltende Notstand ist – und nicht au jene politische Akteur:innen, denen angemessene Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen bereits „zu weit” gehen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 4 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 468 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 140 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 68 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?