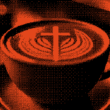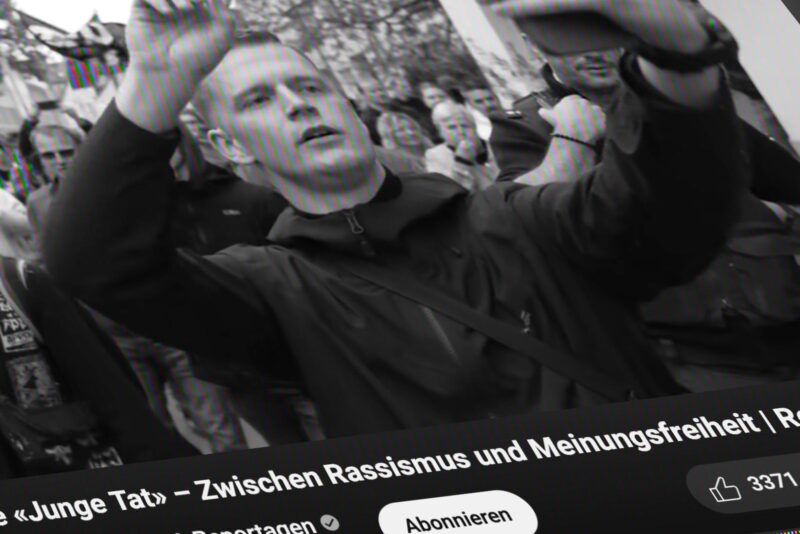Ende März veröffentlichte das SRF eine Dokumentation über die Junge Tat. Das Ziel: Mit den jungen Schweizer Rechtsextremen sprechen, anstatt nur über sie. Mit Kamera im Selfiemodus macht sich der ebenfalls junge Journalist Samuel Konrad ganz in der SRF „rec.”-Manier auf Wanderschaft mit den Neonazis, die bereits wegen Rassendiskriminierung verurteilt wurden.
Das Ergebnis ist ein über 30-minütiger Film, den das rechtsextreme Publikum selbst als brillanten “Werbespot” feiert. Eine halbe Stunde lang reihen sich die selbstinszenierten Social Media-Videos der Neurechten und Interviewsequenzen mit den beiden Anführern der Jungen Tat aneinander. Zwar werden hin und wieder ein paar “Experten” zum Thema befragt, die Gruppierung als offen rassistisch bezeichnet und ihre ethnonationalistische Ideologie erklärt. Viel zu viele Aussagen der Rechtsextremen bleiben aber unwidersprochen.
Beispielsweise, als sie Migrant*innen für die Wohnungsknappheit verantwortlich machen oder genderqueere Personen als krank bezeichnen. Generell ist Konrad den Neonazis im Interviewsetting rhetorisch und argumentativ unterlegen, stellt sich aber dennoch beiden Medientrainierten gleichzeitig. Diese rasseln abwechselnd ihre altbekannten Narrative runter: Die Nazirune in ihrem Logo habe nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, ihre Gewaltverbrechen seien “Jugendsünden” und so weiter.
Mit Nazis spricht man nicht – oder doch?
Alles in allem scheint es so, als sei das SRF der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gewachsen, was in Anbetracht des erstarkenden Rechtsextremismus in ganz Europa um so schwerer wiegt. Das Schweizer Fernsehen behandelt die Rechtsextremen eher wie eine rebellische Jugendgang denn als das, was sie tatsächlich sind: eine brandgefährliche politische Organisation mit völkischer Ideologie, die sich als Teil der Identitären Bewegung versteht. Diese unterhält wiederum Verbindungen zu rassistisch motivierten Massenmördern und sucht ganz gezielt die öffentliche Aufmerksamkeit.
Ist die verantwortungslose Berichterstattung des SRF über Rechtsextremismus nur schlechte Arbeit – oder so gewollt?
Auch die Einschätzung des Medienwissenschaftlers Vinzenz Wyss, der im darauffolgenden Q&A zur Reportage auf die zahlreiche Kritik aus der Community eingehen soll, scheint der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gewachsen: Unaufhörlich deutet er darauf hin, dass man im Journalismus Dinge “nicht totschweigen” dürfe. Man könne an den eigenen Prinzipien trotzdem festhalten, aber auch “einen Schritt aufeinander zugehen” und versuchen “sich zu verstehen”, selbst “ohne Verständnis zu haben”. Ausserdem seien viele Aussagen so einschlägig, dass sie “für sich selbst” stünden. Er verweist auf die rassistische Aussage von Anführer Manuel Corchia, dass Schwarze Personen keinen Platz in der Jungen Tat hätten.
Beim Betrachten beider Videos drängt sich die Frage auf, ob sich auch nur eine der beteiligten Personen in der Produktion spezifisch mit der Berichterstattung über Rechtsextremismus auseinandergesetzt hat, oder ob dies für die Beteiligten einfach ein Thema wie jedes andere ist. Beispielsweise die Handreichungen vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS), das Expertise zu Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus bündelt, gäbe Hinweise darauf, wie man in solchen Fällen verantwortungsbewusst berichten kann: Inszenierung unterbinden, Falschaussagen unmittelbar entkräften und Konsequenzen des Rechtsextremismus in den Fokus rücken – anstatt die Rechtsextremist*innen selbst. Das sind nur einige der Aspekte, die es zu beachten gäbe.
Die SRF-Dokumentation hat in vielen dieser Punkte versagt. War das nur schlechte Arbeit – oder so gewollt?
“Sensible Themen mit grösster Sorgfalt behandeln”
Nicht nur aus der Zuschauerschaft hagelt es Kritik an dem fahrlässig produzierten Werbespot für die Neonazis. Über 200 Medien- und Kulturschaffende wenden sich mit einer Beschwerde an die Ombudsstelle des Schweizer Fernsehens und verlangen, dass das SRF die Reportage aus ihrer Mediathek entfernt und das Versäumnis aufarbeitet. Über zwei Wochen später haben die Kritiker*innen noch immer keine Antwort vom SRF erhalten.
Auf Anfrage von das Lamm zitiert die Medienstelle des SRF die Angebotsverantwortliche Anita Richner. Das SRF stehe hinter der Reportage, würde die Kritik aber “innerhalb der Redaktion diskutieren” und die “internen Standards weiter schärfen” um sicherzustellen, dass “sensible Themen mit grösster Sorgfalt behandelt” würden.
Anita Richner, die seit 1994 in wechselnden Funktionen beim SRF tätig ist, ist die Ehefrau von Markus Somm, Verleger und Chefredaktor des rechten Satiremagazins Nebelspalter. Erst letzten Herbst stand Somm gemeinsam mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel auf der Bühne des Zürcher Kongresshauses und peitschte das Publikum in rassistischem Furor gegen “Muslime, die ihr Unwesen trieben” auf. Die AfD sei “überhaupt nicht rechtsextrem” und Alice Weidel müsse an die Macht, damit das “schwächelnde Deutschland wieder normal” werde, berichtete die WOZ nach dem Event. Wenig später versammelte sich die rechtsextreme Szene in Kloten. Neben Exponenten der Neonazi-Organisation Blood & Honour und einem Mitglied der jungen SVP waren auch die Junge Tat und die AfD vertreten.
Ist das SRF der Konfrontation mit dem erstarkenden Rechtsextremismus gewachsen – und will es ihm überhaupt standhalten?
Zwar lassen sich aus Somms Gesinnung und seinem Verhalten keine direkten Rückschlüsse auf die redaktionelle Arbeit seiner Partnerin ziehen. Die Vorgehensweise bei der Berichterstattung über die Junge Tat lassen jedoch Zweifel an den Fähigkeiten und Absichten des SRF aufkommen.
Erst kürzlich stellte das SRF einige Formate ein, die massgeblich zur Diversität des Programms beitrugen und Inhalte für eine offene, tolerante Gesellschaft boten. Darunter der reichweitenstarke Podcast Zivadiliring, für dessen Absetzung Richner mitverantwortlich war. Angesichts der von der SVP lancierten Halbierungsinitiative, die dem SRF droht, stellt sich die Frage, wohin dieser Kurs und die Angebotsfokussierung führen. Und ob das SRF der Konfrontation mit dem erstarkenden Rechtsextremismus gewachsen ist – oder diesem überhaupt standhalten will.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 5 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 520 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 175 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 85 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?