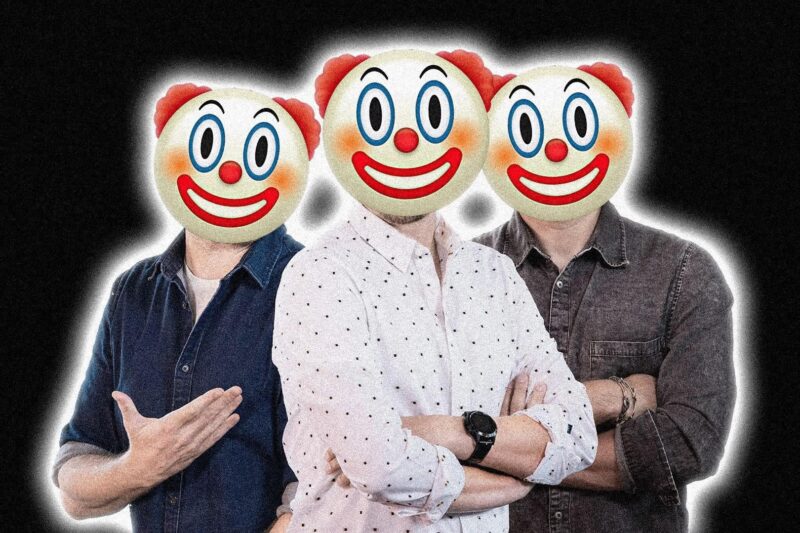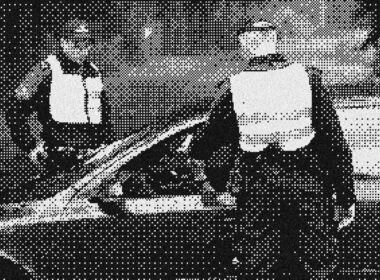Drei Männer sitzen zusammen und witzeln ungehemmt über sexuelle Übergriffe und Frauenfussball. Was wie ein Stammtisch-Gespräch in einer Quartierbeiz klingt, läuft seit Jahren öffentlich im vom SRF produzierten Podcast „Comedymänner”. Gastgeber ist Comedian Stefan Büsser und mit ihm die Co-Hosts Michael Schweizer und Aron Herz. Parallel erhielt Büsser auf SRF seine eigene Late-Night-Show: „Late Night Switzerland” – mit Schweizer als Sidekick und Herz als Headautor.
In einer ihrer Podcastfolgen schildern die Comedymänner eine Szene, in der eine Frau in der Disco in Ohnmacht fällt. Das Trio kommentiert das lachend mit der Bemerkung, jetzt könne „wenigstens Händchen gehalten werden”. Der vermeintliche Witz spielt darauf an, dass sich die Frau nicht wehren kann – und verharmlost damit eine klassische Dynamik sexueller Übergriffe: die Ausnutzung von Wehrlosigkeit.
Witze auf Kosten von marginalisierten Gruppen sind nicht Ausdruck künstlerischer Freiheit, sondern zeugen von reaktionärem Gedankengut.
Während eines anderen Gesprächs scherzen die drei Männer, das Frauen-Fussballstadion „Espenmoos” in St. Gallen müsste doch eigentlich „Espenmöse” heissen. Anstatt sportliche Leistung und Engagement sichtbar zu machen, wird der Fokus auf ein anzügliches Wortspiel gelenkt. Solche Aussagen festigen das Bild, dass Frauen im Sport nicht ernst zu nehmen seien – weder auf dem Feld noch in der Öffentlichkeit.
Diese gefährlichen Pointen stossen auch seit geraumer Zeit auf Kritik beim Publikum. Spätestens seit ein Instagram-Account namens @uncover_comedymaenner diverse problematische Szenen öffentlich gemacht hat, steht zur Debatte, wie unbedenklich dieser Humor wirklich ist – und welche Verantwortung ein öffentlich-rechtlicher Sender dafür trägt.
Humor schafft Realität
Was Büsser und Co. rauslassen, sind nicht „nur Witze”. Humor wirkt – gerade, wenn er medial verbreitet wird. Wenn wöchentlich populäre Podcaster über Ohnmacht, Gewalt oder Minderheiten lachen, hat das Konsequenzen. Auch wenn es „nicht böse gemeint” ist. Diese Art des Humors bagatellisiert Gewalt, verfestigt Vorurteile und normalisiert Diskriminierung unter dem Deckmantel der Satire.
Öffentlich-rechtliche Medien haben einen Auftrag: informieren, bilden, unterhalten – aber nicht auf Kosten der Würde anderer. Der Podcast wurde zwar zwischenzeitlich privat produziert, kehrte aber zu SRF zurück. Auch die Comedians blieben fest mit dem Sender verbunden. Stefan Büsser wurde zum Gesicht der SRF-Late-Night-Unterhaltung gemacht, ein Format zur besten Sendezeit.
Hat das SRF die Kritik überhört oder bewusst weggeschaut, um Büssers Popularität bei jüngeren Zuschauer*innen nicht zu gefährden?
Satire darf vieles. Sie ist Mittel, um an Ereignissen und Personen Kritik zu üben, sie der Lächerlichkeit preiszugeben und Zustände anzuprangern. Wer dabei nach unten tritt, ist armselig – und hat die Schwächeren auf dem Gewissen.
Die zentrale Frage ist nicht, ob Comedy das darf. Sondern: Warum will SRF das senden?
Witze auf Kosten von Frauen, migrantischen Menschen oder anderen marginalisierten Gruppen sind nicht Ausdruck künstlerischer Freiheit, sondern zeugen von reaktionärem Gedankengut. Dass genau diese „Gags” öffentlich gesendet – und mit Gebühren finanziert – werden, macht das ganze umso bedenklicher.
Natürlich soll Humor frei sein – aber nicht frei von Kritik und Verantwortung. Keine*r verlangt Zensur. Ein öffentlich-rechtlicher Sender sollte sich aber fragen: Was wollen wir zeigen? Wen wollen wir erreichen? Und umgekehrt: Wer wird ausgeschlossen oder herabgewürdigt? Keine*r verbietet Büsser und Co. ihre Sprüche im privaten Raum. Doch wenn solche Inhalte öffentlich ausgestrahlt werden – in einem Land, das gerne von Vielfalt spricht, sie aber längst nicht für alle lebt – dann ist vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen mehr zu erwarten als ein „Ist halt Satire” wie die SRG-Ombudsstelle 2019 sinngemäss äusserte.
Die zentrale Frage ist nicht, ob Comedy das darf. Sondern: Warum will SRF das senden?
Verantwortung übernehmen
Die fehlende Verantwortung zeigte sich zuletzt eindrücklich am Fall Vera Çelik: In der SRF-Late-Night-Show wurde die 19-jährige Zürcher SP-Politikerin und Muslima mit dem rechtsextremen JSVP-Politiker Nils Fiechter verglichen – unter Verweis auf ein altes Bild, das Fiechter in einer Burka mit Bombengürtel zeigt. Die Pointe: Es sei nicht zu erkennen, ob Vera oder Fiechter abgebildet sei. Diese Gleichsetzung – eine junge muslimische Frau wird optisch mit einem Rechtsextremen in Terrorverkleidung auf eine Stufe gestellt – ist kein satirisches Missverständnis, sondern eine gefährliche Chiffre. Sie spielt mit dem jahrzehntealten Klischee, muslimische Kleidung habe etwas mit Gewalt zu tun.
Es ist gefährlich, Witze als „harmlosen Spass” abzutun – sie sind Teil eines Klimas, das reale Konsequenzen hat. Für Vera Çelik zum Beispiel waren es Morddrohungen.
Das ist nicht nur geschmacklos, sondern wirkt real: Vera Çelik wurde danach mit Hassnachrichten und Morddrohungen überflutet. Ihre öffentliche Kritik an der Pointe quittierte Büsser mit einer Nicht-Entschuldigung: „Es tut mir leid, dass du dich verletzt fühlst.” Statt klar zu sagen: „Das war ein Fehler. Ich mach’s besser.” kam relativierendes Framing. Er warf Vera vor, öffentlich statt persönlich kommuniziert zu haben – obwohl er selbst sie vor der Ausstrahlung weder informiert noch kontaktiert hatte. Zudem beklagte er, dass durch ihren Protest ein „Shitstorm” ausgelöst worden sei. Ein klassisches Beispiel für Victim Blaming, wie es der Satiriker Renato Kaiser treffend analysierte. Nicht Vera Çeliks Reaktion verursachte die Eskalation, sondern die Entscheidung, sie überhaupt in dieser Form zur Zielscheibe eines Witzes zu machen. Auch hier bleibt der Eindruck: Die Pointe ging auf Kosten der Betroffenen – und SRF gab ihr eine Bühne.
Nun liegt der Ball mal wieder beim SRF. Über 478 Beanstandungen gingen bei der Ombudsstelle der SRG ein.
Von wegen auf Augenhöhe
Stefan Büsser und seine Kollegen täten gut daran, die Kritik nicht als Angriff zu begreifen, sondern als Einladung zur Weiterentwicklung. Verantwortung zu übernehmen. Sich zu reflektieren, statt sich zu verteidigen. Fehler einzugestehen, anstatt sie auf andere – weniger privilegierte – abzuwälzen.
Gerade im Fall Vera Çelik wird deutlich, wie absurd das häufig eingeforderte „Gespräch auf Augenhöhe” ist: Eine 19-jährige Politikerin mit rund 1’900 Instagram-Follower*innen kritisiert einen etablierten Comedian mit über 100’000 Follower*innen und einem reichweitenstarken SRF-Comedyformat im Rücken – und wird danach medial für ihre Tonlage zur Rechenschaft gezogen. Wer hier die grössere Bühne, die besseren Verbindungen und den direkteren Zugang zur Öffentlichkeit hat, ist offensichtlich.
Während Çelik Drohungen erhält, bekommt Büsser öffentliche Rückendeckung, etwa vom schulterklopfenden Comedy-Vater Viktor Giacobbo, von Nationalrätin Meret Schneider oder Moderatorin Christa Rigozzi. Wenn sich in solchen Konstellationen der Mächtigere in die Opferrolle zurückzieht, wird Kritik systematisch entwertet.
Wer lacht, hört hin
Denn: Diskriminierung beginnt nicht erst bei physischer Gewalt. Sie beginnt viel früher – mit Worten, Bildern, vermeintlichem Humor. Wer immer wieder die gleichen Gruppen verspottet, zementiert gesellschaftliche Machtverhältnisse. Auf der sogenannten Gewaltpyramide stehen diskriminierende Witze ganz unten – aber sie bilden die Grundlage für die nächste Stufe: Abwertung, Ausgrenzung, offene Anfeindung. Und im schlimmsten Fall bilden sie die Basis für Gewalt. Deshalb ist es gefährlich, Witze als „harmlosen Spass” abzutun – sie sind Teil eines Klimas, das reale Konsequenzen hat. Für Vera Çelik zum Beispiel waren es Morddrohungen. Für andere ist es Angst, Scham oder das Gefühl, nicht dazuzugehören.
Komiker*innen wie Lisa Christ oder Reena Krishnaraja zeigen längst, dass Humor auch ohne Tritte nach unten funktioniert – klug, relevant und auf Augenhöhe. Es geht nicht darum, Comedy einzuschränken. Es geht darum, sie ernst zu nehmen. Denn wer lacht, hört hin. Und wer gehört wird, trägt Verantwortung.
SRF sollte hier nicht hinterherlaufen, sondern vorangehen. Als Sender mit öffentlichem Auftrag. Als Plattform, die Vielfalt abbildet. Und als Instanz, die weiss: Guter Humor braucht Haltung.
Öffentlicher Humor braucht öffentliche Verantwortung – damit wirklich alle lachen können.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 16 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1092 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 560 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 272 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?