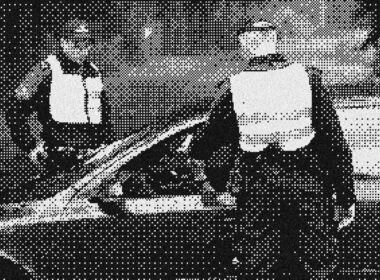Freitag, Acht Uhr Neunundfünfzig, im IC5 von Olten nach Zürich. Eine ältere Frau, mit Maske, fragt den freundlichen Zugbegleiter, auch mit Maske, ob er sich jetzt über die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr freue, weil ja alle so egoistisch seien und niemand eigenverantwortlich Masken tragen würde. Sie fragt ein bisschen zu laut, gerade so, dass es auch die anderen Passagier*innen, die meisten ohne Masken, hören. Der Zugbegleiter reagiert souverän und meint lächelnd: “Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht fällen muss.”
Da ist er in guter Gesellschaft. Die Diskussionen über Sinn und Unsinn von Masken als Mittel gegen die Ausbreitung der COVID-19 Pandemie offenbart eine schockierende Entscheidungsscheue aller politischen Akteure. Der Bund foutierte sich um eine klare Kommunikation zur Wirksamkeit von Masken und stiftete Verwirrung, die wohl bis heute in den Köpfen nachhallt. Und die Kantone, nach dem der Bund ihnen die Verantwortung zurückgeben hatte, wollen wiederum vom sonst so sakrosankten Föderalismus nichts wissen. Ein unwürdiger Reigen, der mit dem Entscheid des Bundesrats zur allgemeinen Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr endlich ein Ende fand.
Ein Stück weit ist die allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr Symbolpolitik: Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung bei Fernverkehrszügen liegt bei rund 30 Prozent. Wirklich überfüllt sind die Züge nur zu Stosszeiten. Wer um 23.00 Uhr von Bern nach Fribourg fährt und eine Maske trägt, leistet kaum einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit. Zudem gibt es keine belastbare Zahlen, die belegen, wie viele Menschen sich in der Schweiz tatsächlich im ÖV mit COVID-19 angesteckt haben.
Dass das Maskentragen im öffentlichen Verkehr aber durchaus sinnvoll ist, sollte eigentlich unbestritten sein: Denn gerade während den Stosszeiten ist der Sicherheitsabstand unmöglich einhaltbar, was Menschen der Risikogruppe einem potentiell tödlichen Virus aussetzt. Ein Minimum der vielbeschworenen Solidarität kann man im 100-Pack kaufen. Damit sie allerdings für alle erschwinglich ist, müssen die Kantone die Kosten für Armutsbetroffene übernehmen, was etwa der Kanton Jura bereits tut.
Aber Masken sind nicht die einzige Schutzmassnahme – und auch nicht die wirksamste. Am wichtigsten bleibt der Abstand, und dafür braucht es Platz. Es ist bezeichnend, dass ein Land, dessen grösste Partei das unverschleierte Gesicht in der Verfassung festschreiben will, sich zuerst hinter stickigen Stofffetzen verhüllt, bevor es sich mehr Raum in den Zügen erkämpft. Denn eigentlich würden die SBB noch über viel zusätzlichen Raum verfügen: Rund 20 Prozent ihrer Sitzkapazität entfällt auf die erste Klasse – deren Auslastung sie nicht öffentlich bekannt geben.
Nun war es schon immer eine Sauerei, dass die SBB als öffentlich-rechtliches Unternehmen ihre Passagier*innen in zwei Klassen einteilen. Staatliche Leistungen wie der öffentliche Verkehr sollten sozioökonomische Unterschiede ausmerzen, nicht reproduzieren. Die SBB erreichen mit ihrer Preispolitik das Gegenteil, wie sie zuletzt mit der Abschaffung des Stundent*innen-GAs wieder einmal gezeigt haben.
Dass während der Corona-Pandemie zwar die Maskenpflicht, die Öffnung der 1. Klasse aber nur am Rande diskutiert wurde, zeigt, wie verinnerlicht diese Materialisierung der Klassengesellschaft ist. Gutverdienende ziehen sich während den Stosszeiten in ihre privilegierten Räume zurück, mit bequemeren Sitzen, mehr Beinfreiheit und weniger Ansteckungsrisiko, während die Zugbegleiter*innen in den Gängen der zweiten Klasse über die Passagier*innen steigen müssen.
Als JUSO-Präsidentin Ronja Jansen anfangs Mai forderte, die erste Klasse während der Pandemie auch für die Passagier*innen der zweiten Klasse freizugeben, sprach sich sogar die Präsidentin des Fahrgastverbands Pro Bahn gegen den Vorschlag aus. Weil damit eine Abwertung der ersten Klasse einhergehen würde. Darüber, dass diese „Abwertung” für den überwiegenden Teil der von ihr vertretenen Passagier*innen eine Aufwertung bedeuten würde, sah sie indes grosszügig hinweg.
Dieser Klassendünkel im ÖV ist nicht neu: In einer fast schon dadaistisch anmutenden Antwort auf einen Vorstoss zum Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) erklärte der Zürcher Regierungsrat 2011, dass eine klassenlose Bahn der breiten Akzeptanz kaum zuträglich wäre, weil der öffentliche Verkehr bereits alle sozialen Schichten anspreche: “Würde die erste Klasse abgeschafft, ist das ganze System in Gefahr.” Na dann.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 11 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 832 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 385 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 187 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?