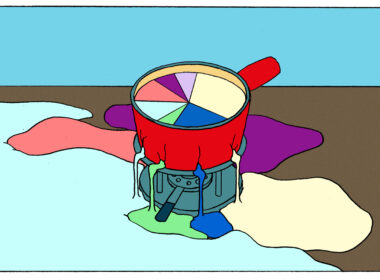Am 15. April 2023 griffen die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) im dicht besiedelten Zentrum der sudanesischen Hauptstadt Khartum verschiedene Regierungsgebäude und zivile Bauten an – es waren die ersten Schüsse in einem Konflikt, der zunehmend zum allumfassenden Bürgerkrieg eskaliert. Dieser dreht sich im Kern um zwei Männer, die bis vor kurzem Weggefährten waren und jetzt in ihrem erbitterten Machtstreben eine Nation ins Chaos stürzen: Militär-General Abdelfatah Burhan und Mohammed Hamdan „Hameti” Daglo, Führer der RSF.
Die RSF wurden 2013 unter Langzeitherrscher Umar al-Baschir gegründet, um verschiedene Rebellengruppen im Sudan und insbesondere die Proteste in Darfur zu bekämpfen. Gemäss Human Rights Watch soll sie dabei „wiederholt Dörfer angegriffen, Häuser niedergebrannt und geplündert, Dorfbewohner geschlagen, vergewaltigt und hingerichtet” haben. Die RSF sollte aber auch als eine Parallelstruktur zur starken sudanesischen Armee dienen, um al-Baschir vor einem Militärputsch zu schützen.
Doch was nicht sein sollte, traf ein: 2019 stürzte eine Revolution, bestehend aus linken Parteien, Gewerkschaften und der sudanesischen Zivilgesellschaft, al-Baschir nach über 30 Jahren an der Macht. Danach übernahm mit der politischen Unterstützung westlicher Regierungen eine Gruppe von Generälen unter Führung von Abdel Fatah al-Burhan zusammen mit zivilen Parteien die Macht im Land. Weil die Generäle aber die Macht nicht teilen wollten, putschten sie die Zivilist*innen im Oktober 2021 mit der Hilfe der RSF aus der Übergangsregierung.
Seither haben es Burhan und Hameti nicht geschafft, die Macht zu konsolidieren. Der Konflikt entzündete sich an der Frage, in welchem Zeitraum die paramilitärische RSF in die ordentliche Armee eingegliedert werden sollte: Militärchef Burhan wollte der RSF zwei Jahre dafür einräumen, Hameti pochte auf zehn Jahre. Dies nicht zuletzt, weil beide Gruppen – das Militär und die RSF – grosse Teile der sudanesischen Volkswirtschaft besitzen: Krankenhäuser, Immobilien, Grundstücke, Goldminen, Bauunternehmen, sogar ganze Industrien. Hameti, den al-Baschir einst als einfachen Hirten rekrutierte, ist heute einer der reichsten Männer des Sudans.
Nach bald vier Monaten ist der Krieg grösstenteils aus den internationalen Schlagzeilen verschwunden. Die Lage ist indes eskaliert: Seit dem Ausbruch des Konflikts vor über 100 Tagen sind laut dem UN-Hilfswerk für Geflüchtete UNHCR mehr als 3.3 Millionen Menschen vertrieben worden.
Einer, der den Konflikt in seiner Heimat tagtäglich aus der Ferne mitverfolgt, ist Madeni Hamdeen. Früher war er in Darfur politisch aktiv, eine der am meisten umkämpften Regionen des Sudans. Hamdeen floh vor über zehn Jahren aus politischen Gründen und arbeitet heute als selbstständiger Taxifahrer in der Schweiz.
Zusammen mit seiner Frau, Simone Michel Hamdeen, und seiner Tochter lebt Madeni Hamdeen in einer gemütlichen Genossenschaftswohnung in Uster. Die Küche ist rustikal, auf der Herdplatte köchelt eine grosse Bialetti vor sich hin, während Madeni Hamdeen mit leiser Stimme erzählt, wie er den Konflikt von Uster aus erlebt. Ein Teil seiner Familie steckt derweil in der Hauptstadt zwischen den Fronten fest.
Das Lamm: Madeni Hamdeen, waren Sie überrascht, als am 15. April der Konflikt im Sudan ausbrach?
Madeni Hamdeen: Ja, es hat mich sehr überrascht. Als ich 2019 das letzte Mal im Sudan war, spürte ich überall Aufbruchstimmung. Die Leute waren hoffnungsvoll, hegten den Glauben an eine liberalere Gesellschaft. Eigentlich wollte ich meine Familie am 21. April wieder besuchen, der Flug war längst gebucht. Daraus wurde mit dem Ausbruch der Kämpfe nichts.
Mit der Aufbruchstimmung sprechen Sie die Zeit nach dem Sturz von Umar al-Baschir an.
Genau. Aber al-Baschir war so lange an der Macht, dass alle Netzwerke und alle Beziehungen über ihn liefen. Als er dann von den Massenprotesten gestürzt wurde und die zivilen Parteien zusammen mit den Generälen die Übergangsregierung übernahmen, hatten sie keine Ahnung, wie man einen Staat führt. Und ihnen fehlten die notwendigen Beziehungen: Viele der Parteien waren im Sudan gar nicht vernetzt, die Parteichefs sassen im Ausland. Die meisten Sudanes*innen kannten diese Leute nicht, also hatte die Übergangsregierung auch nie wirklich Unterstützung aus der Bevölkerung.

Im Oktober 2021 putschten das Militär zusammen mit Hametis RSF die Übergangsregierung. Doch dann brach ein Konflikt im Sicherheitsapparat aus: Die RSF-Truppen sollten in das Militär eingegliedert werden, Hameti und Militär-General Burhan konnten sich aber nicht auf einen Terminplan einigen. In den Wochen und Monaten vor dem 15. April hat sich die RSF dann immer mehr der Hauptstadt genähert und Söldner aus den ländlichen Gebieten zusammengezogen. Es lag Spannung in der Luft.
Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass sich diese Spannung in einem bewaffneten Konflikt in der Hauptstadt entlädt. Seit der Unabhängigkeit des Sudans 1956 hatte es nie einen Krieg zwischen zwei Armeen gegeben. Es gab immer Konflikte zwischen Rebellen und der Regierung, aber eine Situation wie jetzt ist eine neue Eskalationsstufe. Das Militär hat den Fehler gemacht, dass sich die RSF in den zwei Jahren nach dem Putsch immer mehr Macht sichern konnte.
„Für meinen älteren Bruder und für meinen Schwager ist die Situation weiterhin gefährlich.”
Der Konflikt dauert jetzt schon über 100 Tage. Wie geht es Ihrer Familie vor Ort?
Glücklicherweise ist meine Familie bisher verschont geblieben. Aber an den ersten Tagen war die Situation brandgefährlich: Als der Konflikt ausbrach, war meine Familie in unseren Häusern am Rand von Khartum. Zu Beginn haben sich die Kämpfe auf das Stadtzentrum konzentriert. Aber mit der Zeit haben sie sich immer weiter an die Stadtränder ausgedehnt. Da wussten wir: Wir müssen schnell handeln. Meine kleine Schwester war im achten Monat schwanger. Ich habe zusammen mit meiner Familie vor Ort dafür gesorgt, dass die Frauen und Kinder aus Khartum evakuiert wurden. Meine zwei Brüder und mein Schwager sind aber immer noch dort.
Und wie geht es den dreien?
Für meinen älteren Bruder und für meinen Schwager ist die Situation weiterhin gefährlich. Mein Bruder ist ein guter Fahrer, mein Schwager Automechaniker. Beide laufen Gefahr, dass die Paramilitärs der RSF sie zwingt, für sie zu arbeiten. Dazu muss man wissen: Die RSF besteht grösstenteils aus jungen Kämpfern vom Land, die auf den Lohn angewiesen sind, den die RSF zahlt. Viele können noch nicht einmal Auto fahren. Der einzige Vorteil für meinen Bruder und meinen Schwager ist, dass sie nicht mehr so jung sind. Aber wenn die RSF herausfindet, wie gut sie fahren können, dann wird es düster.
Könnten Sie nicht auch dem Rest der Familie folgen?
Nein, sie wollen die Häuser nicht verlassen, weil sie Angst haben, dass diese geplündert werden. Ausserdem ist es sehr schwierig, die von der RSF besetzten Gebiete zu verlassen: In der Nähe des Hauses von meinem Bruder steht ein Stützpunkt der Paramilitärs. Sie kontrollieren also die Strassen und lassen niemanden raus. Gleichzeitig ist das Leben in der Nähe des Stützpunkts auch deswegen gefährlich, weil das Militär diesen bombardiert.
Inzwischen hat der Konflikt auch die Region Darfur erreicht, also die Region, wo der ehemalige Diktator Umar al-Baschir 2003 den ersten Genozid des 21. Jahrhunderts vollzog.
Ich komme ursprünglich aus dieser Region. Zwei Schwestern von mir leben noch immer in der Regionalhauptstadt Al-Faschir. Inzwischen ist wieder ein wenig Ruhe eingekehrt, aber die RSF hat dort noch im Juni ein Massaker angerichtet (Anm. d. Red.: nahe der Stadt Al-Dschunaina in West-Darfur wurde im Juli ein Massengrab mit rund 90 Zivilist*innen gefunden). Der Obergeneral der RSF, Hameti, bestreitet zwar, dass seine Paramilitärs dahinterstecken. Gleichzeitig haben sie aber den Gouverneur der Region Westdarfour Khamis Abdullah Abakr entführt und hingerichtet, nachdem dieser die RSF öffentlich kritisiert hatte.
Es ist nicht das erste Mal, dass Hameti in Darfur morden lässt. Anfang der 2000er-Jahre stützte sich der damalige Diktator Umar al-Baschir auf die Vorläuferorganisation der RSF, die Dschandschawid-Milizen, um Rebellen in Darfur niederzuschlagen.
Genau. Ich war damals Teil des Justice and Equality Movement, kurz: JEM (Anm. d. Red.: Eine bewaffnete Oppositionsgruppe aus der Region Darfur, die kurz nach dem Sturz von Diktator Umar al-Baschir einen Friedensvertrag mit der Übergangsregion abgeschlossen haben). Wir haben uns damals zusammen mit der Sudan Liberation Army in Darfur gegen die Zentralregierung von Umar al-Baschir gestellt. Politisches Engagement war natürlich illegal, trotzdem veröffentlichte ich als Student einige politische Schriften im Internet. Dafür wurde ich dann verhaftet, konnte mich aber freikaufen und musste den Sudan verlassen.
Wie positionieren sich die Leute heute, mit denen Sie damals politisch aktiv waren?
In der Bevölkerung unterstützen über 90 Prozent das Militär, wie ich auch. Sie schlachten ihre Tiere als Unterstützung, geben ihre Autos oder spenden Geld. Für die Paramilitärs tut das niemand. Anders meine ehemaligen politischen Weggefährten: Sie geben sich in der Öffentlichkeit neutral. Sie wollen nicht öffentlich zugeben, dass sie heute die Paramilitärs unterstützen.
Wie erklären Sie sich, dass sie heute auf einer anderen Seite stehen als ihre damaligen politischen Weggefährten?
Für sie ist es die einzige Chance, an die Macht zu kommen. Sie waren die Profiteure des Sturzes von al-Baschir und waren dann für kurze Zeit Teil der zivilen Übergangsregierung. Sie haben eine Abmachung mit Hameti getroffen, dass sie wieder an die Macht zurückkehren können, wenn er als Gewinner aus dem Konflikt hervorgeht.
„Afrika ist nicht interessant für die Schweiz, wenn es nicht gerade um Erdöl oder andere Rohstoffe geht.”
Wie informieren Sie sich über den Konflikt? Die Gemengelage ist äusserst schwierig zu durchschauen.
Ich telefoniere regelmässig mit meinen Geschwistern. Dann haben sowohl das Militär als auch die Paramilitärs der RSF jeweils Facebook-Seiten. Und es gibt noch den Fernsehsender Al-Jazeera, aber der ist klar auf der Seite der Paramilitärs. Al-Jazeera wird bekanntlich von den Arabischen Emiraten finanziert, die seit jeher engen Verbindungen mit den Paramilitärs pflegen.
Bei uns ist der Konflikt grösstenteils aus den Schlagzeilen verschwunden. Was löst das in Ihnen aus und was bedeutet das für die Menschen vor Ort?
Es macht mich traurig, gerade auch, weil in meinem Heimatland so viele schlimme Dinge passieren. Wenn man nicht darüber berichtet, dann geht die Bevölkerung vor Ort vergessen. Es ist ein krasser Unterschied zum Krieg in der Ukraine, wo ich jeden Morgen darüber informiert werde, was in der Nacht zuvor passiert war. Afrika ist nicht interessant für die Schweiz, wenn es nicht gerade um Erdöl oder andere Rohstoffe geht.
Haben Sie Hoffnung für die Zukunft des Sudans?
Es geht letztendlich einfach darum, so lange auszuharren, bis die Paramilitärs der RSF keine Munition mehr haben. Die Armee hat es geschafft, dass sie keine materielle Unterstützung von ausserhalb des Sudans erhalten. Aber ich weiss nicht, wie lang es geht, bis ihnen die Munition ausgeht. Es könnte Monate dauern, es könnte Jahre dauern.
Und wenn es vorbei ist?
Zuerst einmal muss das Grundproblem gelöst werden: Es darf nur noch eine Armee geben, ohne eine paramilitärische Parallelstruktur. Danach – so hat es das Militär versprochen – soll es wieder demokratische Wahlen geben. Der Konflikt ist just ausgebrochen, als viele Leute Hoffnung hatten, dass sich ihre Situation endlich verbessern könnte. Die Wirtschaftslage ist heute noch schlechter, als sie es vorher schon war. Aber die Hoffnung bleibt.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 8 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 676 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 280 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 136 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?