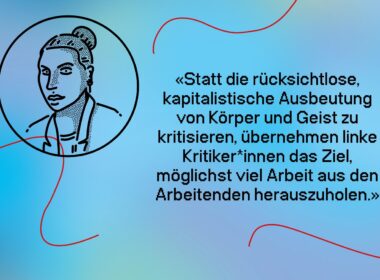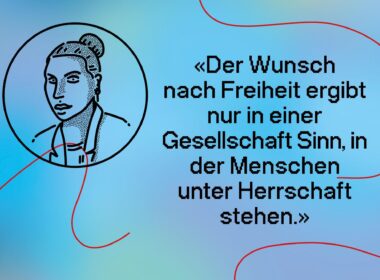Neulich nach einer meiner Lesungen: Der Applaus ist gerade verhallt, als zwei Personen aus dem Publikum zu mir nach vorne kommen. Beide sehen ein bisschen mitgenommen aus.
Der erste, Anfang fünfzig, steht von dem Inhalt meines Buches unter einer Art körperlichem Schock. Er atmet viel, seine Augen schimmern feucht. Er ist einer jener Menschen, die ihren Respekt dafür ausdrücken, die eigene Armutsgeschichte zu Papier zu bringen. Im selben Atemzug sagt er, wonach ich nicht gefragt hatte: „Aber ich könnte das nicht“.
Scham und Klasse – sind das wirklich zwei Seiten derselben Medaille? Ich habe meine Zweifel.
Zweimal hatte er, selbst aus einer armen Familie kommend, auf seiner Arbeit über seine soziale Herkunft gesprochen. In beiden Fällen sei er später dafür abgewertet und beschämt worden. Dass er gegenüber seinen Klienten laut wurde, war von Kolleg*innen und Vorgesetzten als Kontrollverlust verstanden worden, als Ausdruck seiner Unterklassesozialisation, sagt er.
„David gegen Goliath” ist hier Programm. Olivier David
gegen die Goliaths dieser Welt. Anstatt nach unten wird nach oben getreten. Es geht um die Lage und den Facettenreichtum der unteren Klasse. Die Kolumne dient als Ort, um Aspekte der Armut, Prekarität und Gegenkultur zu reflektieren, zu besprechen, einzuordnen. „David gegen Goliath” ist der Versuch eines Schreibens mit Klassenstandpunkt, damit aus der Klasse an sich eine Klasse für sich wird. Die Kolumne erscheint ebenfalls als Newsletter.
Er habe sich so geschämt, dass er seine Klassenherkunft seither eisern verschwieg. Bis zu diesem Moment, als 15 Jahre später ein Autor um die Ecke kam, ich, und ihn mit einem Leben konfrontierte, das er glaubte, hinter sich gelassen zu haben. Während wir sprechen, ringt der Mann um seine Fassung, so sehr fühlt er sich in meinen Ausführungen beschrieben. Ähnlich aufgewühlt wiederholt sich dieses Gespräch beinahe identisch mit der Streetworkerin, mit der ich danach ins Gespräch komme. Das verbindende Element beider Gefühlsausbrüche an diesem Abend ist die Scham.
Scham und Klasse: Zwei Seiten derselben Medaille?
Wenn über Klasse gesprochen oder geschrieben wird, dann ist die Scham nicht weit. Jene fundamentale Kränkung, die in beinahe jeder Erzählung über Klasse (ich nehme mich da nicht raus) durchschimmert. Ob bei Annie Ernaux, Édouard Louis oder Didier Eribon, oder im deutschsprachigen Raum bei Christian Baron, Deniz Ohde oder Daniela Dröscher, es scheint, als sei die Scham der ständige Begleiter jedweder Klassenerzählung.
Scham und Klasse – sind das wirklich zwei Seiten derselben Medaille? Ich habe meine Zweifel.
Olivier David, 34, ist Autor und Journalist. 2022 erschien sein Debüt „Keine Aufstiegsgeschichte”, in dem er über den Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und Armut schreibt. Für das ND (vormals neues deutschland) schreibt er die Kolumne „Klassentreffen”. Olivier wohnt in Hannover und studiert in Hildesheim literarisches Schreiben.
Für die meisten Werke der aufgezählten Autor*innen, die unter dem Label der Klassenliteratur verhandelt werden, wäre der Ausdruck der Aufstiegsliteratur passender. Es wird entweder der beschwerliche Weg aus der unteren Klasse heraus beschrieben oder es werden mit einigem Abstand mittels eines literarisch-ethnologischen Blicks die Bedingungen und sozialen Kosten des Aufstiegs aus der Perspektive des Transclasse beleuchtet – jenen, die Aufsteigen, aber irgendwo zwischen Herkunftsklasse und Ankunftsklasse stecken bleiben und sich fortan in beiden Klassen fremd fühlen.
In beiden Fällen ist der Protagonist oder die Protagonistin in Bewegung: auf dem Weg nach oben – oder er ist schon oben und blickt zurück. Gerade weil er sich bewegt, spürt er seine Fesseln. Emporkömmlinge, das sind die Beschämten, da ihre Erfahrungen angesichts des sozialen und kulturellen Wissens einer höheren Klasse abgewertet werden.
Gerade weil er sich bewegt, spürt er seine Fesseln.
In der Folge lernen viele, mit dem Blick der Mittel- und Oberklasse auf ihr Herkunftsmilieu zu schauen und werten die ehemals eigene Lebensweise und die der Eltern ab. Das Schreiben dient als Versuch, die durch den Aufstieg verursachten kulturellen Sollbruchstellen zu kitten und einen Umgang mit den Eltern und dem Herkunftsmilieu zu finden – ohne dabei die Herkunft abzuwerten. Wurde da schon für die eigene Herkunftsklasse geschrieben? – oder wird nur der Vorgang reflektiert, wie man es schafft, das ehemalige Milieu nicht mehr abzuwerten?
Individuelle Scham versus institutionelle Scham
Das sind spezifische Fragestellungen, die Aufsteiger*innen beschäftigen. Für die Leben vieler Menschen in der unteren Klasse spielt Scham eine geringere Rolle. Die soziale Durchmischung nimmt ab, explodierende Mieten drängen Familien mit kleinem Einkommen aus den Stadtzentren hinaus. Ihre Kinder gehen immer seltener in dieselben Schulen wie Kindern aus gut verdienenden Familien.
Dort, wo Menschen aus der unteren Klasse tägliche Kontakte in andere soziale Milieus und Klassen haben, dort werden sie institutionell beschämt.
Daher bleibt die Frage: Wenn die Leute in einem Armutsviertel nicht strukturell mit den Menschen einer höheren Klasse in Berührung kommen, wer soll dann beschämt werden? Wer wird beschämt in den Banlieues und Vororten, in denen alle ähnliche Erfahrung über Mangelverwaltung und Prekarität teilen und sich Kontakte in andere Milieus und Klassen nicht einstellen?
Viele Schreibende, die vorgeben, soziale Ungleichheit in den Blick zu nehmen, tun das oftmals genau dort, wo sie selbst einen Nutzen haben: an der Frontlinie der eigenen Aufstiegserzählung. Daran ist erst mal nichts falsch. Falsch wird es, wenn die Reflexion des eigenen Aufstiegs im Namen sozialer Gerechtigkeit geführt wird. Denn nicht oft genug wird dabei die Gerechtigkeit aller in den Blick genommen.
Ja, manchmal sind solche Erzählungen auch selbstgerecht. Zum Beispiel, wenn Autor*innen vorgeben, Politisches für alle im Sinn zu haben, wo vor allem die eigene Statusverbesserung im Fokus steht. Ein Beispiel: Die Formulierung „Arbeiter*innenkinder“. Fein säuberlich unterscheidet sie zwischen Aufsteiger*innen, die an der Universität oder im Berufsleben aufgrund ihrer sozialen Herkunft beschämt werden, und deren Eltern und dem originären Umfeld. Es geht hierbei um Chancengerechtigkeit für die eigene Bubble, es geht um Antidiskriminierung und daran ist nichts falsch. Aber es geht nicht um soziale Gerechtigkeit für alle.
Scham als Wachstums- oder Reibungsschmerz. Ich möchte den Begriff der institutionellen Scham vorschlagen. Dort, wo Menschen aus der unteren Klasse tägliche Kontakte in andere soziale Milieus und Klassen haben, dort werden sie institutionell beschämt. Tag für Tag. Ich kenne das seit meiner Einschulung als Junge aus einer armen Familie auf einer Waldorfschule. Von meinem siebten Lebensjahr an war ich von Kindern umgeben, deren Eltern zum Teil Haus- oder Villenbesitzer*innen waren.
Andere Kinder aus meinem Wohnhaus, in dem es viele Sozialwohnungen gab, hatten diese Kontakte nicht. Haben sie sich deshalb nie schämen müssen? Natürlich nicht. Klar: Als armer Mensch kommt man an der Scham nicht vorbei. Ich denke da an 3,7 Millionen Menschen, die in Deutschland Grundsicherung beziehen (in der Schweiz sind es 89.000 Tausend), die beim Jobcenter entwürdigenden Praktiken ausgesetzt sind. Der viel grössere Teil der Armen bezieht allerdings keine Leistungen vom Amt.
Überall Scham, nirgendwo Gerechtigkeit
Einerseits stimmt es, was Dirck Linck in seinem Aufsatz, „Die Politisierung der Scham“ schreibt. „Das Maß, in dem Menschen zur Scham neigen, hängt gewiss von ihren individuellen Erfahrungen mit Beschämung ab – doch niemand ist unansprechbar, weil niemand unbeschämt bleibt in dieser Gesellschaft.“
Jedoch bleibt die Frage, wie individuell Erfahrungen in einer Klassengesellschaft sein können. Institutionelle Scham ist ein Reibungs- oder Wachstumsschmerz, der vor allem bei jenen auftritt, die nicht in segregierten, abgeschotteten Klassenverhältnissen leben.
Dieser Text ist ein Plädoyer für einen Journalismus und eine Literatur für alle.
Die soziale Beschämung als Herrschaftstechnik zahlt sich sogar für die meisten Beschämten aus. Eine Studie zeigt, dass „Kinder aus benachteiligten Familien als Erwachsene durchschnittlich 20 Prozent mehr verdienen, wenn sie mit Kindern aus wohlhabenden Elternhäusern befreundet waren als Kinder, die keine reichen Kontakte hatten.“ Ich gehöre zu dieser Gruppe. Und auch die beiden Sozialarbeiter*innen, die mich nach meiner Lesung angesprochen haben, gehören dazu, trotz ihres Klassenhintergrundes.
Dieser Text ist ein Plädoyer für einen Journalismus und eine Literatur für alle. Auch für jene, die unter sich bleiben, jene, die keine Zeitungen und Bücher lesen. Bei denen die Frage nach gesellschaftlichem Aufstieg so weit entfernt ist wie der Gewinn der Schweizer Meisterschaft für den FC Winterthur. Ein Schreiben, das nicht vorgibt, für diese Unsichtbaren zu schreiben, dabei aber ein selbstwirksames Aufsteiger*innenmilieu im Blick hat. Das ist das Ziel, an dem sich ein engagierter Medien- und Literaturbetrieb wird messen lassen müssen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?