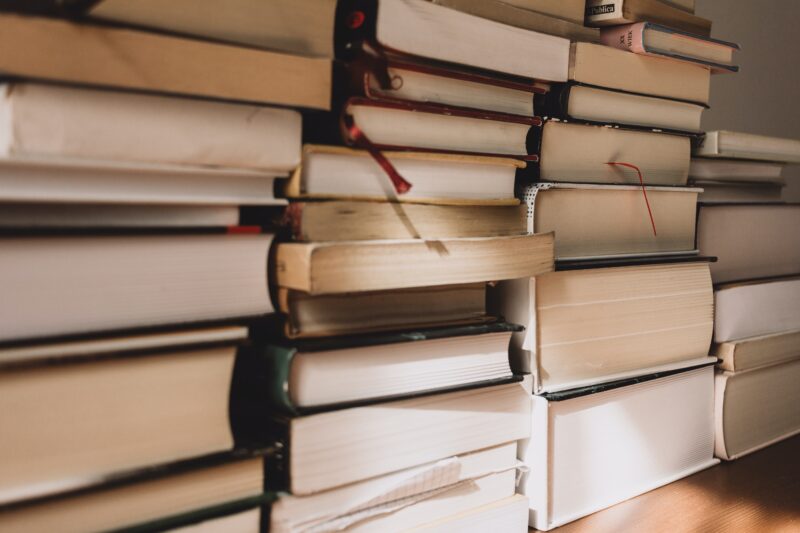Die Literatur als ein Ort, um Partei zu ergreifen, das ist kunstfremd – Sätze wie diese gelten im Literaturbetrieb als etwas, das Pierre Bourdieu Doxa nennen würde: als nicht infrage gestellte kollektive Wahrheiten.
„David gegen Goliath“ ist hier Programm. Olivier David
gegen die Goliaths dieser Welt. Anstatt nach unten wird nach oben getreten. Es geht um die Lage und den Facettenreichtum der unteren Klasse. Die Kolumne dient als Ort, um Aspekte der Armut, Prekarität und Gegenkultur zu reflektieren, zu besprechen, einzuordnen. „David gegen Goliath” ist der Versuch eines Schreibens mit Klassenstandpunkt, damit aus der Klasse an sich eine Klasse für sich wird. Die Kolumne erscheint ebenfalls als Newsletter.
Ich halte es in diesem Punkt mit Ocean Vuong, der in „Auf Erden sind wir kurz grandios” schrieb: „Sie werden dir sagen, dass gutes Schreiben sich vom Politischen ‚emanzipiert’, wodurch die Schranken der Unterschiede transzendieren und die Menschen auf universelle Wahrheiten hin vereint werden. Sie werden sagen, dass das vor allem durch Handwerk erreicht wird. Sehen wir uns an, wie es gemacht ist, sagen sie – als wäre die Art und Weise, wie etwas zusammengebaut ist, seinem schöpferischen Impuls fremd.”
Annie Ernaux: Ethnologin ihrer selbst
Es ist Anfang Januar und gegen mich läuft ein kleiner Shitstorm, weil ich mich in einem Essay in der TAZ gegen ein Böllerverbot ausgesprochen habe. Ich lese „Die Scham” von Annie Ernaux. Ein Buch, in dem Ernaux über einen Tötungsversuch innerhalb ihrer Familie schreibt. Gleich das erste Buch meines Leseprojekts liefert die Idee für ein literarisches Verfahren. Ihr Schreiben über die eigene soziale Herkunft stellt Annie Ernaux in den Dienst der Suche nach ihrer inneren Wahrheit.
„Natürlich keine Erzählung, die eine Wirklichkeit erzeugen würde, anstatt nach ihr zu suchen. Mich auch nicht damit begnügen, die Erinnerungsbilder freizulegen und zu transkribieren, sondern diese als Quellen behandeln, die etwas aussagen, wenn man sie mit unterschiedlichen Herangehensweisen betrachtet. Im Grunde eine Ethnologin meiner selbst sein.”
Im Februar lese ich noch ein weiteres Buch von Annie Ernaux, das jüngst erschienene (und mit 40 Seiten unverschämt kurze) „Der junge Mann”, in dem Ernaux ihre Beziehung zu einem 30 Jahre jüngeren Mann reflektiert. Ernaux, das merkt man bei genauerer Lektüre, ist da stark, wo sie mit ihrer Literatur kollektive soziale Wahrheiten finden und erforschen will, wie etwa in „Die Jahre”. Das schafft sie, indem sie das literarische Ich gegen ein „man“ eintauscht und so aus individuellen Erkenntnissen kollektive Gefühle und Wahrheiten konstruiert.
Was man bei Ernaux lernen kann, ist, wie sie Bourdieus soziologische Analyse mit den Mitteln der Literatur verarbeitet und damit zum Class-Building, also zur Bewusstwerdung eigener Klassenidentität beiträgt. So schreibt Sarah Carlotta Hechler im Sammelband „Autosoziobiografie – Poetik und Politik”: „Die Idee, Kollektives im Individuellen freizulegen, [wird] zur Grundlage Ernaux’ Schreibprojekt. Aus dem Schock des Selbstverlusts entsteht das Angebot an den:die Leser:in, sich in den Texten wiederzufinden und dadurch die Isolation der eigenen schmerzvollen Erfahrungen zu überwinden.”
Hans Fallada Festwochen
Drei Falladas standen auf meiner Leseliste für mein Klassenprosa-Projekt. Neben Falladas Klassiker „Kleiner Mann, was nun”, dem Roman über den Abstieg eines jungen Pärchens zur Zeit der Weimarer Republik, hatte ich mir „Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“ und „Jeder stirbt für sich allein“ rausgeguckt. Im Gegensatz zu Annie Ernaux handelt es sich bei den drei Büchern Falladas um Fiktion.
Grossartig an Fallada ist, wie er die Würde der sogenannten einfachen Leute gegen Fragen der Moral verteidigt. Menschen aus der Unterklasse müssen nicht moralisch integer sein, damit Fallada sich für sie interessiert. Trotzdem schildert er ihre Lebensrealitäten mit Respekt – und dennoch schonungslos. Gerade deswegen gelingt es ihm, ein differenziertes Bild von armen Menschen zu zeichnen, in dem er weder überhöht noch die Menschen rein als Produkte ihrer Umwelt ausweist.
Otto Quangel, der Protagonist in „Jeder stirbt für sich allein“, schreibt als Schreinermeister Postkarten gegen das Naziregime. Sein Widerstand wird weder überhöht noch kleingeredet. Quangel wird als verschroben, schweigsam und bockig dargestellt. Gleichzeitig ist er ein Mann seiner Klasse in dem Sinne, als dass er Prinzipien vertritt, mit denen er auch in Haft nicht bricht.
Auch die Frauenfiguren Falladas imponieren bisweilen, obgleich sie einerseits durch die Rollenbilder ihrer Zeit und andererseits durch den männlichen Blick des Autors geprägt sind. Da ist Anna Quangel, die Frau von Otto Quangel, die zwar ihren Platz als Frau in der Familie Quangel kennt, aber trotzdem keine Mitläuferin ist. Da ist Emma Mörschel, genannt Lämmchen, die, obwohl nichts gelingt und alles im Scheitern begriffen ist, zu ihren Prinzipien steht, wenn sie sagt: „Die, die wir treten können, die wollen wir nicht treten“.
Unter der Gemengelage von Krieg, lebensbedrohlicher Verelendung und roher Gewalt ist Falladas Schreiben eine Vorstufe von Ernaux. Differenziert schreibt er von Verfehlungen und dem Erhalt der Menschenwürde unter schlimmsten Zuständen – und liefert Ernaux damit das Material, mit dem sie individuelle Wahrheiten in kollektive verwandelt.
Literatur als Rache
Wer Literatur explizit in den Dienst des Klassenkampfes stellt, wird bei den folgenden zwei Büchern fündig. Robert Bracks „Blutsonntag” ist ein politischer Kriminalroman, der sich mit der Aufarbeitung des Altonaer Blutsonntag befasst, bei dem 18 Menschen erschossen wurden. Mesut Bayraktars „Aydin – Erinnerung an ein verweigertes Leben” rekonstruiert den Lebenslauf vom Onkel des Autors.
Bei Brack werden mit prototypischer Sprache die grossen Fragen linker Bewegungen der vergangenen hundert Jahre verhandelt: „Warum stehen die Arbeiter nicht auf und folgen ihren Bestimmungen? Warum, zum Donnerwetter, verläuft die Geschichte nicht so, wie es ihr vorherbestimmt ist? Warum kann man nicht ausrechnen, an welchem Tag das Ende der Bourgeoisie und ihrer verbrecherischen Verbündeten gekommen ist?” Bracks Hauptfigur, die kommunistische Journalistin Klara Schindler, findet die Antworten auf ihre Fragen in sich selbst. Wenn die kommunistische Arbeiterbewegung zu schwach ist, den Kampf aufzunehmen, muss sie es eben selbst tun. Sie schwört, den Altonaer Blutsonntag zu rächen.
Mesut Bayraktar Rache funktioniert auf zwei Ebenen. Wie der Untertitel bereits sagt, geht es ihm um die Erinnerung an diejenigen, die unsere Gesellschaft an den Rand stellt – wobei im Falle seines Onkels Aydin der Rand bedeutet, dass er nach einem Gefängnisaufenthalt in Deutschland in die Türkei zurückgeführt wird.
Eine weitere Motivation findet Bayraktar in der Kanalisierung und (Re)Politisierung seiner Gefühle. So schreibt er: „Ich war Gefangener meiner Wut, bis ich lernte, dass sie eine Gefährtin ist und mir schon immer aus dem Gefängnis der Ausbeutung helfen wollte.” So fein wie er die Ursprünge familiärer Wut durchdekliniert („Impulse entladen sich als Nebenprodukt der Klassengewalt in Form von Gewalt gegen sich und ihresgleichen”), so beschreibt er auch sein Verständnis von Literatur: „Ich aber will jene zur Sprache kommen lassen, die in der Gewalt der Sprachlosigkeit gefangen gehalten werden” und „Die Form muss sie vom Schweigen befreien.”
„Aydin“ durchzieht der Versuch, durch das Aufschreiben eigener Familiengeschichte eine selbstbestimmte Deutung geltend zu machen: sein Onkel, der als Gastarbeiter für den Wohlstand ausgebeutet wird, für den sich menschlich in Deutschland niemand interessierte, der an einer Rolle scheiterte, die ihm zugewiesen wurde. Der sich widersetzte und für diese Widersetzen bestraft wurde. Eine Deutung, die sich der Geschichtsschreibung der Herrschenden widersetzt. Bayraktars Prosa ist politisch im besten Sinne und straft jene Lügen, die glauben, zwischen politischem Schreiben und guter Literatur liege ein Widerspruch.
Die Form muss sie vom Schweigen befreien
Drei weitere Bücher möchte ich am Ende dieses Textes erwähnen. Sie alle haben eine Form gefunden, die ihre Protagonist*innen vom Schweigen befreit. Jeannette Walls „Schloss aus Glas”, eine romanhafte Erzählung ihres Aufwachsens in der amerikanischen Armutsklasse entfaltet mit ihren einfach gebauten Sätzen einen Sog, der einen das Buch nicht mehr aus der Hand legen lässt. Die Story von zwei Eltern, die zeitweise auf der Strasse leben, die Beschreibung bitterster Armut und Verwahrlosung – all das konfrontiert einen mit einer offensichtlichen Wahrheit: Die Schilderung dieser sozialen Zustände allein birgt das Potenzial, Leser*innen zu emotionalisieren und auf diesem Weg zu politisieren.
Das ist die eine Seite, die andere ist eine unbequeme: Detaillierte Schilderungen à la Walls können natürlich auch auf einer anderen Ebene funktionieren: Als wohlig-voyeuristisches Gruselstück darüber, was Armut mit Menschen macht. Zwischen diesen beiden Deutungsmöglichkeiten liegt ein Gedanke, der mir nicht aus dem Kopf geht: eine Art selbstbestimmtes, bewusstes Bedienen von Voyeurismus als Mittel der Emotionalisierung. Ein Voyeurismus, der die Chance birgt aufzurütteln – und ohne den manche Bücher nie die Verbreitung gefunden hätten, die es braucht, damit auch arme Menschen, die sich in den Geschichten Walls wiederfinden, Zugang zu dieser Lektüre gewinnen können.
Was die sprachliche Ebene angeht, sind neben den schon genannten Romanen besonders „Hund, Wolf, Schakal” von Behzad Karim Khani und „So forsch, so furchtlos” von Andrea Abreu hervorgestochen. Mit wenigen Worten schafft Khani Bilder entstehen zu lassen, die im Gedächtnis bleiben („Die Jacke weinte an seinem hageren Körper. An ihm war sie eine Lüge, eine Behauptung, aus der seine Beinchen röhrenförmig und beschämend herausragten wie die Wahrheit”) und Abreu vereint Situationskomik und Tragik zu grosser zeitgenössischer Literatur.
Was kann Literatur für eine gerechte Welt tun?
Sie kann eine Analyse der Gegenwart liefern.
Sie kann durch die Verbindung zwischen Gefühl und Intellekt soziale Wahrheiten nachhaltig im Bewusstsein ihrer Leser*innen verankern, wie es die Politik nicht (und der Journalismus nur sehr partiell) vermag.
Sie kann Gründe liefern, soziale Kämpfe zu fechten.
Sie kann Teil eines Prozesses sein, der eine Klasse formt.
Sie kann agitieren – und gleichzeitig Hochkultur sein.
Sie kann Rache üben.
Sie kann, das weiss ich nicht nur als Leser, sondern auch als Autor, das eigene Leben retten – und die Leben anderer.
Sie kann ermächtigen.
Sie kann unterhalten.
Sie kann ein Verständnis für Kunst schaffen – und darüber für die Aneignung der Räume der Kunst als politisches Feld.
Verkneifen muss ich mir, mich selbst auf die Auswirkungen meines Leseprojektes zu untersuchen. Als wäre ich plötzlich ein anderer nach der Lektüre von vierzehn Romanen, die Klasse als Ausgangspunkt haben. Was ich allenfalls bemerke, ist, dass sich durch das Aufholen eigener Wissenslücken das Verständnis für Prosa von unten ausdifferenziert. Damit einher geht das Verständnis davon, dass Prosa von unten Teil eines Kampfes ist, der die Literatur (kultur-)bourgeoisen Logiken entzieht – und sie denjenigen zur Verfügung stellt, die bisher aus dem Bereich der Hochkultur ausgeschlossen sind.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?