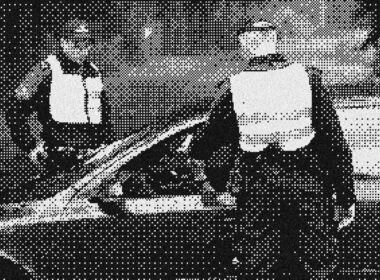Als Philomena Colatrella (49), Chefin der CSS-Krankenkasse, am 14.04.2018 in einem Blick-Interview an die Eigenverantwortung der Versicherten appellierte und die Idee von einer Erhöhung der fixen Mindestfranchise von 300 Franken auf „5000 Franken oder 10’000 Franken” ins Spiel brachte, erntete sie nur Kopfschütteln.
Dabei wollte Colatrella mit ihrem Vorschlag nach eigenen Aussagen nur darauf aufmerksam machen, dass die steigenden Kosten der Grundversicherung durch eine höhere Mindestfranchise abgefedert werden könnten. Die Mindestfranchise ist die kleinste mögliche Franchise, die sich Versicherte aussuchen können. Hinter der Franchise steckt die Idee, dass Versicherte weniger schnell zum Arzt rennen, wenn sie die ersten 300 Franken ihrer Gesundheitskosten selber übernehmen müssen. Die Franchise ist ab einem Betrag von 300 Franken frei wählbar: Wer eine tiefere Krankenkassenprämie möchte, wählt eine höhere Franchise. Ist die Franchise einmal bezahlt, zahlen Versicherte pro Behandlung einen Selbstbehalt von 10 %.
Nach Berechnungen der CSS wäre das Sparpotenzial einer solchen Erhöhung bei bis zu einer Milliarde Franken. So würde die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt. Und man fordere ja nicht nur eine Erhöhung der Mindestfranchise, hielt die Mediensprecherin der CSS-Versicherung fest: „Wir wollen die Solidarität nicht aushebeln, es braucht eine finanzielle Abfederung für sozial Schwächere.”
Dass Frau Colatrella mit ihrem Rekordlohn von 743’766 Franken im Jahr sich den Konsequenzen ihrer Aussage nicht bewusst gewesen ist, bekam die CSS in den Tagen, die auf das Interview folgten, auch von ihren Kundinnen und Kunden zu spüren (nicht Frau Colatrella natürlich, sondern die schlechter bezahlten Callcenter-Angestellten): Viele riefen besorgt bei der CSS-Versicherung an und fragten, ob sie mit einer steigenden Mindestfranchise rechnen müssen. Es stellte sich nämlich wenig überraschend heraus, dass für viele Menschen in der Schweiz eine Erhöhung der Franchise auf mindestens 10’000 Franken eine massive finanzielle Belastung wäre – und dass die Aussage, welche die CSS-Chefin mit einer gewissen Nonchalance im Interview tätigte, bei vielen Versicherten existenzielle Ängste auslöste.
Dies ist wenig überraschend: Es ist bekannt, dass viele Menschen in der Schweiz gerade durch die steigenden Krankenkassenprämien in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Steigende Fixausgaben durch die Franchise würden die sonst schon klammen Haushaltskassen weiter unter Druck setzen.
Automatismus für die Franchise
Die Empörung über den überambitionierten Vorschlag einer Krankenkassen-Chefin flachte relativ schnell ab. Ganz erfolglos war aber ihr resolutes Vorpreschen nicht: Die Idee, dass eine Franchisenerhöhung ein praktisches Mittel zur Dämpfung der immer steigenden Gesundheitskosten sein könnte, hat sich in den Köpfen der GesundheitspolitikerInnen eingenistet.
Jetzt hat der Bundesrat eine abgeschwächte Version des Vorschlages dem Parlament vorgelegt. Neu soll nicht mehr der Bundesrat über die Höhe der Mindestfranchise bestimmen. Diese soll neu automatisch an die Kostenentwicklung in der obligatorischen Grundversicherung angepasst werden. Konkret schlägt der Bundesrat vor, jedes Mal, wenn die durchschnittlichen Bruttokosten für die Leistungen einer Person das 13-Fache der Mindestfranchise übersteigen, diese um 50 Franken zu erhöhen.
Was kompliziert klingt, lässt sich mit einem einfachen Rechenbeispiel illustrieren: 2016 waren die durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person bei 3777 Franken; die Mindestfranchise liegt seit 2004 unverändert bei 300 Franken. Das ergibt ein Verhältnis von 1:12. Doch die durchschnittlichen Bruttokosten steigen stetig, wie eine Statistik des Bundes zeigt: Durchschnittlich steigen die Kosten um etwa 4 % pro Jahr. Stimmt das Parlament also dem Automatismus zu, ist alle drei bis vier Jahre mit einer Erhöhung von 50 Franken zu rechnen.
Der Bundesrat begründet diese weitreichende Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung auf die gleiche Weise, wie es Philomena Colatrella bei ihrem missratenen Vorschlag anfangs Jahr tat: Durch die Erhöhung der Mindestfranchise soll die Eigenverantwortung der Versicherten gefördert werden und „die Höhe der von ihnen verursachten Kosten ins Bewusstsein bringen”. Die Sparwirkung der Massnahme sieht der Bundesrat allerdings verhalten. Bei früheren Prämienerhöhungen sei kein solcher Effekt festgestellt worden, sagte er. „Man darf keine Wunder erwarten”, sagte Alain Berset.
Prämienverbilligungen sollen es richten
Im Nationalrat nahmen SVP, FDP und CVP den Ball trotzdem dankend auf und wollten sogar über eine direkte Erhöhung der Mindestfranchise auf 500 Franken abstimmen. Aus Zeitmangel wurde dieser Entscheid aber vertagt.
Wie bereits Philomena Colatrella, wiesen auch bürgerliche PolitikerInnen darauf hin, dass es eine soziale Abfederung für soziale Schwächere brauche; etwa die kantonalen Prämienverbilligungen. So meinte etwa Christian Lohr von der CVP: „Wir sind überzeugt davon, dass es genügend Mittel gibt, um diesen Menschen Unterstützung zu bieten.”
Die gesetzlichen Prämienverbilligungen stehen allen Menschen zu, die in „bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen” leben. Wer diese Definition erfüllt, bestimmen die Kantone selber. Und diese Definition schliesst bei steigendem Spardruck in den Kantonen vermehrt Menschen der unteren Mittelschicht aus. Seit 2012 haben über 163’000 Menschen ihr Anrecht auf diese Prämienverbilligungen verloren.
Gleichzeitig nehmen die Kosten für die Kantone für die Prämienverbilligungen weiter zu. Was zuerst paradox klingt, kann einfach erklärt werden: Die Prämienverbilligungen sind an die Entwicklung der Krankenkassenprämien gekoppelt. Je höher die Krankenkassenprämie, desto höher müssen auch die Ausgaben für Krankenkassenprämien sein. Aber das ist nicht der einzige Grund. Können Versicherte ihre Prämie nicht bezahlen, dann kann die Krankenkasse beim Kanton bis zu 85 % der ausstehenden Prämien mit Verlustscheinen zurückfordern. Und diese Verlustscheine haben durch die steigenden Krankenkassenprämien weiter zugenommen: Zwischen 2013 bis 2017 sind die Gesamtkosten für diese um 60 % oder 130 Millionen gestiegen. Ausserdem zahlen die Kantone aus dem Topf der Prämienverbilligungen auch die Prämienverbilligungen für die Ergänzungsleistungs- und SozialhilfebezügerInnen – beides Kostenposten, die stetig steigen.
Am Ende zahlt die Sozialhilfe
Obwohl also immer weniger Menschen aus dem unteren Mittelstand Anspruch auf kantonale Prämienverbilligungen haben, steigen dort die Kosten. Die Kantone sind indes nicht bereit, die Budgetposten für Prämienverbilligungen entsprechend zu erhöhen. „Viele Kantone vernachlässigen die Prämienverbilligungen und ihre finanziellen Beiträge bleiben hinter der allgemeinen Entwicklung der Krankenkassenprämien zurück”, stellt Caritas Schweiz konsterniert fest. „Eine solche Entwicklung bestraft die Haushalte des unteren Mittelstandes und führt viele Familien in die Verarmung.”
Durch die Vorlage, welcher der Nationalrat zustimmte, soll die Mindestfranchise – und somit der finanzielle Druck auf einkommensschwache Haushalte – jetzt noch weiter erhöht werden. Daraus werden zwangsläufig höhere Kosten für die Sozialhilfe entstehen, wie der Bundesrat in seiner Vorlage selber zugibt. Die Erhöhung der Franchise könnte mehr Versicherte dazu veranlassen, Sozialhilfe zu beantragen. „Aus diesem Grund sind tendenziell höhere Sozialhilfeausgaben zu erwarten.”
So sieht die soziale Abfederung aus, von welcher die VersicherungsvertreterInnen und bürgerliche PolitikerInnen sprechen. Der finanzielle Druck der steigenden Gesundheitskosten wird in einem ersten Schritt auf die Prämienverbilligungen abgewälzt. Da die klammen Kantonskassen mit den Prämienverbilligungen aber sowohl die Kostensteigerung der Krankenkassenprämie als auch die daraus entstehende Explosion der Verlustscheine berappen müssen, werden in Zukunft zwangsläufig noch mehr Menschen ihren Anspruch auf Prämienverbilligungen verlieren. Auffangen muss das Ganze – wie bereits die Leistungssenkungen der IV – die Sozialhilfe.
So wird der finanzielle Druck von einer politischen Ebene auf die nächste weitergegeben, bis er im letzten Sicherungsnetz landet. Bundesrat und Nationalrat liefern ihren kantonalen Tochterparteien, welche in den Kantonen die Erhöhung der Prämienverbilligungen bekämpfen und die Kosten der Sozialhilfe politisch instrumentalisieren, grosszügig die erforderlichen Argumente.
Allerdings muss man dem Bundesrat zugute halten, dass die Erhöhung der Mindestfranchise nicht sein einziger Vorschlag ist, um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen: Mit seinem Massnahmenpaket für die Dämpfung von Gesundheitskosten, welches bis Ende Jahr in der Vernehmlassung bei den Kantonen ist, versucht er, alle entscheidenden Akteure (also auch Bund, Kanton, Pharmaindustrie und Krankenversicherungen) zur „Wahrnehmung ihrer Verantwortung” zu verpflichten. Man darf gespannt sein.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 26 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1612 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 910 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 442 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?