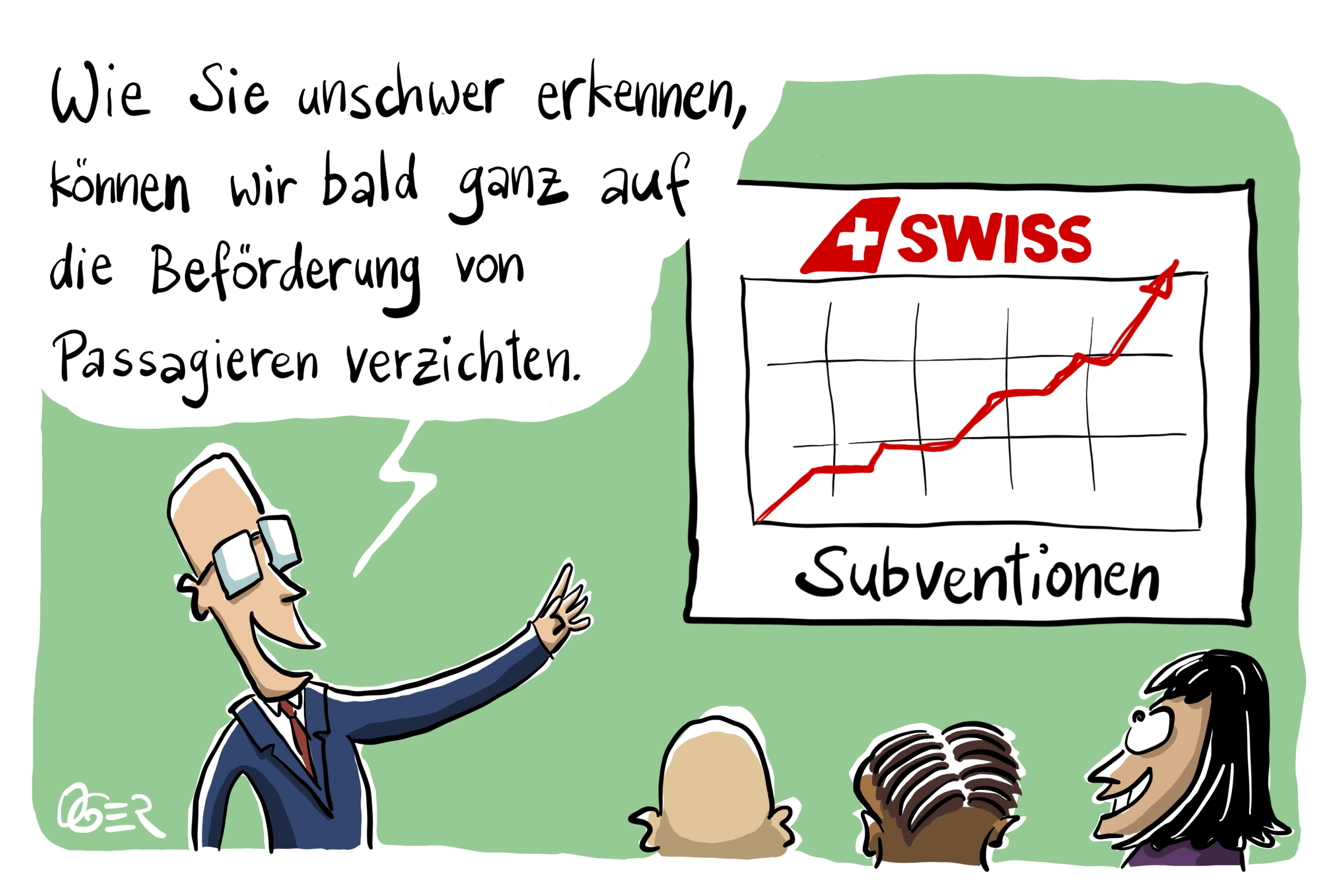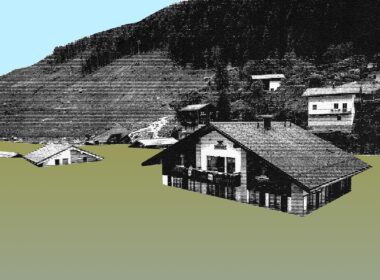„Wir können uns die Luxusemissionen der Reichen einfach nicht mehr leisten”, meint Filou*, eine Klimagerechtigkeitsaktivistin. Deshalb hat sie mit circa 100 anderen im vergangenen Mai eine Verkaufsmesse für Privatflugzeuge in Genf gestört. Die Aktivist*innen haben sich an Jets gekettet und den Haupteingang blockiert. Ihre Forderung ist so prägnant wie einfach: Privatflugzeuge gehören verboten.
Das Verkehrsmittel verdeutlicht die globale Klimaungerechtigkeit ganz besonders: Während 80 Prozent der Weltbevölkerung noch nie in einen Flieger gestiegen sind, sind die in Privatjets zurückgelegten Strecken in den letzten Jahren geradezu explodiert. Im Jahr 2022 waren in der Schweiz 63 Prozent mehr Privatflieger unterwegs als im Vorjahr, wie eine Studie von Greenpeace zeigt. Die am meisten beflogene Route war jene zwischen Genf und Paris. Insgesamt 2’745 Mal wählten Menschen im letzten Jahr einen Privatjet für diese Strecke, obwohl man sie mit dem Schnellzug in gerade einmal 3 Stunden und 13 Minuten zurücklegen kann.
Ein neuer klimapolitischer Hebel
Bei ihrer Aktion hat sich die Klimaaktivistin Filou ein wenig wie in einer Kohlegrube gefühlt. Die Klientel auf der Messe habe ihr den Eindruck vermittelt „bei den richtigen Leuten zu stören und direkt bei einer weiteren Ursache der Klimakrise anzusetzen”. Genau wie die Aktivist*innen der Letzten Generation, die in Deutschland einen Privatjet mit Farbe beschmiert haben, hat Filou neben den Kohlegruben, Flüssiggasterminals oder Grossbanken ein weiteres Ziel gefunden: den klimazerstörerischen Lebensstil der Superreichen.
Ganz offensichtlich ist die Verantwortung für den Klimawandel sehr ungleich verteilt.
Die Zahlen sprechen für diese Fokussetzung. Denn die reichsten 10 Prozent dieser Welt waren 2019 laut einer Studie des Ökonomen Lucas Chancel für 48 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Das reichste Prozent für fast 17 Prozent.
Ganz offensichtlich ist die Verantwortung für den Klimawandel sehr ungleich verteilt. Dieser Befund müsste eigentlich die Klimapolitiken beeinflussen. So wäre es zum Beispiel effizient – und darüber hinaus auch noch sozial gerecht – wenn vor allem die Reichen Klimaabgaben bezahlen müssten.
Um den klimapolitischen Hebel an der richtigen Stelle anzusetzen, müssten die Staaten damit beginnen, Zahlen zu den einkommensabhängigen Emissionen zu erheben. Die Verfasser des „Climate Inequality Report” von 2023, zu denen auch Lucas Chancel gehört, rufen deshalb die Regierungen dazu auf, bei der Generierung von CO2-Ungleichheitsstatistiken vorwärtszumachen.
Zahlen zur Schweiz
Die Schweizer Bundesverwaltung will davon aber nichts wissen. Das Bundesamt für Umwelt halte sich bei ihren Treibhausgasstatistiken an die Vorgaben der UNO, heisst es auf Anfrage von das Lamm. Das Bundesamt erhebt die Emissionen also nach Quellen oder Wirtschaftssektoren, aber nicht nach verschiedenen Bevölkerungsgruppen beziehungsweise Vermögensklassen. Auch von Nichtregierungsorganisationen wurden bislang noch keine Zahlen zur Klimabelastung der Reichen in der Schweiz veröffentlicht.
Zahlen des „World Inequality Lab”, die öffentlich zugänglich sind, geben jedoch interessante Anhaltspunkte. Das Lamm hat die Zahlen analysiert. Auch der Tagesanzeiger hat kürzlich darüber berichtet.
Der WID-Indikator zu den individuellen CO2-Fussabdrücken umfasst Emissionen, die auf den Konsum, die Investitionen und öffentliche Ausgaben zurückzuführen sind. Er schätzt somit ebenfalls die sogenannten grauen Emissionen, also Emissionen, die ein Individuum in einem anderen Land verursacht, indem er oder sie importierte Güter konsumiert.
Interessant am WID-Indikator ist ausserdem, dass er die Verantwortung für den Klimawandel nicht nur am individuellen Konsum, sondern ebenfalls an den Investitionstätigkeiten der jeweiligen Personen festmacht.
Der durchschnittliche CO2-Fussabdruck einer in der Schweiz lebenden Person beträgt demnach 17 Tonnen CO2-Äquivalente (tCO2e) pro Jahr. Mit dieser Einheit wird die Klimawirkung verschiedener Treibhausgase wie Methan, Lachgas oder Kohlendioxid vereinheitlicht. Zu beachten ist, dass es sich bei den Zahlen der World Inequality Database nur um sehr ungenaue Schätzungen handelt.
Ein*e Superreiche*r für 21 Arme
Diesen Zahlen zufolge hatte eine Person aus der ärmeren Hälfte der Schweizer Bevölkerung im Jahr 2019 einen CO2-Fussabdruck von 9 tCO2e. Das ist fast sechsmal weniger als eine durchschnittliche Person aus den reichsten 10 Prozent, deren geschätzter CO2-Fussabdruck 53.5 tCO2e betrug.
In gänzlich anderen Sphären bewegte sich das reichste 1 Prozent: Mit einem geschätzten CO2-Fussabdruck von 195.4 tCO2e emittierte es mehr als 21-mal so viel wie eine Person aus der ärmeren Bevölkerungshälfte.
Gestützt auf die Bevölkerungszahlen lässt sich nun nicht nur der Ausstoss einzelner Personen, sondern jener der gesamten Reichtumsklasse berechnen. So zeigt sich: Das reichste eine Prozent war 2019 für circa 11.5 Prozent, das reichste Zehntel für ungefähr 31 Prozent, die ärmere Hälfte für etwa 26 Prozent der gesamthaften Emissionen aller in der Schweiz lebenden Personen verantwortlich. Die deutliche Diskrepanz zwischen den reichen und armen Bevölkerungsgruppen ist geringer als auf globaler Ebene, was aufgrund des vergleichsweise hohen Lebensstandards in der Schweiz nicht verwundert.
Interessant ist schliesslich, wie sich diese CO2-Ungleichheit historisch entwickelt hat. Wie in anderen Ländern ist auch in der Schweiz die Schere zwischen Arm und Reich laut diesen Berechnungen seit den 1990er-Jahren weiter auseinandergegangen. Zwischen 1990 und 2019 ist der Anteil des reichsten Zehntels von fast 24 auf 31 Prozent gestiegen, während jener der ärmeren Hälfte von rund 32.5 auf 26.5 Prozent gesunken ist.
Darin zeichnet sich ein globaler Trend ab. Denn mittlerweile ist die CO2-Ungleichheit innerhalb der Länder grösser als jene zwischen den Ländern, wie Lucas Chancel herausgefunden hat.
Tax the Rich
Aus den vorliegenden Zahlen lassen sich zwei wichtige Schlussfolgerungen für die Schweizer Klimapolitik ziehen. Erstens gibt es einen riesigen, noch längst nicht ausgeschöpften klimapolitischen Hebel: die Emissionen der Reichen und Superreichen. Das wäre über eine Regulierung oder ein Verbot des Luxuskonsums oder über eine stärkere Besteuerung auf grosse Einkommen und Vermögen.
Zweitens zeigen die Zahlen deutlich, dass eine Bekämpfung des Klimawandels nicht unvereinbar ist mit Armutsbekämpfung und offenen Grenzen.
Das sieht auch Peppina Beeli, die Dossierverantwortliche für Klimapolitik bei der Gewerkschaft Unia, so: „Der ökologische Umbau ist ja nicht billig, deswegen macht es Sinn, progressive Gewinn- und Einkommensteuern zu erheben, um ihn zu finanzieren.” In dieselbe Kerbe schlägt auch die JUSO Schweiz: Mit der „Initiative für eine Zukunft” fordert die Jungpartei eine Schenkungssteuer von 50 Prozent auf sehr grosse Erbschaften, um eine „sozial gerechte Bekämpfung der Klimakrise” zu finanzieren, wie es im Initiativtext steht.
Auch global werden die Forderungen nach Besteuerung der Superreichen lauter. Im vergangenen Juli etwa haben sich 150 führende Ökonom*innen für eine Steuer auf Supervermögen positioniert, um eine sozial und global gerechte Bekämpfung der Klimakatastrophe zu ermöglichen. Nur schon eine Steuer von zwei Prozent auf diese Vermögen würde zwischen 2.5 und 3.6 Billionen US-Dollar jährlich generieren.
Zweitens zeigen die Zahlen deutlich, dass eine Bekämpfung des Klimawandels nicht unvereinbar ist mit Armutsbekämpfung und offenen Grenzen. Das Problem ist nicht, dass zu viele Menschen in der Schweiz leben, wie es aus rechten Kreisen immer wieder heisst. Das Problem ist in erster Linie, dass es eine Gruppe von Reichen und Superreichen gibt, die ein Vielfaches an beheiztem Wohnraum oder fossiler Mobilität beanspruchen können – einfach deshalb, weil es ihr Portemonnaie ihnen erlaubt.
Der gesamte Schweizer Mittelstand ist Teil jener globalen Bevölkerungsgruppe, die die Klimakatastrophe ganz besonders anheizt.
Umverteilung ist somit eine wirksame klimapolitische Massnahme – unter bestimmten Bedingungen.
Öffentlicher Luxus
Denn noch etwas zeigen die analysierten Zahlen eindrücklich. Mehr als die reichere Hälfte der Schweizer Bevölkerung gehört global gesehen zu den 10 Prozent, die – zur Erinnerung – für fast die Hälfte der globalen Emissionen verantwortlich sind. Mit anderen Worten: Der gesamte Schweizer Mittelstand ist Teil jener globalen Bevölkerungsgruppe, die die Klimakatastrophe ganz besonders anheizt. Auch diese rund 3.5 Millionen Menschen werden das Klima nicht wie bisher belasten können.
Denn laut Oxfam müssten bis 2030 die durchschnittlichen Emissionen pro Kopf auf 2.2 tCO2e sinken, wenn das Klimaziel von 1.5 Grad Celsius noch erreicht werden soll. Unter der Annahme einer global gerechten Verteilung der Emissionen müsste der Schweizer Mittelstand also innerhalb von weniger als sieben Jahren seine Emissionen um das Achtfache reduzieren.
Für das Anliegen einer Umverteilung von Reichtum in der Schweiz ergeben sich dadurch knifflige Fragen – vor allem für Linke und Gewerkschafter*innen. Wer nämlich nur Geld umverteilt, die tatsächlichen oder angestrebten Lebensformen des Mittelstandes aber beibehält, wird nicht zwingend nur Gutes fürs Klima tun. Zwar hätten die Superreichen weniger auf dem Konto. Gleichzeitig könnten sich aber Menschen aus dem Mittelstand oder aus ärmeren Schichten einen emissionsintensiveren Lebensstil leisten, etwa indem sie sich ein grösseres Auto kaufen oder ein zusätzliches Mal in den Urlaub fliegen.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte darin bestehen, lebensnotwendige und emissionsarme Güter und Dienstleistungen vom Markt zu nehmen und allen gratis oder kostengünstig durch die öffentliche Hand zur Verfügung zu stellen. So könnte man mithilfe von Steuern auf grosse Vermögen und Konzerne eine kostenlose Infrastruktur von Spitälern, öffentlichen Verkehrsmitteln, kulturellen Einrichtungen, öffentlichem Wohnraum, Altersheimen oder Kitas aufbauen.
Umverteilung bestünde dann nicht mehr allein darin, Geld von den Reichen zu den Ärmeren zu verschieben. Umverteilt würde vielmehr die Möglichkeit, am gemeinschaftlichen Leben teilzuhaben: Freizeit zu haben, sich politisch oder ehrenamtlich engagieren zu können, gut umsorgt zu werden. Der unabhängige Think Tank für eine demokratische Wirtschaft Communia nennt das „öffentlichen Luxus”. Sie meinen damit den „bedingungslosen Zugang zu den Gütern, die unser Leben möglich und schön machen – und das für alle”.
Dafür wären grundlegende gesellschaftliche Veränderungen notwendig, die weit mehr Menschen betreffen würden als nur die Superreichen. Auch das müssten Linke hierzulande anerkennen – bei aller berechtigten Empörung über Superyachten und Privatjets.
*Name von der Redaktion geändert
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 54 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 3068 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1890 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 918 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?