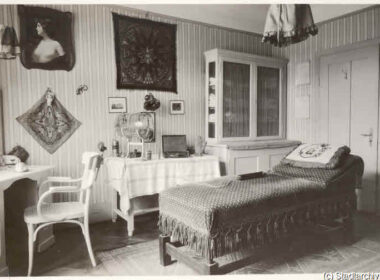Im Jahr 2020, als Staaten weltweit wegen COVID-19 ihre Grenzen schlossen, störten sie die globalen Lieferketten und liessen die Rohstoffpreise einbrechen: Ölpreise wurden um 60 Prozent herabgesetzt und erreichten im April 2020 ein 18-Jahres-Tief, Metallpreise wurden um 15 Prozent gesenkt, die für Agrarrohstoffe um 10 Prozent.
Zwar erhöhten Unternehmen die Preise in den nächsten Jahren, aber für einige Länder war der Schaden bereits angerichtet. Sambia, das zu den 10 grössten Kupferproduzenten der Welt gehört, war eines von ihnen.
Der Rohstoff Kupfer, der vor allem für elektrische Geräte wie Kabel und Motoren verwendet wird, bringt Sambia jährlich bis zu 70 Prozent seiner Exporteinnahmen. Das macht das Land wirtschaftlich extrem abhängig: 44 Prozent der Staatseinnahmen stammen aus dem Rohstoffsektor. Als die Preise sanken, konnte Sambia seine Schuldner nicht mehr bezahlen. 2021 wandte sich die sambische Regierung an die G20, um seine Schulden neu zu verhandeln. Die Umschuldung war langwierig und zwang Sambia, ein 1,3‑Milliarden- Dollar-Darlehen vom IWF aufzunehmen – verbunden mit durchgreifenden Reformen.
Rohstoffhandelsfirmen mit Sitz in der Schweiz haben diese Entwicklungen indirekt beeinflusst – in den letzten 20 Jahren wurde im Durchschnitt bis zu 50 Prozent des sambischen Kupfers über die Schweiz gehandelt. Darüber hinaus ist der Schweizer Finanzplatz an Finanzierungslösungen beteiligt, die den Handel mit Rohstoffen stark beeinflussen.
Finanzmarktakteur*innen haben den Rohstoffhandel aber nicht immer dominiert.
Marktschwankungen: Anfälligkeit ist nicht selbstverständlich
Ein Land gilt als rohstoffabhängig, wenn mehr als 60 Prozent seiner Warenexporte aus Rohstoffen wie Öl oder Lithium oder aus landwirtschaftlichen Produkten wie Mais oder Kaffee bestehen. Laut der UN sind 85 Prozent der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen rohstoffabhängig und daher besonders anfällig für Rohstoffpreisschocks, von denen die Pandemie nur die jüngste in einer langen Liste ist.
Internationale Organisationen wie die UN oder die Weltbank argumentieren heutzutage, dass rohstoffabhängige Länder ihre Wirtschaft breiter aufstellen sollten. Sich also nicht auf eine einzige Einkommensquelle stützen, sondern mehrere Sektoren entwickeln. Damit wären sie den internationalen Marktpreisen weniger ausgeliefert, um ihre Staatsausgaben zu finanzieren.
Länder mit niedrigerem Einkommen nutzten ihre Rohstoffmacht, um die Länder des Globalen Norden dazu zu bewegen, das internationale Wirtschaftssystem umzustrukturieren.
Dass diese Staaten aber überhaupt so anfällig für Marktschwankungen sind, ist keineswegs selbstverständlich. Sie könnten ebenso ihre Marktmacht stärken, indem sie die Preise koordinieren und stabil halten. Und tatsächlich haben rohstoffreiche Länder um 1970 genau das gemacht – indem sie internationale Rohstofforganisationen gründeten.
In den späten 1980er und 1990er Jahren haben sie diese Organisationen jedoch massenhaft aufgegeben oder diese verloren ihre Kernfunktion, die Preise zu stabilisieren. Heute würde alleine der Versuch, solche Organisationen zu gründen, auf erhebliche Hürden stossen. Wie kam es dazu?
Pufferlager und Exportquoten: Strategien für stabile Rohstoffpreise
Vor den 1970er Jahren gab es nur wenige internationale Rohstofforganisationen. Das änderte sich nach dem Ölembargo von 1973. Die OPEC, die Organisation der ölexportierenden Länder, verhängte das Embargo gegen Länder, die Israel im Jom-Kippur-Krieg unterstützt hatten. Dadurch schnellten die Ölpreise in die Höhe und bedrohten die Stabilität ganzer Volkswirtschaften. Das zeigte, dass rohstoffexportierende Staaten gemeinsam grossen Einfluss auf den Globalen Norden haben könnten.
Gleichzeitig stieg damals mit dem Wirtschaftsboom in wohlhabenden Ländern die Nachfrage nach Rohstoffen aus Staaten mit niedrigerem Einkommen. Letztere nutzten ihre Rohstoffmacht, um die Länder des Globalen Norden dazu zu bewegen, das internationale Wirtschaftssystem umzustrukturieren. Dafür wandten sie sich an die UN.
Internationale Rohstofforganisationen sollten die Macht haben, die vereinbarte Preisuntergrenze zu verteidigen und die Länder vor Einnahmeverlusten zu schützen.
Das 1976 veröffentlichte Integrierte Programm für Rohstoffe schlug vor, für 18 Rohstoffe internationale Organisationen zu schaffen, um die Rohstoffpreise zu stabilisieren oder sogar zu erhöhen. Etwa durch Pufferlager, die bei starken Preisschwankungen den Kauf oder Verkauf aus einem zentralen Fonds steuern. Oder durch Exportquoten, damit rohstoffreiche Länder das Angebot durch Produktionsbeschränkungen kontrollieren können. Zusätzlich sollten multilaterale Abkommen sicherstellen, dass importierende Länder bestimmte Mengen zu festen Preisen kaufen – selbst wenn der Weltmarktpreis darunter fällt.
Prompt entstanden auf internationaler Ebene Organisationen wie die Union der Bananen exportierenden Länder (1974), die Internationale Bauxitvereinigung (1974), oder die Internationale Vereinigung zur Förderung von Tee (1977). Für Kupfer wurde 1967 in Lusaka der Zwischenstaatliche Rat der kupferexportierenden Länder gegründet. Zu den Mitgliedern zählten Chile, Peru, Zaire und Sambia, Australien, Indonesien, Papua-Neuguinea und Jugoslawien, die zusammen 30 Prozent der weltweiten Kupfermenge produzierten.
Um der schwierigen Wirtschaftslage in den 1980er Jahren zu begegnen, forderten die rohstoffexportierenden Länder in mehreren UN-Resolutionen, die internationalen Rohstoffabkommen zu verbessern: Internationale Rohstofforganisationen sollten die Macht haben, die vereinbarte Preisuntergrenze zu verteidigen und die Länder vor Einnahmeverlusten zu schützen.
Risikoreicher und profitabler: Wie Finanzmärkte die Rohstoffpreise zu dominieren begannen
In den 1990er Jahren glaubte man immer weniger an die Rohstoffmacht des Global Südens. Der Grund dafür waren Entwicklungen im Finanzsektor.
Während rohstoffexportierende Länder mehrere Abkommen neu aushandelten, drängten reiche Länder auf sogenannte Marktlösungen. Auf den Tagungen der UN-Generalversammlung argumentierten die USA und die Länder der EU, dass die Finanzmärkte genug Geld und Möglichkeiten hätten, um Risiken abzufedern und die Rohstoffpreise zu stabilisieren. Dies folgte auf wichtige Finanzentwicklungen in diesen Ländern: dem Handel mit Derivaten und der Schaffung neuer Anlageinstrumente.
Derivate sind Finanzinstrumente, die den Preis eines Basiswerts abbilden – etwa von Aktien, Rohstoffen oder Währungen. Konkret sind es Verträge, die als Preisgarantien funktionieren: Statt den Basiswert direkt zu besitzen, schliessen zwei Parteien einen Vertrag über dessen künftige Preisentwicklung ab. Steigt oder fällt der Wert, zahlen oder erhalten die Parteien die Differenz entsprechend der Vereinbarung. So ermöglichen Derivate Investor*innen, Risiken zu minimieren oder gezielt auf Marktbewegungen zu spekulieren.
Einige Derivate basieren jedoch nicht auf einem Preis, sondern auf einem Ereignis oder einer Handlung – wenn beispielsweise bei einem Erbeben einer gewissen Stärke eine abgemachte Versicherungssumme ausgezahlt wird, oder wenn ein Kaufender eine bestimmte Auszahlung erhält, sobald zum Beispiel ein Unternehmen fusioniert.
Derivate können zudem auf anderen Derivaten basieren. Diese komplexen Derivate haben mitunter zur Finanzkrise 2008 beigetragen.
In den 1980er Jahren begann die Finanzindustrie im Globalen Norden, mit Derivaten im Rohstoffhandel zu experimentieren, um höhere Profite zu erzielen. Eine Art dieser Derivate, die Terminverträge, verpflichten Kaufende, etwas zu einem bestimmten Datum zu einem Preis zu kaufen, der im Voraus festgelegt wurde.
Die neuen Terminverträge wurden nicht mehr an der Börse gehandelt, sondern direkt zwischen privaten Parteien. Das machte sie riskanter, aber auch profitabler.
Solche Terminverträge waren im Rohstoffmarkt nicht neu. Sie schützen Verkaufende und Kaufende vor Verlusten durch Preisänderungen über längere Zeiträume. Dies war besonders für landwirtschaftliche Herstellende wichtig, da Wetterveränderungen zu hohen Erntemengen führen konnten, die den Markt überschwemmten und die Preise drückten. Diese Terminverträge wurden an offiziellen Börsen gehandelt, wo eine Drittpartei die Vertragsbedingungen für beide Vertragsparteien garantierte.
Die neuen Terminverträge, mit denen die Finanzindustrie zu experimentieren anfing, wurden jedoch nicht mehr an der Börse gehandelt, sondern direkt zwischen privaten Parteien. Das machte sie riskanter, aber auch profitabler. Gleichzeitig boten Banken ein neues Anlageinstrument an: die „Rohstoffindexfonds“. Diese bilden einen Korb von Rohstoffen ab und sind vor allem für Anleger*innen attraktiv, die risikoarmer und diversifizierter investieren wollen.
Diese beiden Entwicklungen lockten verschiedene Finanzmarktakteur*innen an die Rohstoffmärkte. Nicht nur Investor*innen, sondern auch Banken selbst fingen an, Termingeschäfte zu kaufen, um sich gegen neue finanzielle Risiken abzusichern. Schliesslich mussten die Banken ihre Anleger*innen auszahlen, wenn die Rohstoffpreise im Index stiegen. Um das Geld dafür zu haben, kauften sie Termingeschäfte, mit denen sie sich Profite erhofften.
US-Regierung fördert neue Finanzinstrumente und Deregulierung
In den USA förderte die Regierung diese Finanzinnovationen. Die Behörde, die die Derivatenmärkte regulieren sollte, gab in den 1980er Jahren bekannt, dass ausserbörslich gehandelte Derivate nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. US-Beamte begannen auch, auf UN-Handels- und Entwicklungskonferenzen Derivate als geeignete Risikomanagement-Mechanismen anzupreisen.
Im Einklang mit der allgemeinen Begeisterung für das Finanzwesen in jenen Jahrzehnten überzeugten einkommensstarke Länder andere, dass mehr Finanzinvestor*innen auf den Rohstoffmärkten für bessere Preise und Stabilität sorgen würden – und zwar wirksamer als internationale Regulierungen oder Absprachen zwischen Produzent*innen. Dass diese neuen Finanzmarktakteur*innen auch Probleme verursachen könnten – etwa durch Anreize für spekulativen Handel und Schocks durch Herdenverhalten – taten die USA und EU zwar als „nicht ideal“, aber nicht besonders besorgniserregend ab.
Mit über 300 im Rohstoffhandel tätigen Unternehmen ist Genf der grösste Rohstoffhandelsplatz der Schweiz.
Rohstoffabkommen fanden somit nicht die nötige Unterstützung der international mächtigen Länder, und eine internationale Rohstofforganisation nach der anderen wurde delegitimiert, aufgelöst oder in die Untätigkeit gedrängt.
Neue Profiteure: Handel, Lagerung, Transport und Zertifizierung
Der Zwischenstaatliche Rat der kupferexportierenden Länder wurde 1988 aufgelöst – eine der ersten internationalen Rohstofforganisationen, die in dieser Zeit unterging.
Seitdem sind die Weltmarktpreise für Kupfer zu normalen Zeiten transparenter geworden – dank der allgegenwärtigen Nachrichtenmedien, die Information leicht zugänglich machen. Gewinne durch Preisunterschiede sind dadurch seltener.
Aber das machte den Rohstoffhandel nicht profitabler für Exportstaaten.
Die in der Schweiz ansässigen Unternehmen können grosse Gewinne erzielen – indem sie in die Dienstleistungen investieren, anstatt in kostspielige und langfristige Bergbauprojekte.
Denn ein grosser Teil der Einnahmen aus dem Rohstoffhandel stammt heute aus der Lagerung, dem Transport und der Zertifizierung. Hier erzielen Transport- und Schifffahrtsunternehmen, Finanzinstitute, Inspektionsfirmen und Softwareanbieter*innen beträchtliche Gewinne. Und diese Unternehmen gedeihen dort, wo sie Zugang zu Kapital, internationalen Organisationen und globalen Vorschriften, politischer Stabilität und niedrigen Steuern haben.
Zum Beispiel im Kanton Genf. Mit über 300 im Rohstoffhandel tätigen Unternehmen ist Genf der grösste Rohstoffhandelsplatz der Schweiz. SGS, das weltweit führende Unternehmen für Probenahme, Prüfung und Zertifizierung von Rohstoffen hat seinen Sitz ebenfalls in Genf. Auch die schweizerische Schifffahrtsindustrie ist dort stark verankert: Rund 100 Unternehmen der Branche sind in der Genferseeregion ansässig.
Die rund 50 Prozent des sambischen Kupfers, das in den letzten Jahren in die Schweiz exportiert wurde, haben hingegen nie den Schweizer Boden erreicht. Aber die in der Schweiz ansässigen Unternehmen können an verschiedenen Stellen der globalen Lieferkette grosse Gewinne erzielen – indem sie in die Dienstleistungen investieren, anstatt in kostspielige und langfristige Bergbauprojekte.
Der Handel über Finanzinstrumente und das Streben nach Rendite prägt die Preise heute stärker, als Angebot und Nachfrage.
Im Vergleich dazu müssen sich Rohstoffländer wie Sambia mit den Produktionsschritten begnügen, die in der Wertschöpfungskette am wenigsten einbringen. Der Wert von Kupfer entsteht in dem Sinne nicht durch den Rohstoff selbst, sondern durch die Dienstleistungen, die es für den Transport und die Zertifizierung braucht.
Wo die Hoheit über die Preise liegt
Finanzmärkte bestimmen heute massgeblich die Rohstoffpreise. Der Handel über Finanzinstrumente wie Derivate und das Streben nach Rendite prägt die Preise gar stärker als Angebot und Nachfrage. Länder, die von Rohstoffexporten abhängig sind, leiden besonders unter Preisschwankungen und können sich kaum gegen Verluste absichern.
Und ohne eine stärkere Regulierung wird dies wahrscheinlich auch so bleiben. Internationale Rohstofforganisationen werden wohl kein Comeback erleben. Um die Rohstoffpreise fairer zu gestalten und Profite dort zu erzielen, wo die reale Wertschöpfung stattfindet, sind andere Lösungen nötig. Lösungen, die nicht zuletzt die sozialen und ökologischen Folgen des Rohstoffabbaus berücksichtigen.
Ein erster Schritt könnte die kürzlich angestossene UN-Steuerkonvention sein. Das erste Mal seit über einem halben Jahrhundert wird damit ein Versuch unternommen, weltweite Steuer- und somit auch Gewinnverteilungsvorschriften neu zu verhandeln.
Loriana Crasnic im Gespräch mit dem Podcast Hörkombinat:Politik
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?