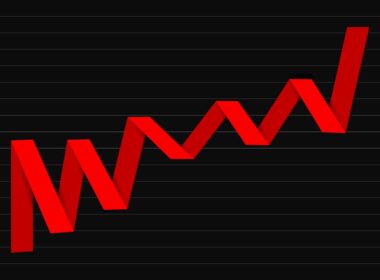„Zu teuer? Wir machen was“, versprach Denner im März. Wer ein Föteli mit #zuteuer auf Facebook, Instagram oder Twitter teilt, kriegt das Produkt mit etwas Glück günstiger oder gar gratis. Martina K. aus Balsthal etwa postete auf zuteuer.ch ihren Abendeinkauf mit dem Titel „5‑köpfige Familie; Lebensmittel zu teuer“ und erntete dafür 177 Likes, die zustimmen: „Ja, das ist zu teuer“. Dislikes erhält dieser Post lediglich 3. Für Denner eine gelungene Aktion, die sich der Discounter zum 50sten Geburtstag leistet, um dem Geiz-ist-Geil-Lebensgefühl wieder etwas Puste einzuhauchen.
Im Mai lancierte Denner dann die nächste Kampagne. Diesmal prangte auf den APG-Plakaten der Schriftzug „Fair zu den Bauern“, während im Hintergrund ein musealer Traktor in den Sonnenuntergang knatterte. Mit der Kampagne verspricht Denner den Bauern faire Preise. Und den KonsumentInnen, dass sie ohne schlechtes Gewissen die Günstigstprodukte im Laden kaufen können. Ist das nicht ein Widerspruch? Kann Denner tatsächlich Lebensmittel in seinen Läden feilbieten, die für die KonsumentInnen billig und für die Bauern einträglich sind?
Könne man, schreibt Denner auf Nachfrage: Dank der „strategischen und langfristigen Zusammenarbeit mit IP-Suisse“ seien „Existenzen in der Landwirtschaft für heute und künftige Generationen“ gesichert. Zugleich könne Denner „dank schlanken Strukturen und optimierter Logistik die Verkaufspreise tief halten.“
Konkrete Milchpreise für seine als „fair“ beworbenen IP-Suisse-Milchprodukte will Denner aber nicht nennen. „Aus wettbewerbstechnischen Gründen“. Die einzige Zahl, die Denner preisgibt: Auf IP-Suisse-Wiesenmilch erhalten die Bauern einen Zuschlag auf den Grundpreis von 4 Rappen pro Kilogramm Milch. Reichen diese vier Rappen, um „Existenzen in der Landwirtschaft“ zu sichern?
Alle wollen sie fair sein. Niemand ist es.
Wir haben nachgerechnet. Das Fazit: Vier Rappen reichen nie und nimmer. Schlicht, weil der Grundpreis für die Milch mit 60 Rappen (Durchschnitt 2015) pro Kilo viel zu tief ist. So tief, dass er die effektiven Produktionskosten niemals deckt. Laut der Bauerngewerkschaft Uniterre betragen die in der Talzone 98 Rappen, in der Bergzone können sie bis auf 164 Rappen pro Kilo ansteigen. Die 4 Rappen pro Kilogramm Aufschlag reichen also selbst dann nicht, wenn man noch 20 Rappen Direktzahlungen dazurechnet, die ein Milchbauer in der Schweiz vom Bund erhält. Deshalb haben von den 50‘000 Milchbetrieben 1990 nicht einmal die Hälfte überlebt.
Die verbleibenden Milchbauern haben sich mit zwei Strategien über Wasser gehalten. Die eine besteht darin, das Land jener Bauern dazuzupachten, die bereits aufgegeben haben, und gleichzeitig auf Hochleistungskühe mit Kraftfutterzukäufen aus dem Ausland zu setzen. Heute produzieren die verbliebenen 21’000 Schweizer Milchbetriebe mit 3,5 Millionen Tonnen Milch pro Jahr sogar 0,5 Millionen Tonnen mehr Milch als die 50’000 Betriebe im Jahr 1990. Einfach industriell.
Die andere, weitaus wichtigere Strategie heisst Selbstentbehrung. Bei einem Arbeitspensum, das Chefärzten und ‑ärztinnen in nichts nachsteht, schafft es das unterste Viertel der Bauern in der Talzone (Milch‑, Fleisch- und Ackerbauern zusammengenommen) auf einen Stundenlohn von 6.30 Franken pro Stunde (Agrarbericht 2016). In der Bergzone sind es noch 4.60 Fr/h, in der Hügelzone dazwischen gar nur noch 4.30 Fr/h. Ein Viertel der Bauern gibt an, nie Ferien machen zu können. Entweder, weil sie wegen der Milchkühe nie weg können. Oder weil sie das Geld dazu nicht haben.
Da von „fairen“ Preisen für Bauern zu sprechen, grenzt an Hohn. Zum Hohn gesellt sich aber noch Heuchelei: Denn die Dumpingpreise vermögen es insbesondere nicht, jene „Existenzen” zu sichern, die das Denner-Plakat mit seiner Bauernhofromantik bewirbt. Bei solchen Preisen können höchstens Industriebetriebe mit Melkrobotern und Hochleistungskühen mithalten. Kleine Bauernhöfe, die über regionale Vertriebsnetze eine ökologische Versorgung mit Lebensmitteln gewährleisten könnten, dürfen bloss noch als hübsche Sujets für Milchpackungen und in Werbespots hinhalten.
Aber Denner ist nicht alleine. Aldi hat jüngst eine „Fair Milk” lanciert, die dem Bauern satte 70 Rappen pro Kilogramm Milch verspricht. Der deutsche Discounter hat damit Denner überholt, der auf den Migros-Preis von 60 Rappen die 4 zusätzlichen IP-Suisse-Rappen verspricht. Obwohl alle, jüngst auch Coop, beteuern, sich zu einem “fairen Milchpreis” zu bekennen — wir sprechen hier von Wermutstropfen. So redlich auch die Absicht hinter den Milchpreiserhöhungen gewesen sein mögen, sogar die hohen 70 Rappen ergeben einen Stundenlohn von bloss 5 Franken, wie die Bauerngewerkschaft Uniterre vorrechnet. Sie stellt fest: Eine „missbräuchliche Produktbeschreibung”. Von fair darf also nicht einmal beim Höchstbietenden Aldi (!) die Rede sein. Von Migros und Coop, die sich sogar hinter Denner einreihen, ganz zu schweigen.
Ausgelaugte Bauern und volle Ladenkassen haben System.
Die Heuchelei und der Hohn der Kampagnen sind Symptome eines tieferliegenden Problems. Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick auf das grosse Ganze werfen: Die Nahrungsmittelindustrie bzw. die Detailhändler. Dann erkennt man: Denner, der kleine Discounter, hat sich nur gerade etwas laut in die Nesseln gesetzt. Denn es sind vor allem grosse Marktakteure wie Emmi, Coop und Denners Mutterkonzern Migros, die in den letzten 27 Jahren kräftig auf die Preise gedrückt haben.
Anders als die einzelnen Bauern sind die Verarbeiterbetriebe und Detaillisten gut organisiert. Zusammen mit den von ihnen geförderten Deregulierungen des Lebensmittelmarkts (u.A.: Liberalisierung des Käsemarkts mit der EU im Jahr 2007 und die Aufhebung der Milchmengenbeschränkung im Jahr 2009) haben sie es geschafft, die Abnahmepreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Schweiz seit 1990 um über 30 Prozent zu drücken. Das müsste für Schnäppchenjäger eigentlich eine gute Nachricht sein. Aber im selben Zeitraum sind die Preise für die KonsumentInnen in der Schweiz um 12 Prozent gestiegen:
Wie haben es die Detaillisten geschafft, trotz massiv tieferer Einkaufspreise bei den KonsumentInnen 12 Prozent mehr abzuschöpfen? Das Zauberwort heisst „Preisdifferenzierung“. Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker und Milch in Standard-Linien bieten die Detailhändler nach wie vor günstig an. Denn das Kilo Mehl, der Liter Milch, die 100g Greyerzer — das sind Referenzgrössen, die man sich als Kunde oder Kundin merken kann. Dort haben Migros und Co., ihre Margen beibehaltend, die Preisreduktionen weitgehend an die KundInnen weitergegeben. Dass die Essenseinkäufe trotzdem teurer geworden sind, liegt an den „Sonderprodukten”, die einen Mehrwert versprechen. Meisterin im Fach Preisdifferenzierung ist Denners Mutter Migros:
Bei der Heidi-Milch wirbt sie mit Bildern, die eine Berglandwirtschaft zeigen; eine Alp, von der die Milchfässer noch zu Tale gerollt werden. Für den Mehraufwand, also vor allem für das teure Marketing und das teurere „Einsammeln” der Milch, entschädigt sich die Migros grosszügig: Die Heidi-Vollmilch ist mit 1.70 Fr. für eine Literflasche satte 60 Rappen teurer als ihre Valflora-Schwester (1.10 Fr. für einen Liter Vollmilch). Das perfide an der Sache: Der Bergbauer erhält für das Heidi-Bild auf der Flasche keinen Rappen mehr für seine Milch — sondern, dem Markt sei dank, verlässlich sinkende Preise: von 1.35 Fr. pro Kilogramm Milch 1990 über 77 Rappen 2004 (Markteinführung Heidi-Milch) bis zu 62 Rappen im Jahr 2015 (Durchschnittspreise Milchstatistiken, Preisniveau 2015).
Bei Denners neuer IP-Suisse-Wiesenmilch, die nur 1.30 pro Liter Vollmilch kostet, erhält der Bauer immerhin 4 Rappen mehr. Und die Natur einen ökologischen Mehrwert. Denner verneint auf Rückfrage allerdings nicht, dass auch bei ihnen eine miniaturisierte Preisdifferenzierung greifen könnte, sondern schreibt: „Denner macht aus wettbewerbstechnischen Überlegungen keine Angaben betreffend Margen.”
Ein weiteres Beispiel sind die „Spezialbrote“. Während beim Ruchbrot, das in der Migros 2.20 Fr. pro Kilogramm kostet, noch 50 Rappen an den Bauern gehen, der den Weizen wachsen lässt, sind es beim Gourmetbrot ebenfalls 50 Rappen. Nur, dass dieses 8.75 Fr. pro Kilogramm kostet. Was die Migros geschickt dadurch tarnt, dass das Gourmetbrot 400g statt 500g schwer ist. Wer weiss schon, wie man von 400g auf 1000g kommt? Die paar Körnli darauf können jedenfalls diesen saftigen Preisunterschied zwischen Gourmetbrot und Ruchbrot nicht rechtfertigen.
Wir bezahlen also vor allem „mehr“, weil geschickte ProduktentwicklerInnen und WerberInnen uns „bessere“ Produkte aufschwatzen. Selten nur tröpfelt dieser Mehrwert nach unten zum Bauern, der sich zu einem kümmerlichen Lohn abrackert. Dabei würde es uns gar nicht mehr kosten, faire Preise zu zahlen. Es würde reichen, einen Teil des Mehrwerts, den heute die Detaillisten einstreichen, wieder an die Bauern zurückzugeben. Oder ein klein wenig mehr zu bezahlen, auch in Discountern, damit auch der Bauer noch etwas von der Milch hat. Und nicht nur die Marketing-Abteilungen von Migros, Denner & Co., die mit Kampagnen wie #zuteuer um Kundschaft buhlen.
Sind unsere Lebensmittel wirklich #zuteuer?
Das gravierende Problem an Denners Marketingfehltritt ist nicht einmal der offensichtliche Widerspruch zwischen fairen Preisen für die Bauern und Tiefstpreisversprechen an die KonsumentInnen. Sondern, dass diese Kampagne den Eindruck verschafft, dass wir zu teuer einkaufen müssen.
Dabei bezahlen wir trotz der 12-prozentigen Preiserhöhung seit 1990 gar nicht viel für unsere Lebensmittel. Mit durchschnittlich 7 Prozent unseres Einkommens geben wir nach den NorwegerInnen im europaweiten Vergleich am zweitwenigsten für unser Essen aus. In Genf muss man im Schnitt 7 Minuten arbeiten, um sich ein Kilo Brot kaufen zu können. In Paris sind es 15 Minuten, in Rom 17 Minuten. Und in Zürich kann man sich mit derselben Arbeitszeit doppelt soviel Milch kaufen wie in Paris.
Würden die Bauern statt 60 Rappen 1 Franken pro Liter erhalten, wie es Uniterre seit Jahren fordert, könnten wir uns immer noch mehr Milch kaufen als die PariserInnen. Auch, wenn die Detaillisten ihre saftigen und die Discounter ihre schmalen Margen beibehalten. Mit dem Unterschied, dass sich dann auch die Bauern ihre eigene Milch wieder leisten könnten. Sogar, wenn sie ihre Milch als Heidi-Milch in einem Migros-Regal wiederfänden. Beispielsweise in den Ferien im Wallis, die nun wieder drinliegen würden — um sich von den 55-Stunden-Wochen erholen zu können.
Was Denner dazu sagt
Denner weist den Vorwurf zurück, mit der #zuteuer-Kampagne auf die Lebensmittelpreise zu drücken: Es sei im Rahmen der Jubiläumskampagne den KundInnen überlassen worden, etwas als „zu teuer” auszuweisen. Oder eben nicht. „Sollte dabei herauskommen, dass es Konsumenten gibt, denen (Schweizer) Lebensmittel zu teuer sind, ist das leider die Bestätigung der von Ihnen erwähnten Tatsache bezüglich dem sinkenden Wert, der den Lebensmitteln in der heutigen Gesellschaft beigemessen wird, aber sicherlich keine durch die Jubiläumskampagne von Denner in irgendeiner Form beabsichtigte oder herbeigeführte Reaktion”, bedauert Denner. Ein schwacher Trost für Bauern.
Natürlich trägt nicht Denners #zuteuer die alleinige Schuld am Milchdesaster. Der Eintritt von Discountern wie Aldi und Lidl in den Schweizer Markt, der Einkaufstourismus in Nachbarländer und die erwähnten Deregulierungen tun das ihrige dazu. Aber mit einer Geiz-ist-Geil-Kampagne kultivieren sie eine Mentalität, in der das Essen immer noch „zu teuer” ist — obwohl der Ländervergleich nahelegt, dass unser Essen „billig” ist. Zu billig. Denn bei den Bauern, die die Knochenarbeit buckeln, kommt fast nichts mehr an.
Denner betont weiter, dass seine #zuteuer-Kampagne dem Bauernstand nicht schade, sondern sogar nütze. Und das geht so: Dank ihrer schlanken Unternehmensstruktur und den tiefen Margen gelinge es ihnen, einen Teil des 10 Milliarden Franken schweren Einkaufstourismus zu unterbinden und so Geld in die Schweiz zurückzuholen. „Geld, das den Bauern, den Produzenten und dem Detailhandel entgeht. Alle sitzen im gleichen Boot.”
Vielleicht kann Denner mit seinen tiefen Preisen tatsächlich einem Teil der EinkaufstouristInnen das Schweizer Joghurt wieder schmackhaft machen, ja sogar das ökologisch sinnvollere IP-Suisse-Wiesenmilch-Joghurt. Auch jenen KundInnen, die nicht einfach aus Lust „preisaffin” sind, sondern die tatsächlich ein knappes Budget haben. Das ist ja auch ein redliches Ziel. Aber ob auch der Bauer mit den 4 Rappen mehr meint, im selben Boot wie alle zu sitzen, wenn sein Stundenlohn die Fünflibermarke nicht zu sprengen vermag? Dafür bräuchte es schon ein gewichtigeres monetäres Bekenntnis zu den Bauern. Nicht nur von Denner, sondern von allen Detaillisten und Discountern.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 21 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1352 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 735 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 357 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?