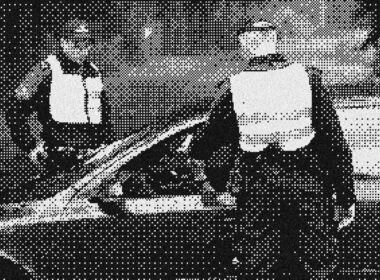„Wir dulden keine Islamisten”, betitelte der SP-Regierungsrat Mario Fehr seinen Gastkommentar in der NZZ zum Anschlag in Wien. In diesem zeichnet er ein Bild eines jüdisch-christlichen, moralisch erhabenen ‚Wir’, welches sich von einem islamistischen ‚Anderen’ bedroht sieht. Um die vermeintliche Harmonie zu erhalten, schlägt er eine rassistische Politik der Ausgrenzung vor.
Am 2. November fielen die ersten Schüsse des islamistischen Anschlags unweit der Wiener Hauptsynagoge. Nach aktuellen Kenntnissen und entgegen ersten Meldungen war die Synagoge aber nicht Ziel des Angriffs und es ist kein antisemitisches Motiv ersichtlich. Dies hinderte Fehr nicht daran, die Angst und Verunsicherung zu nutzen, um sich als höchsten Beschützer der jüdischen Minderheit in Zürich vor islamistischem Terror zu gerieren. Wie er sagte, nahm man den Anschlag in Wien zum Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen der jüdischen Gemeinden in Zürich zu überprüfen und zu verstärken.
Damit bedient sich der Vorsteher der Zürcher Sicherheitsdirektion einer gefährlichen Argumentationsstrategie: Er instrumentalisiert die jüdische Bevölkerung für rassistische Ausgrenzung. Unter dem Vorwand, jüdische Gemeinden schützen zu wollen, fordert er vom Bund unter anderem, „dass Ausschaffungen in Länder wie Algerien und Marokko endlich wieder möglich werden”. Wir, als Teil der jüdischen Bevölkerung Zürichs, bekommen in Fehrs Weltbild die Rolle der stillen, schutzbedürftigen Opfer.
Rechtsextreme Gewalt bleibt in Fehrs Kommentar unbeachtet. Obwohl diese sowohl jüdische als auch muslimische Menschen bedroht. Im Gegenteil, sie wird durch den Kommentar befeuert. Sowohl gegen die falsche Konstruktion einer jüdisch-christlichen Harmonie als auch gegen das Heraufbeschwören eines jüdisch-muslimischen Gegensatzes möchten wir uns wehren.
Vergessene Geschichte, neue Weltbilder
Wir begrüssen es, dass religiöse Einrichtungen zusätzlich geschützt werden, besonders jene religiöser Minderheiten. Noch im November 2016 liess der Bundesrat verlauten, der Bund sei nicht dafür zuständig, finanziell für die Sicherheit jüdischer Einrichtungen aufzukommen. Stattdessen empfahl die Landesregierung den jüdischen Gemeinden – wie die NZZ schreibt: „lapidar” –, zur Deckung der Sicherheitskosten eine Stiftung einzurichten.
Fehr hat recht mit seiner Warnung, die Schweiz ist keine Insel in Europa. Er selber positioniert sich mit seinem Text in einem europaweiten Diskurs, der die Ausgrenzung der muslimischen Bevölkerung über den Kampf gegen Antisemitismus rechtfertigt. Fehr suggeriert zwar Verständnis für jüdische Erfahrungen, stärkt aber vor allem antimuslimische Ressentiments. Er reiht sich damit ein in eine lange Liste rechter und rechtsextremer Organisationen, die versuchen, aus islamistischem Terror Profit zu schlagen – für eine rassistische Politik der Ausgrenzung. Dafür schiebt er den Schutz der jüdischen Bevölkerung vor.
Die Autoren
Max Arendt und Benjamin Kaufmann sind Gastautoren. Sie wuchsen beide in säkular jüdischen Familien auf, leben und arbeiten in der Stadt Zürich.
Als Basis der Hetze dient eine angebliche jüdisch-christliche Leitkultur. Diese Idee bekam in den letzten Jahren in weiten Teil Westeuropas grossen Aufschwung. So sagte Österreichs Bundeskanzler Kurz kürzlich: „Europa ohne Juden ist nicht mehr Europa.” Das stimmt. Doch schön ist die Geschichte der jüdischen Menschen in Europa nicht. Als hätte man vergessen, dass in Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden im Holocaust zwischen 30 % und 50 % der jüdischen Menschen ermordet wurden. Von jenen, die überlebten, verliessen viele Westeuropa. Es ist heuchlerisch, das jüdisch-christliche Zusammenleben in Europa als grundsätzlich harmonisch zu beurteilen.
Die jüdische Bevölkerung wurde in diesen Ländern vor allem aus zwei Gründen wieder zahlreicher: Zum einen mussten kurz nach Ende des Holocausts viele jüdische Osteuropäer:innen vor Pogromen flüchten; zum anderen nahm Deutschland nach dem Zerfall der Sowjetunion Tausende jüdische „Kontingentflüchtlinge” auf, um sich nach den Verbrechen des Holocausts zu rehabilitieren.
Erica Zingher, die als Kontingentsgeflüchtete aus Moldau nach Deutschland kam, verwendet in diesem Zusammenhang in der taz den Begriff der „Wiedergutmachungsjuden”. Zingher zufolge sei damals erwartet worden, dass durch jüdische Immigration jüdisches Leben in Westeuropa repariert werden könne. Auch Kanzler Kurz scheint diese Vorstellung zu teilen. Als ob jüdische Menschen eine einheitliche Masse wären, die sich beliebig austauschen liesse.
Die Rede von der jüdisch-christlichen „Leitkultur” ist rehabilitierend und ausgrenzend zugleich. Wer von ihr spricht, will sich von explizitem Antisemitismus abgrenzen und stärkt rassifizierte Feindbilder. So wie Fehr die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung Zürichs missbraucht, reproduziert er diese Argumentationsmuster und verdeutlicht damit die Nähe der Schweiz zum Diskurs in Deutschland oder Österreich.
Als jüdische Personen fühlten wir uns zusätzlich betroffen, als es hiess, die Wiener Hauptsynagoge sei das Anschlagsziel gewesen. Tatsächlich wird angenommen, dass der Täter das Wiener Ausgehviertel als Tatort aussuchte, weil es am Vorabend des Corona-Lockdowns besonders belebt war. Die Synagoge war zum Zeitpunkt des Attentats längst geschlossen. Aber scheinbar reicht die zufällige geographische Nähe eines islamistischen Anschlags zu einer Synagoge, um Antisemitismus zu wittern und zu twittern. Jüdische Menschen werden als Opfer gedacht und instrumentalisiert.
Die Gesellschaft des „Abendlands“ als Gefahr
Dabei setzte sich der Vorsteher der Sicherheitsdirektion in der Vergangenheit kaum öffentlich für die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung ein. Insbesondere versäumte er es bei rechtsextremer Gewalt: Als ein Rechtsextremer 2019 am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in der Stadt Halle mithilfe von Handgranaten in eine Synagoge eindringen wollte, waren diesbezüglich keinerlei Kommentare vom SP-Politiker in der Zeitung zu lesen. Aber nun nutzt Fehr ohne Weiteres jüdische Menschen als angeblich schweigende Opfer und befeuert gleichzeitig gesellschaftlichen Rassismus.
Dabei ist die Gefahr eines rechtsextremen Anschlags auf jüdische Institutionen real, wie der Antisemitismusbericht 2019 der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds festhält und verschiedene Vorkommnisse zeigen. So wurde 2015 in Zürich ein orthodoxer Jude von bekannten Neonazis aus Hombrechtikon angegriffen. Islamistisch motivierte Angriffe kämen hingegen vor allem im Internet vor. Doch von jüdischer Hand mitverfasste Risikoberichte passen nicht zur Erzählung, dass Muslim:innen das ansonsten friedliche jüdisch-christliche Abendland stören würden.
Der Gastkommentar von Mario Fehr spielt in einen vielschichtigen Diskurs, in dem es um vieles geht, jedoch nicht um das Wohlbefinden jüdischer Menschen. Er instrumentalisiert die jüdische Bevölkerung und konstruiert so einen Gegensatz zwischen einem vermeintlich zivilisierten Selbst und einem gewalttätigen muslimischen Anderen. Heute dürfen jüdische Menschen auf Kosten muslimischer Menschen an der Gesellschaft teilnehmen. Doch das wollen wir so nicht. Als jüdische Menschen fürchten wir nichts mehr als die Fortsetzung der europäischen Vergangenheit. Denn diese lehrt uns, dass rassistische Hetze in gesellschaftlichen Krisen stets alle rassifizierten Minderheiten betrifft.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 23 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1456 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 805 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 391 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?