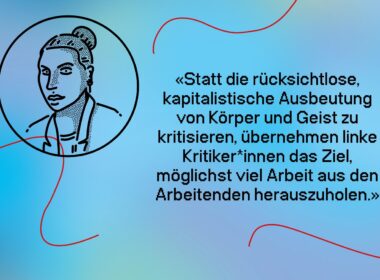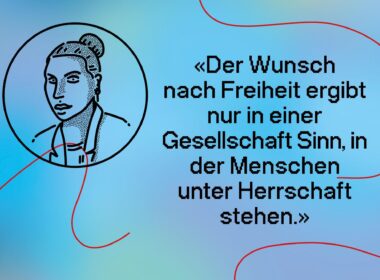An Literaturinstituten studieren vor allem „Lehrerkinder und Ärztekinder“. Das zumindest hat Hanser-Lektor Florian Kessler im Januar 2014 in einem Kommentar in der ZEIT geschrieben. Mit seinem Text hat die Klassenfrage Einzug in die deutschsprachigen Schreibschulen in Hildesheim und Leipzig, in Wien und Biel erhalten. Die Frage danach, wer an den renommierten Instituten das Schreiben lernen darf – und wer nicht.
Und jetzt, zehn Jahre später? Wie studiert es sich ohne viel kulturelles Kapital an einer Universität, die den Ruf hat, hauptsächlich Institutsprosa hervorzubringen – also eine Art zu Schreiben, die sich vor allem an Literaturpreisjurys richtet? Wie studiert es sich für Leute, die aus anderen Gründen bisher unterrepräsentiert sind im Literaturkanon, jenseits des heteronormativen Blicks etwa?
Vier Studierende berichten von ihren Erfahrungen am Literaturinstitut Hildesheim.
Franziska: „Das Literaturinstitut nenne ich die schwarze Rollkragenwelt“
„Zugehörigkeit beschäftigt mich schon mein ganzes Leben lang – egal, wo ich bin. Ich habe diesen Wunsch dazuzugehören. Das ist am Literaturinstitut noch schlimmer geworden. Am Anfang habe ich mich gewundert, warum ich mich so fremd fühle und habe das einfach auf das Studium geschoben, das System Universität an sich. Das ist eine Welt, die weder mir bekannt ist, noch hat je jemand in meiner Familie studiert.
Ich habe den Eindruck, dass am Literaturinstitut nochmal andere Codes herrschen. Wenn ich mal am Hauptcampus bin, habe ich das Gefühl, da komme ich entspannter klar. Das Literaturinstitut nenne ich die schwarze Rollkragenwelt. Mittlerweile habe ich auch einen schwarzen Rollkragenpulli. Aber am liebsten trage ich ihn mit meiner bunten Adidasjacke, die ich auf ’nem Hip Hop-Flohmarkt gekauft habe, weil das für mich die beiden Welten verbindet. Dann fühle ich mich wohl, weil ich einen Teil meiner Identität gefühlt weiterhin mitnehme. Und nicht verrate.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass mein biografisches Schreiben nur baukastenmässig besprochen wird – dass es nur um Form und nicht um Inhalt geht. Dann habe ich den Eindruck, in eine Schublade gesteckt zu werden. Ich will von den Leuten nicht hören, wie mutig ich bin und wie krass es ist, dass ich das erlebt habe. Also ich finde es krass, dass ich an der Uni bin und Schreiben studiere. Ich werde zwar positiv aufgenommen, aber gleichzeitig auch immer als anders gelabelt.
Das Institut ist bildungsbürgerlich und reproduziert dabei einen akademischen Habitus. Ich habe schon den Eindruck, dass es ein Verständnis für soziale Herkunft gibt. Aber wie soll man etwas verstehen, das man nicht erfahren hat? Und auch diese Ausgrenzung nicht kennt und wie es ist, sich in gewissen Räumen zu bewegen und Raum einzunehmen?
Es ist ja schön, wenn es ein Bewusstsein für soziale Dinge gibt, aber die Strukturen dahinter haben sich ja nicht geändert. Ist ja schön, dass man hier auch ohne Hochschulzugang studieren kann, aber auf wie viele Leute trifft das zu? Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es immer noch die gleiche Sache.
Es geht in der Mehrheit der Texte in den Werkstätten um nichts Wesentliches. Da gibt es Ausreisser, aber oft wabern Texte vor sich her. Dann machen die Autor*innen ein, zwei Dinge auf, wo sie sich und anderen beweisen, dass ihre Texte eine Berechtigung haben, aber letzten Endes geht es oft um nichts. Es muss nicht immer um Leben und Tod gehen, aber es fehlt mir schon, dass die Autor*innen ihre Texte wichtig und sich selbst weniger wichtig nehmen.
Es sind viele vorgezeichnete Wege, die hier ans Institut führen. Ich weiss, dass wir Menschen am Institut haben, deren Eltern Lektor*innen sind, die in Verlagen oder im Theater arbeiten. Und da ist es eben logisch, dass deren Kinder auch in den Kulturbereich gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Ausreisser als früher gibt, aber überwiegend reproduziert sich das Milieu, das im Kulturbetrieb und dadurch auch an den Schreibschulen ist, selbst.
Ich habe den Eindruck, dass es heute politische Texte gibt, aber das sind Themen, die eher dem woken Schreiben entsprechen. Themen, die meine Bubble beschäftigen, also Geschlechtsidentität, Rassismus, Homo- und Transphobie. Ich möchte den Menschen ihre Notwendigkeit nicht absprechen, und manchen Texten merke ich das auch an, eine Dringlichkeit. Aber da gibt es dann auch welche, die wabern: Da wird das aufgenommen, habe ich den Eindruck, damit das in der Textbesprechung als ein politischer Text verhandelt wird.”
Franziska Bothe, 31, studiert kreatives Schreiben und Kulturjournalismus.
Jan: „Da, wo vorher Ästhetik war, ist jetzt politische Ästhetik“
„Mit der Frage ‚Wie schreibe ich über etwas?’ wird sich in Hildesheim nicht auseinandergesetzt. Dafür wird intensiv über Stil geredet, was ja auch genau das ist, was manche Verlage und Wettbewerbe wollen. Es geht darum, dass alles eine tolle Sprache haben muss. Es gab während meines Studiums einmal einen Kurs zu politischem Schreiben, wo es darum ging, welche Form politisches Schreiben haben kann. Es ging nicht darum, was für Inhalte, nicht darum, worüber wir schreiben sollten. Es ging um die Form, um Rede und sowas. Es war ein einziger Kurs in insgesamt sechs Jahren Studium.
Zur Form gab es jedes Semester Kurse: der Ich-Erzähler. Die Popliteratur. Wie schreibt Roland Barthes. Und die Übungen liefen nach dem Schema: ‚Okay, ihr habt jetzt diesen Text gelesen, schreibt etwas, das so klingt.’ Es gab keine Auseinandersetzung mit den Inhalten. Ich habe ein Seminar zum Thema „über Klasse schreiben“ besucht. Ich weiss noch, eine Kommilitonin und ich haben während des Seminars festgestellt, dass wir beide aus der Arbeiter*innenklasse kommen. Wir haben hin- und hergeschrieben über das Seminar, weil wir bemerkt haben, dass ein paar Akademiker*innen darüber sprechen, wie man sich das Thema für sein Schreiben aneignen kann.
Als ich 2014 angefangen habe, gab es eine feste Dozentin, ansonsten nur Männer. Und fast alle waren alte Garde, oder Leute, die selber an den Schreibschulen studiert und dann dort mit dem Unterrichten angefangen haben. Bis die ersten anderen Stimmen reinkamen hat es Jahre gedauert. Die Mitstudierenden, von denen ich weiss, waren Professor*innen-Kinder, oder Kinder von Ärzt*innen, Autor*innen oder Dramaturg*innen.
Wenn es zu meinem Studienbeginn Arbeiter*innenkinder gab, dann haben die sich angepasst. Bei mir war es auch so. Ich habe meine Freizeit damit verbracht, Wissen aufzuholen, damit ich mitreden kann und nicht auffalle. Ich hatte zu Anfang keine Ahnung, wer die Autor*innen waren, über die die anderen sprechen.
Diese Anfänge waren schwer. Als ich dann im Master war und Eribons „Rückkehr nach Reims“ kam, als Édouard Louis, Daniela Dröscher, Annie Ernaux und Christian Baron anfingen, über Klasse zu schreiben, hat sich langsam was getan. Da hat man das Gefühl bekommen, man ist nicht alleine. Es gibt andere Leute, die auch etwas zu sagen haben.
Seit ein paar Jahren kommen zum Unterrichten öfter Leute von Aussen mit ihren Themen rein. Und das zwingt das Institut zu Veränderungen. Selbst, wenn sich das Institut die Themen nur token-mässig reinholt, sind es Themen, die eigentlich nur funktionieren, indem sie die Strukturen kritisieren. Aber das ist oft nicht der Fall. Da, wo vorher Ästhetik war, ist jetzt politische Ästhetik. Aber oft steckt nicht viel dahinter. Natürlich gibt es vereinzelt Studierende, bei denen es keine Show ist.
Ich glaube, dass viele Institutionen der Literatur wissen, dass jetzt Themen kommen, die behandelt werden müssen. Auch am Institut herrscht dann der Gedanke, wir bringen da mal Leute rein. Und das ist tokenism. Oft holen sie Studierende rein, die oberflächlich über diese Themen wie Identität, Rassismus und so weiter schreiben. Und die eine Person, die es ernst meint, diese eine von vielleicht zehn Personen, die rutscht durch. Die stellt sich dann als nicht tokenisierbar heraus, weil sie es wirklich einfach ernst meint.
Ich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen Schreibschulen, dem Feuilleton und dieser ganzen Preis- und Stipendien-Politik. Niemand in Hildesheim denkt wirklich daran, dass sich ein Buch auch verkaufen muss. Da ist oft der Gedanke: Ich habe doch so einen krassen Stil, warum wollen die ’ne Geschichte haben, was ist denn das? Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man über diese Sachen redet an den Schreibschulen.”
Jan Thul, 31, hat Literarisches Schreiben und Lektorieren im Master studiert.
Marco: „Dass Texte Konsequenzen haben, scheint vielen nicht klar zu sein“
„Mir ist eine Situation in Erinnerung geblieben. Das war in einem Seminar: Man konnte da Filme machen oder ein Hörspiel. Zu der Zeit habe ich mit der Arbeit am Roman angefangen, der jetzt im Frühjahr erscheint. Ich habe den Dozenten gefragt, ob ich den Prolog des Romans auf Tonband sprechen kann, um ihn dem Seminar vorzuspielen. Es war das erste Mal, dass ich mich offen als Arbeiterkind zu erkennen gegeben habe – als jemand, der phasenweise in Armut aufgewachsen ist.
Eine Reaktion kam von einer Person, von der ich dachte, dass sie aus einer Akademikerfamilie kommt, da sie sich immer so gegeben hat. Aber wie ich ist sie manchmal von ihrer Mutter mit dem Auto von der Schule abgeholt worden, und das war kein schickes Auto. Sie ist deswegen gehänselt worden, genau wie ich. Das hat sie als Reaktion auf meinen Text total aufgelöst erzählt. Sie hat sich mit mir zusammen zu erkennen gegeben; das hat mich berührt und in meinem Schreiben bestätigt.
Eine andere Reaktion war für mich aber fast noch spannender. Das war das Schweigen einer Person, von der ich weiss, dass sie aus dem Bildungsbürgertum kommt, und die eigentlich zu allen Texten immer etwas zu sagen hat. Rückblickend habe ich gedacht, das grösste Kompliment war, dass sie geschwiegen hat. Vielleicht hat es mir geschmeichelt, weil sie durch meinen Text mit ihren Privilegien konfrontiert wurde. Wenn die soziale Klasse in der Literatur verschriftlicht wird, dann sind die meisten Leute, die in Seminaren sonst immer etwas zu sagen haben, still.
Natürlich verirren sich auch Leute aus Nichtakademikerfamilien ans Institut, aber es sind Einzelfälle. Wenn ich an meinen Bachelorjahrgang zurückdenke, dann haben ganz viele, die nicht aus Akademiker- oder Künstlerfamilien kommen, nach ein oder zwei Semestern aufgehört. Das ist natürlich ein Selbstausschluss, auch durch das Fremdheitsgefühl, das Nichtakademikerkinder am Institut haben. Dann gibt es die, die ihre soziale Herkunft verleugnen und sich anpassen. Und die, die das in sich nachspüren.
In meinem ersten Bachelorsemester wurde uns gleich im Einführungskurs klargemacht, dass es legitim ist, in Unterhaltungsliteratur und ernsthafter Literatur zu unterscheiden. Das wurde vom Seminar nicht weiter reflektiert. Wenn man da als Arbeiterkind sitzt, dessen Zugang zur Literatur über Krimis oder Thriller kommt, dann stellt man sich die Frage, ob das so sein muss. Akademikerkinder sind ja meist mit dieser Trennung aufgewachsen. Und man fragt sich: War das jetzt kompletter Dreck, den ich da gelesen habe? Sollte ich mich davon distanzieren? Da geht schnell eine Spirale der Selbstverleugnung los.
Vielleicht kann man sagen, dass Kinder aus Arbeiterfamilien eher einen inhaltlichen Zugang zur Literatur haben und Akademikerkinder eher einen formalen Zugang. In einer Textwerkstatt war jemand einmal ganz erstaunt, dass ich Sprache als Sprache verwende, als Informationsträger. Und ich sass da und dachte: Ja, als was denn sonst? Nur weil ich da nicht mit Metaphern, Wortspielen und Vergleichen um mich geworfen habe. Dass es Konsequenzen hat, wie ein Text gemacht ist – denn, wie eine Personengruppe dargestellt wird, hat ja Konsequenzen –, scheint vielen nicht klar zu sein.
Im Master ist dann die Frage der Veröffentlichung nicht mehr weit. Die Frage ist: Welche Studierenden haben Zugang oder kommen durch die Dozierenden zu Kontakten, um ihre Manuskripte bei Agenturen und Verlagen unterzubringen? Mit alldem wird sehr heimlich umgegangen, wer jetzt von wem welchen Kontakt bekommen hat. Und da frage ich mich, nach welchen Kriterien die Lorbeeren verteilt werden.”
Marco Ott, 30, studiert Literarisches Schreiben und Lektorieren im Master.
Sophie: „Für dezidiert politisches Schreiben ist in Hildesheim kein Platz“
Ich sehe schon einen Verlauf, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe. Es gab 2017 einen Sexismusskandal, das war noch vor meiner Zeit in Hildesheim. Und dann hat Annette Pehnt das Institut übernommen und ich habe den Eindruck, dass sich dadurch etwas geändert hat. Und auch in meinem Jahrgang habe ich mit Leuten gebondet, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Nicht nur am Literaturinstitut hat sich etwas getan.
Letztens ist mir eine Ausgabe der Bella triste (Hildesheimer Literaturzeitschrift, Anm. d.R.) aus dem Jahr 2014 in die Hände gefallen. Da standen halt lauter Namen wie Thomas Klupp oder Leif Randt auf dem Cover. Da haben fast nur Männer veröffentlicht und kaum Frauen, queere oder migrantische Menschen. Und einige Namen, von denen man weiss, dass die gut situiert sind. Ich hab erst nicht gesehen, dass das eine Ausgabe von 2014 ist und ich war total irritiert von dieser Auswahl an Menschen. Allein, dass diese Reaktionen kommt, zeigt ja schon, dass etwas passiert ist.
Neulich hatte ich ein Blockseminar bei der Autorin Karosh Taha, und sie meinte nach dem Seminar, dass Hildesheim oft Institutsprosa unterstellt wird – also, dass wir keine interessanten Geschichten erzählen. Und sie meinte, dass wir alle total spannende Geschichten ins Seminar gebracht haben. Das war nur eine kleine Runde natürlich, aber ich glaube schon, dass es irgendwo repräsentativ ist.
Ich finde den Generalverdacht gegenüber dem Institut manchmal ein bisschen schwierig. Dass auf Leute ein gewisser Hintergrund projiziert wird, in alle möglichen Richtungen. Ein Privileg ist nicht ein einfaches Thema, das du per se immer an irgendwelchen Markern ablesen kannst. Privilegien sind intersektional und oft individuell unterschiedlich.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich in manchen Themen viel getan hat, aber das Thema Klasse noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Es wird zwar besser, aber ich habe das Gefühl, dass es noch zu oft hintenüberfällt. Ich glaube, andere gesellschaftspolitische Themen haben schon mehr Platz gefunden im Verhältnis zu Klassismus.
Hildesheim ist für mich trotzdem eher ein positives Beispiel, im Vergleich zu den Schreibschulen in Wien oder Leipzig. Ich habe das Gefühl, dass die anderen beiden Institute denken, sie haben den besseren Ruf. Das kommt aus einem elitären Kunstverständnis heraus, das sich einzig und allein auf Hochkultur versteht. Das ist in Hildesheim weniger so. Hier bekommen auch Leute eine Chance, die nicht den Zugang zum literarischen Kanon haben, der in Leipzig und Wien mehr vorausgesetzt wird.
Ich glaube, gerade in Hildesheim kannst du die Art von Text schreiben, die du willst, und sagen: Diese Art liegt mir viel näher, und dann ist es auch voll okay, wenn so und so viel Institutsprosa produziert wird, wenn der Raum auch dafür da ist, andere Geschichten hervorzubringen.
Für dezidiert politisches Schreiben ist in Hildesheim kein Platz, auch am Literaturinstitut nicht, oder zu wenig. Stattdessen wird vor allem introspektiv gearbeitet und geschrieben. Das heißt, wenn politisch geschrieben wird, dann handelt es sich meist um Identitätspolitisches schreiben, was wichtig und richtig ist. Aber Fragen zu ‚Wie kann ich sensibel und vorsichtig sozialpolitische Fragen in meine Texte einbauen?’ fehlen mir in Seminaren.”
Sophie Romy, 25, studiert Literarisches Schreiben und Lektorieren im Master.
Korrigendum vom 8. 12. 2023: In einer ersten Version der Protokolle hiess es, dass 2014 keine Dozentin am Literaturinstitut tätig war. Das ist nicht richtig und wurde entsprechend geändert.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 30 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1820 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1050 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 510 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?