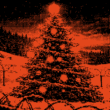Am 18. Juni wird übers Klimaschutz- und Innovationsgesetz abgestimmt. Es geht hauptsächlich um ein Geldpaket, das die Reduktion von Treibhausgasemissionen in der Schweiz fördern soll, insbesondere durch den Ersatz von alten Heizungen und durch klimaschonende Innovationen in der Industrie.
Die Vorlage hat gute Chancen, zu gewinnen: Gemäss gfs.bern sagten Ende Mai 62 Prozent Ja, laut Tamedia waren es zuerst 58 und dann 55 Prozent. Auch einflussreiche Verbände wie Economiesuisse und der Schweizerische Bauernverband haben die Ja-Parole gefasst.
Eine Grundvoraussetzung für diese breite Akzeptanz dürfte sein, dass alles Unbequeme ausgeklammert wurde: keine neuen Verbote, keine neuen Steuern. Es geht nur um Förderung für freiwillige Massnahmen.
Auch das Reizthema Fleisch und der ganze Bereich Ernährung und Landwirtschaft werden im Gesetz nicht erwähnt. Doch bedeutet das auch, dass die Vorlage keine Auswirkungen auf diesen Sektor hat?
Schaut einmal zum Fenster raus, wahrscheinlich seht ihr bald ein Tier. Sie sind die Mehrheit der Bevölkerung. Doch in der Schweizer Medienlandschaft werden sie meist ignoriert. Animal Politique gibt Gegensteuer. Nico Müller schreibt über Machtsysteme, Medien, Forschung und Lobbyismus. Und denkt nicht, es gehe immer „nur“ um Tiere. Ihre Unterdrückung hängt oft mit der Unterdrückung von Menschen zusammen. Animal Politique macht das sichtbar.
Nico Müller hat den Doktor in Tierethik gemacht und arbeitet an der Uni Basel. Daneben setzt er sich politisch für Tierschutz und ‑rechte ein, besonders mit dem Verein Animal Rights Switzerland.
Die Tierzahlen müssen runter
Ganz im Gegenteil, schreibt der Zürcher Bauernverbandspräsident und Nationalrat Martin Haab in einem SVP-Blogbeitrag. Der Milchbauer ist der prominenteste Landwirtschaftsvertreter im Nein-Lager.
Laut Haab ist eine Netto-Null-Schweiz „nur durch einen massiven Abbau der Tierbestände möglich und vielleicht in ferner Zukunft mit einer fossilfreien Mechanisierung”. Für ihn spricht das aber nicht gegen die zu hohen Tierbestände, sondern gegen das Klimaschutzgesetz.
Aus der Luft gegriffen ist der Zusammenhang nicht. Die Landwirtschaft verursacht je nach Rechnung zwischen 12.4 und 14.3 Prozent der Schweizer Gesamtemissionen. Das Bundesamt für Landwirtschaft spricht auf Anfrage sogar von „rund 16 Prozent”, wenn man auch die Emissionen aus Brennstoffen und Böden berücksichtigt. Innerhalb der landwirtschaftlichen Emissionen wiederum sind gemäss Bund gut 85 Prozent der Tierhaltung zuzurechnen.
Haabs Befürchtung: Diese Emissionen könnten bei einem Ja ins Fadenkreuz des Klimaschutzes rücken. Denn für die direkt betroffenen Sektoren werden im neuen Gesetz Reduktionsziele festgelegt – und falls sie diese verfehlen, so spekuliert Haab, wird der Bundesrat weitere Massnahmen suchen, um das Netto-Null-Ziel noch zu erreichen. Da sind die hohen Tierbestände einfach der Elefant im Raum.
Ich frage bei Haab nach: Welche Massnahmen befürchtet er konkret? Vielleicht gibt er mir ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den geplanten Rückbau der Schweizer Tierindustrie.
Andere Subventionen, weniger Tiere
Zurück kommt erst einmal ein gepflegter Rüffel: „Natürlich habe ich ihre Veröffentlichungen kritisch unter die Lupe genommen und sie entsprechen, was Sie sich sicher denken können, überhaupt nicht meinen Wahrnehmungen. Vor allem ihr Artikel über Swissmilk und die Milchkühe strotzt nur so von Denkfehlern.”
Hoffentlich merkt er nicht, dass ich auch über den Fleischverein Carna Libertas geschrieben habe. Da ist er nämlich neuerdings Vorstandsmitglied. Wir sind so etwas wie Anti-Seelenverwandte.
Nachdem er mir die Leviten gelesen hat, gibt er mir aber Auskunft – und das sehr informativ. Zusätzliche Massnahmen des Bundesrats wittert er vor allem im Bereich der Subventionen: „Schon heute wird das Direktzahlungssystem in der Verordnung andauernd angepasst. Unser Betrieb, welcher massgeblich von der Milchproduktion lebt, wird ab nächstem Jahr mit einer Reduktion von über 20 Prozent der Direktzahlungen rechnen müssen.”
Es folge ein Dominoeffekt, erklärt er: „Um die Kürzungen auszugleichen, müssten wir vermehrt Biodiversitätsflächen anlegen oder Extensivierungsmassnahmen im Ackerbau umsetzen. Dies hätte zur Folge, dass klar weniger Futter produziert werden kann und somit unser Tierbestand nach unten angepasst werden muss.”
Die Umverteilung von Subventionen, die Haab hier als Katastrophe schildert, ist ziemlich genau, was die Forschung empfiehlt. Gerade im Mai veröffentlichte das nationale Forschungsprogramm „Nachhaltige Wirtschaft” im Auftrag des Bundes seine Ergebnisse. Empfehlung Nummer eins für den Bereich Landwirtschaft: die staatliche Unterstützung von tier- auf pflanzenbasierte Produktion umverteilen.
Gemäss Haabs Argument wird das Klimaschutzgesetz also indirekt zur Umverteilung von Subventionen führen, dann zur Reduktion der Tierbestände, damit auch zu geringeren Emissionen und zu weniger Tierleid und Tod in Schweizer Schlachthöfen… Klingt fast zu gut, um wahr zu sein!
Ich hake bei der Kleinbauernvereinigung und beim Bauernverband nach: Warum sagt ihr angesichts dieser Prognosen Ja?
Anführen oder Trittbrett fahren
Die Antworten der Landwirtschaftsverbände könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Kleinbauernvereinigung sagt: „Es ist klar, dass die Land- und Ernährungswirtschaft einen Beitrag leisten muss, um die längerfristigen Klimaziele zu erreichen.” Um das Klima zu schonen, müsse die Landwirtschaft standortangepasster werden, so die Co-Geschäftsleiterin Barbara Küttel.
Das heisst: Weniger Futtermittel importieren, weniger Ackerflächen für Tierfutter verwenden, weniger Tiere halten. Dafür werde es Anpassungen brauchen – wiederum fällt das Stichwort Direktzahlungen. Von alledem stehe zwar nichts in der Vorlage, aber ein Ja verleihe den Bemühungen in diese Richtung einen „ganz generell wichtigen Schub”.
Im Endeffekt stimmt die Kleinbauernvereinigung Martin Haab also zu, dass ein Ja zum Klimaschutzgesetz die Landwirtschaft auf indirektem Weg verändern kann. Aber im Gegensatz zu ihm findet sie das gut.
Ganz anders der Bauernverband. Er gibt sich gelassen und betont: „Das Netto-Null-Ziel der Schweiz – das wir übrigens immer unterstützt haben – bedeutet nicht, dass jede Branche Null erreichen muss oder kann.”
Sprecherin Sandra Helfenstein verweist auf die Klimastrategie des Bundes. Darin werden der Landwirtschaft auch 2050 noch 4.1 Millionen Tonnen in CO2-Äquivalenten erlaubt, die dann anderswo ausgeglichen werden müssen. Diese Zahl sei ohne neue Massnahmen erreichbar. Die Rinderbestände seien sowieso im Abwärtstrend, zudem gäbe es bereits vielversprechende Massnahmen in den Bereichen Bodenbearbeitung, Gülle und Fütterung.
Anders als Haab hat der Bauernverband deshalb keine Angst, dass der Bund mit dem Klimaschutzgesetz neue Massnahmen für eine nachhaltigere Landwirtschaft ergreifen wird. Im Gegenteil: Die Landwirtschaft darf weiter emittieren, genau weil andere Sektoren grüner werden.
Und was ist mit dem Konsum?
Fast beiläufig merkt Helfenstein an: „Grundsätzlich macht es keinen Sinn, die Nutztierbestände in der Schweiz deutlich zu reduzieren, wenn der Konsum von Fleisch (und Milch) nicht gleichzeitig im gleichen Ausmass sinkt. Sonst importieren wir einfach mehr.”
Das stimmt. Aber der Konsum von Tierprodukten ist keine unveränderliche Konstante. Er hängt ab von Preisen, von Werbung und von öffentlicher Information – also von Faktoren, die politisch reguliert werden können. Wenn der Bund will, hat er hier einen weiteren Hebel, um die Emissionen der Landwirtschaft zu senken.
Genau das empfehlen die Forschenden des Netzwerks für Nachhaltigkeitslösungen SDSN: Auf emissionsreiche Lebensmittel – also auch Tierprodukte – soll der normale Mehrwertsteuersatz gelten statt der reduzierte. Zölle für Fleisch und Futtermittel sollen hoch. In öffentlichen Kantinen soll das Vegi-Menü immer zuoberst stehen. Für Fleisch fordern sie sogar ein Werbeverbot.
Hinzu kommt das sanfte Mittel der Aufklärung. Wie mir das BLW bestätigt, hat der Bund bereits heute die Kompetenz, über nachhaltige Ernährung zu informieren. So steht es im Umweltschutzgesetz (Art. 10e) und im Lebensmittelgesetz (Art. 24). Einer staatlichen Empfehlung, aus Rücksicht aufs Klima weniger Fleisch zu essen, steht somit eigentlich nichts im Weg.
Man könnte also viel unternehmen, um die Emissionen der Landwirtschaft vom Konsum her zu senken. Nur fehlt bisher der politische Wille, das tatsächlich zu tun.
Abwarten ist unnötig
Ich finde, Martin Haab hat ein Stück weit recht: Es ist unrealistisch, dass sich andere Sektoren für den Klimaschutz verbiegen werden, nur damit wir auch 2050 noch 50 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr essen können. Unfair wäre es auch. Entsprechend müssen wir aber auch nicht abwarten, bis die ersten Zwischenziele verfehlt werden, bevor wir endlich etwas für eine klimafreundlichere Ernährung tun.
Wer es ernst meint mit dem Klimaschutz, stimmt deshalb nicht nur Ja, sondern fordert auch Massnahmen für mehr pflanzliche Ernährung und tiefere Tierbestände. Angefangen mit zwanglosen Mitteln wie öffentlichen Info-Kampagnen und der bevorzugten Positionierung von fleischfreien Menüs. Das wäre doch jetzt eine gute Idee für die grüne Partei Schweiz, die ohnehin Tierrechte fordert!
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?