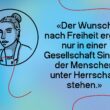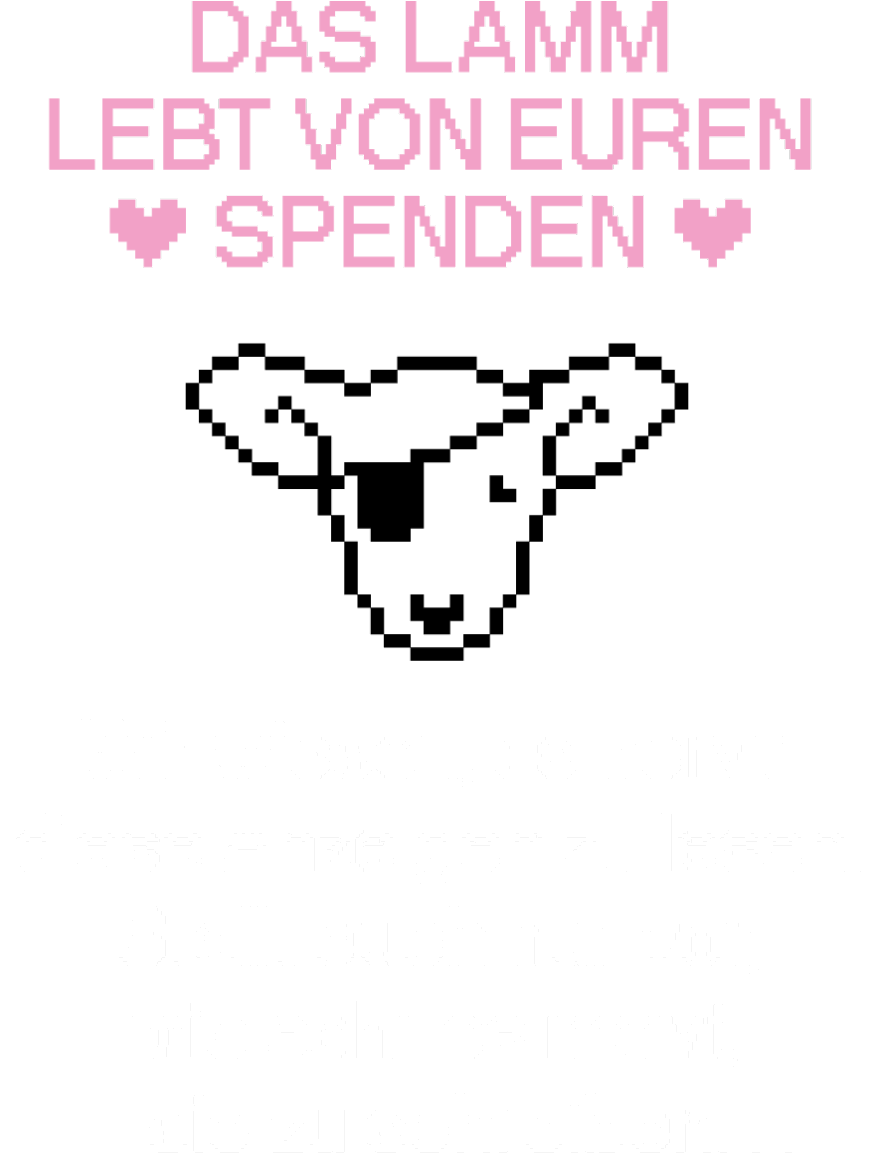„Hört Betroffenen zu!“ ist in vielen links-identitären Debatten rund um Ungleichheit und Diskriminierung ein gängiger Appell. Zunächst klingt diese Forderung völlig einleuchtend – wie könnte man die Lebensrealitäten und Perspektiven anderer verstehen, ohne denjenigen zuzuhören, die direkt davon betroffen sind?
Im Grunde ist das eine Binse: Um andere Erfahrungen nachvollziehen zu können, sind Informationen unverzichtbar. Und wer könnte besser schildern, wie es ist, Rassismus zu erfahren oder als Sexarbeiterin zu arbeiten, als die Menschen, die diese Erlebnisse tatsächlich machen?
Gleichzeitig gilt aber: Betroffenheit allein ersetzt keine fundierte Analyse, denn ein tieferes Verständnis der Sache entsteht nicht allein durch Erfahrung. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Betroffenheit automatisch zu einem tieferen Verständnis der zugrunde liegenden Verhältnisse führt, die diese Betroffenheit hervorrufen.
Ebenso wenig ergibt sich ein richtiges Urteil allein dadurch, dass „Nicht-Betroffene” den Betroffenen aufmerksam zuhören. Betroffenheit allein garantiert keine korrekten Einsichten – das kann nur die richtige Analyse leisten. Aber anstatt sich derer zu bemühen, wird oft gefordert, dass Erklärungen ausschliesslich aus der subjektiven Perspektive derjenigen kommen dürfen, die durch die bestehenden Verhältnisse benachteiligt sind.
Zuhören ist gut
Grundsätzlich sollte man anderen Menschen zuhören, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten – umso mehr, wenn diese von den eigenen abweichen. Das erweitert den Horizont und ist spannend. Gerade in Bezug auf Diskriminierung kann die Perspektive Betroffener helfen, den eigenen Blickwinkel zu erweitern.
So bleiben Männern oft die subtilen, alltäglichen Sexismen verborgen, denen Frauen ausgesetzt sind. Ebenso sollten weisse Menschen die Erfahrungen von People of Color anhören, die über Rassismus berichten. Zuhören eröffnet Einblicke in Lebensrealitäten, die einem sonst verborgen blieben und sind somit grundlegend für die weitere Analyse der Umstände.
Betroffenheit ist kein Argument und Erfahrung ersetzt keine sachliche Analyse.
Diese einfache Erkenntnis führt jedoch oft zu einem folgenschweren Missverständnis: der Annahme, dass Betroffene per se den besten Zugang zur Wahrheit hätten und nur durch die Erfahrung am eigenen Leib das richtige Urteil über die Sache möglich sei. Das geht soweit, dass den sogenannten Privilegierten „Sprechverbote“ erteilt werden: Männer haben die Schnauze zu halten, wenn es um Sexismus geht und weisse Menschen Sendepause, wenn es dem Rassismus auf den Grund gehen soll.
Dass diese Forderung im Widerspruch zu dem häufig nur wenige Augenblicke später geäusserten Appell steht, Nicht-Betroffene mögen sich im Kampf gegen Diskriminierung doch bitte stärker engagieren, scheint nicht aufzufallen.
Analyse ist besser
Die Annahme lautet, dass jemand, der eine bestimmte Erfahrung selbst gemacht hat, diese durch die eigenen Erlebnisse korrekt analysieren und ihre Implikationen aufzeigen kann. Allen anderen bleibt nur die Möglichkeit, durch Zuhören zu dieser Erkenntnis zu gelangen – eigene Einsichten sind nicht möglich. Eine essentialisierende Vorstellung, die sich auch nicht mit der Wirklichkeit deckt. Ein Beispiel:
Die Wahlergebnisse der AfD und anderer rechtsnationaler Parteien zeigen, dass Arbeiter*innen oft genug nicht die tatsächlichen Ursachen ihrer Probleme als Lohnabhängige erkennen. Stattdessen machen sie aus ihrer nationalistischen Perspektive vermeintliche „Schädlinge“ verantwortlich dafür, dass sie in dieser Ordnung trotz aller Anstrengungen stets zu kurz kommen – seien es Migrant*innen, Ausländer*innen, Juden und Jüdinnen, Linke, Kommunist*innen oder andere Gruppen, die als „volksfremd“ wahrgenommen werden. Ihre persönliche Erfahrung von Eigentumslosigkeit im kapitalistischen System führt keineswegs zwangsläufig zur richtigen Analyse dieser Erfahrung als notwendige Konsequenz des Kapitalismus.
Ähnlich verhält es sich mit allen möglichen Identitäten und Formen von Betroffenheit, die man sich vorstellen kann. Wenn es stimmen würde, dass aus der blossen Betroffenheit ein korrektes Verständnis derselben folgen würde, dann müssten alle Frauen auf der Welt die gleiche und richtige Analyse geschlechtsbezogener Ungleichheit haben. Alle von Rassismus betroffenen Personen müssten die gleiche und richtige Ansicht von (Anti-)Rassismus haben. Alle Juden und Jüdinnen müssten die gleiche und richtige Meinung zu Antisemitismus und Israel haben.
„Sie sind dies, also denken sie das”
Das ist natürlich Unsinn – und obendrein selbst diskriminierend. Beispiel Antisemitismus: Die Annahme, dass alle Juden und Jüdinnen die gleiche und richtige Meinung zu Antisemitismus und seinen teils falschen und widersprüchlichen Definitionen hätten, nur weil sie jüdisch sind, ist selbst antisemitisch. Zu glauben, dass alle Jüdinnen und Juden eine identische politische Meinung vertreten, weil ihr „Jüdischsein“ ihre Identität und Denkweise bestimme, entpersonalisiert, homogenisiert und essentialisiert sie.
Es zählt nicht mehr, was gesagt wird, sondern nur noch, wer es sagt.
Anstatt Juden und Jüdinnen als denkende und individuelle Menschen wahrzunehmen, werden sie auf ein einziges Merkmal reduziert und zu einer homogenen Gruppe gemacht: „Er ist Jude, also denkt er das.“ Das ist Rassismus in Reinform – und ebenso falsch auf andere willkürlich definierte Gruppen angewendet, wie „Ausländer*innen“, Frauen, queere Menschen, Schwarze Menschen und so weiter.
Die identitäre Praxis, Betroffenheit und Identität zum Argument zu machen, führt dazu, dass Debatten die Sachebene verlassen. Argumente und Positionen werden nicht mehr hinterfragt, sondern Menschen erhalten Recht oder Gehör allein auf Basis ihrer Identität – oder eben nicht. Es zählt nicht mehr, was gesagt wird, sondern nur noch, wer es sagt.
Diskussionen werden nicht selten zu einem Wettbewerb der Betroffenheit, und wer diese am überzeugendsten darstellen kann, hat die grösste Autorität in der Diskussion. Das führt zur absoluten Absage an einen Prozess der Wahrheitsfindung, der auf Argumenten und Logik basieren muss.
Für eine Debatte, die über Meinungen hinausgeht
Ein Problem entsteht auch dann, wenn zwei oder mehr Betroffene unterschiedliche Meinungen zum Thema vertreten. Beispiel Sexarbeit: Neben vielen weiteren differenzierten Standpunkten stehen sich in der Debatte oft abolitionistische (Ex-)Prostituierte und „selbstbestimmte Sexarbeiter*innen” gegenüber. Beide Seiten beanspruchen für sich, die Wahrheit über das System der Prostitution erkannt zu haben und die besseren Schlüsse daraus zu ziehen. Was passiert in diesem Fall, wenn „die Betroffenen“ immer Recht haben? Wer von ihnen hat denn nun Recht, wenn sich ihre Meinungen widersprechen?
Irgendwann muss man sich die Frage stellen: Worüber sollen wir uns überhaupt noch unterhalten, wenn niemand die Erfahrungen des anderen kennt und jeder nur aus seiner persönlichen Perspektive Einsicht in die Verhältnisse gewinnen kann?
Wie sollen wir miteinander reden, wenn wir Begriffe nicht klären und unsere widersprüchlichen Meinungen nicht ausdiskutieren? Wie können wir dann noch kommunizieren, uns verständigen, einigen und für die gleiche Sache kämpfen?
Wer wirklich an Erkenntnis interessiert ist, wer in Diskussionen lernen und sich verständigen möchte, wer nicht nur zuhören, sondern selbst denken will, wer gemeinsam nach Wahrheit suchen statt immer nur alle Meinungen akzeptieren möchte, sollte erkennen, dass in der Sache zählt, was gesagt wird – und nicht, wer es sagt.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 15 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1040 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 525 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 255 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?