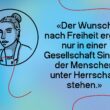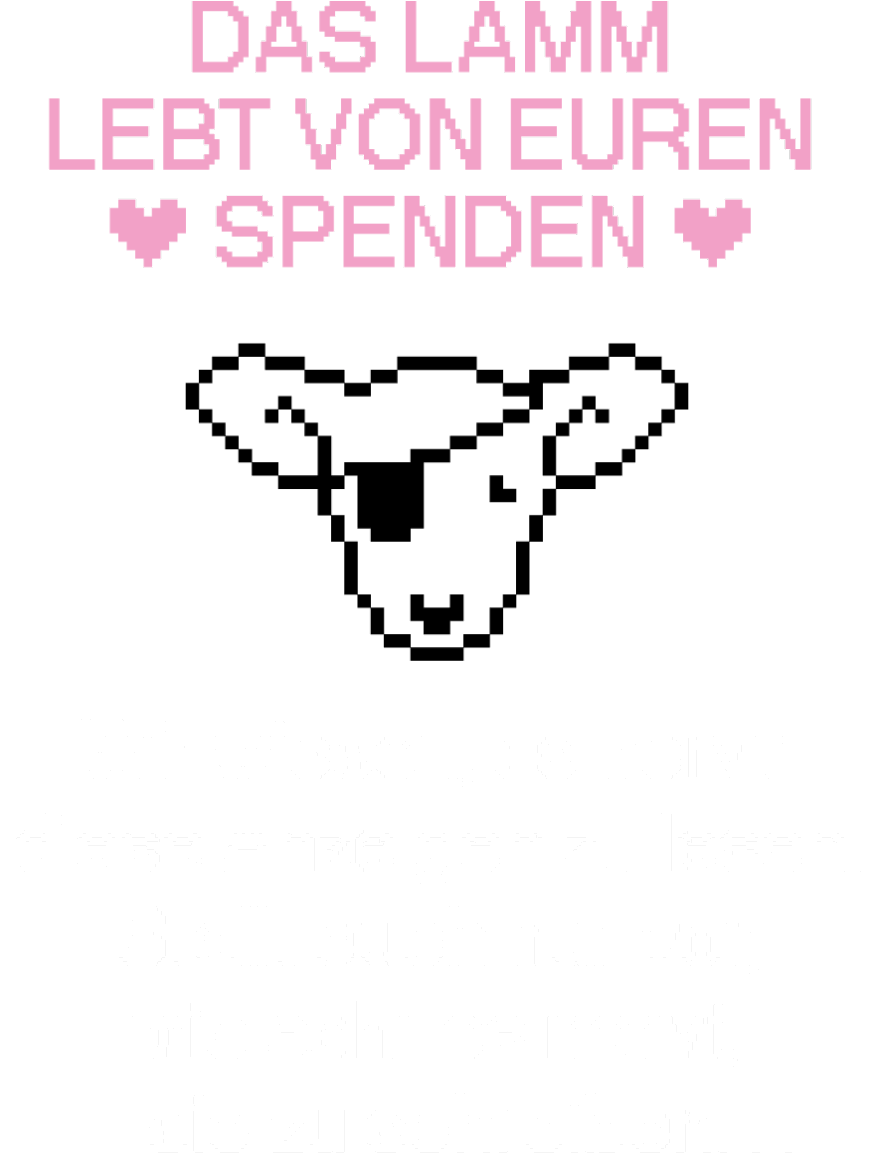Triggerwarnung: Dieser Text enthält Schilderungen von Gewalt, Folter, Tod und Fluchterfahrungen, die emotional belastend sein können.
In meinem Herkunftsland sind Meinungs- und Gedankenfreiheit keine Rechte – sie sind nur Träume. Jede Stimme, die das Regime kritisiert, riskiert Gefängnis, Folter, oder Tod. Diese Realität begleitet mich seit meiner Kindheit – nicht nur, weil ich Kurde bin, sondern weil ich frei denken und sprechen wollte.
Während ihr in der Schweiz in Sicherheit lebt, kämpfen die Menschen in meinem Land Tag für Tag mit Angst und Unterdrückung. Politische Repression, soziale Kontrolle und der Mangel an grundlegenden Menschenrechten prägen den Alltag von Millionen Iraner*innen und Kurd*innen.
Meine Narben erinnern mich an die Erkenntnis, wie wenig ein Menschenleben im iranischen System zählt.
Ich teile mit euch einige ausgewählte Momente meines Lebens, Schlaglichter auf Erfahrungen, die mich geprägt haben. Denn wer zu Unrecht schweigt, macht sich mitverantwortlich. Schon kleine Zeichen der Solidarität – sei es Aufmerksamkeit, Mitgefühl oder Zuhören – können Hoffnung schenken.
Erster Riss im Glauben an Gerechtigkeit
Ich, Diako Shafiei, wurde am 11. September 1989 in der Stadt Iwan im Iran geboren.
Im Jahr 1387 des persischen Kalenders – 2009 nach westlicher Zeitrechnung – war ich 18, als landesweite Proteste ausbrachen. Ein massiver Wahlbetrug hatte Millionen auf die Strasse getrieben, die Hoffnung nach Veränderung war greifbar. Doch das Regime des damaligen Präsidenten Mahmud Ahmadinejad antwortete mit Gewalt: Die Revolutionswächter und das Militär schlugen die friedlichen Demonstrationen brutal nieder.
Auch ich war dabei. Und sah, wie ein 12-Jähriger durch einen Kopfschuss starb und wie wenig später ein 13- und ein 15-Jähriger tödlich erschossen wurden. Mich traf eine Kugel im Oberschenkel. Es war ein körperlicher Schmerz – doch verglichen mit dem Leid und dem Verschwinden vieler junger Menschen bleibt er nur eine Narbe. Sie erinnert mich an die Erkenntnis, wie wenig ein Menschenleben im iranischen System zählt.
Ich habe die reglosen Blicke dieser drei Jugendlichen nie vergessen.
Die Universität – kein Ort der Unabhängigkeit
Im selben Jahr wurde ich erfolgreich in den Studiengang Maschinenbau an der Universität Ilam aufgenommen. Der Eintritt schien zunächst ein Hoffnungsschimmer zu sein, der Beginn eines vielversprechenden Weges. Doch schon bald erkannte ich, dass auch die Universität nicht vom Zugriff des Regimes verschont blieb.
Schon in den ersten Tagen an der Universität trat ich dem unabhängigen Studierendenverein bei und wurde bald Mitglied des Vorstands. Der Verein war ein Treffpunkt für freiheitsliebende Studierende. Ein Ort, an dem wir über politische Entwicklungen und gesellschaftliche Themen sprachen. Unser Ziel war es, einen offenen und demokratischen Raum zu schaffen, in dem Studierende ihre Stimme erheben konnten.
Die Aufgaben des Studierendenvereins waren anspruchsvoll und politisch sensibel: Wir publizierten eine unabhängige Studierendenzeitung, organisierten Sitzungen, Seminare und politische Diskussionsrunden.
Doch unsere Arbeit blieb nicht unbeobachtet. Die Universitätsaufsicht – mehr Überwachungsorgan als akademische Instanz – kontrollierte und beschattete unsere Aktivitäten. Immer wieder riefen sie meine Kolleg*innen und mich in ihr Büro, wo sie ständig dieselben Fragen stellten: „Warum fand diese Sitzung statt?“ „Wer steckt hinter diesen Aktivitäten?“ Ihr Ziel war klar: Jede Form studentischer Opposition identifizieren und unterdrücken.
Als Reaktion auf die Proteste schloss mich die Universität, die ein Ort des freien Denkens sein sollte, für ein Jahr vom Studium aus.
Wir hatten zunehmend das Gefühl, dass sich die Mauern der Universität in ein unsichtbares Gefängnis verwandelten, das sich Tag für Tag enger schloss. Mehrmals wurde mir mit dem Ausschluss vom Studium gedroht, sollte ich meine Tätigkeiten fortsetzen. Doch trotz des Widerstands hielten meine Kommiliton*innen und ich an unserem Einsatz für einen freien und demokratischen Austausch fest. Manchmal mussten wir unsere Berichte und Zeitungen heimlich in der Nacht an der Universität verteilten.
Im Jahr 2010, zu Beginn der Präsidentschaftswahlen, wählte man mich zum Generalsekretär der Studierendenkoalition der Provinz Ilam. Zudem erhielt ich einen Sitz im Zentralrat der Studierendenbewegung der Grünen Bewegung Irans.
Für meine Mitdenker*innen und mich war dies eine Chance, die Stimme der Unterdrückten zu sein – ein kollektiver Ruf nach Gerechtigkeit und Reform. Die Grüne Revolution war mehr als eine politische Strömung: Sie war Ausdruck einer Generation, die genug hatte von Lügen, Korruption und Gewalt und dafür mit ihrem Blut bezahlte.
Verhaftung und Folter
Nach der Bekanntgabe der gefälschten Wahlresultate im selben Jahr, die Mahmud Ahmadinejad angeblich gegen den Oppositionskandidaten Mir Hossein Mousavi zum Sieger erklärten, erfasste eine neue Protestwelle den Iran. Menschen aus allen Schichten gingen auf die Strasse. Doch schon wie ein Jahr zuvor schlug das Regime brutal zurück.
Bei einer dieser Demonstrationen identifizierten mich die Sicherheitsdienste und nahmen mich fest. Sie verbanden mir die Augen und brachten mich an einen Ort, der nach Feuchtigkeit und Angst roch. Sie brachten mich in eine Folterstätte. Dort begann mein erstes Martyrium. Mehrmals hingen sie mich für mehrere Stunden von der Decke auf. Meine Hände brannten vom Druck des Seils. Ohne Pause drangen Schläge auf meinen Rücken ein.
Die Schmerzen zerschlugen meinen Körper, doch schlimmer war der seelische Bruch. Immer wieder verlangten die Verhörbeamten unter Drohungen Informationen über meine Mitstreiter*innen. Die Schreie anderer Inhaftierter hallen bis heute nach. Zehn Tage verbrachte ich in völliger Dunkelheit. Schliesslich wurden wir – wegen überfüllter Gefängnisse – freigelassen. Aber nur unter Bedingung, eine Erklärung zu unterzeichnen, in der wir versprachen, unsere Aktivitäten einzustellen.
Ein Jahr später, 2011, kam es zu meiner zweiten Foltererfahrung. Gemeinsam mit anderen Studierenden hielten wir an der Universität eine Protestrede. Die Reaktion kam prompt: Die Universitätswache übergab mich dem Geheimdienst. Es folgten vierzehn Tage Haft. Vierzehn Tage voller Folter, die bis heute in meinen Körper und Geist eingraviert ist.
Als Reaktion auf die Proteste schloss mich die Universität, die ein Ort des Denkens und der Freiheit sein sollte, für ein Jahr vom Studium aus.
Doch der wahre Schmerz begann erst, als ich nach der Explosion die leblosen, zerrissenen Körper meiner Freund*innen sah.
2012 nahm ich als Journalist an einer Medienkonferenz der Provinzverwaltung Ilam teil – ich hatte diese Arbeit während meiner Zeit in den Studierendenbewegungen begonnen, wo ich in Medien wie Nedaye Daneshjoo und Ghalam News veröffentlichte. An dieser Konferenz sprach ich über die fehlende Meinungsfreiheit, das Verschwinden politischer Räume und die Repression gegenüber Studierenden und Journalist*innen. Diese Worte hatten Konsequenzen: Ich wurde lebenslang als Journalist gesperrt. Auch an der Universität wurde mir ein weiterführendes Studium verboten.
Nach dem Berufsverbot schrieb ich trotzdem weiter – unter einem Pseudonym. Ich veröffentlichte Artikel in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und deckte Korruption auf. Die Worte blieben meine Waffe.
Im Jahr 2015 trat ich mit der Demokratischen Partei Kurdistan in Kontakt – einer Bewegung, die für Demokratie und föderale Selbstverwaltung auf Basis sozialer Gerechtigkeit kämpft.
Ein neues Kapitel im Exil
Der 11. September 2017 veränderte mein Leben. Als ich meinen Geburtstag mit Freund*innen am Freizeitort Rijav in Kermanshah feierte, erhielt einen Anruf meines Vaters. Seine Stimme zitterte: „Die Sicherheitsdienste haben unser Haus durchsucht. Deinen Laptop und Dokumente haben sie beschlagnahmt. Sie sagten, du sollst dich sofort beim Sicherheitsdienst melden, sonst wird es schlimmer.“
Nach diesem Anruf wandte ich mich an die Partei. Die Einschätzung war eindeutig: Mir drohte die Todesstrafe. Am selben Abend überquerte ich mit Hilfe der Partei die Grenze in die kurdische Region des Irak.
Zwei Tage später begann ich meine Arbeit als Journalist beim Fernsehsender Kurd Channel und bei der Demokratischen Partei. Nun wieder offiziell, aber weiterhin mit dem gleichen Ziel: über die Situation im Iran und das Leid der kurdischen Bevölkerung zu berichten.
Einige Monate später lud mich Shoures Shahbaz, ein führendes Parteimitglied, zu einem Fernsehinterview ein. Thema war die Lage politisch aktiver Studierender und Medienschaffender im Iran. Nach der Ausstrahlung des Interviews erhielt ich erneut Drohungen.
Systematische Unterdrückung
September 2018, morgens um 10:45 Uhr. Ein Tag, der sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Schwere Explosionen erschütterten den gesamten Parteistützpunkt in der irakischen Stadt Kuye. Dichte Rauchwolken und der Lärm von Zerstörung zerbrachen die Stille. Die iranische Revolutionsgarde hatte mit sieben ballistischen Raketen das Zentrum unserer Partei angegriffen.
Sechzehn Mitglieder der Parteiführung wurden getötet. Ich selbst wurde am Hinterkopf verletzt, mein Kreuzband riss – ein Schmerz, der geblieben ist. Doch der wahre Schmerz begann erst, als ich nach der Explosion die leblosen, zerrissenen Körper meiner Freund*innen sah.
Die Explosion hatte nicht nur Gebäude erschüttert, sondern auch mein innerstes Selbst. Doch obwohl mein Weg von Angst und Anspannung geprägt war, zerbrach meine Hoffnung nicht. In der Zeit, als der Schmerz über den Verlust und die Hoffnung miteinander rangen, begannen sich neue Bedrohungen anzubahnen. Diesmal subtiler, aber genauso gefährlich.
„Frau, Leben, Freiheit“ – wurde zum Ruf einer ganzen Generation, die gegen das Regime aufstand.
Im Jahr 2021, drei Jahre nach dem verheerenden Angriff, wurde die Realität meiner Situation erneut deutlich. Als mich das Sicherheitskomitee der Partei zu einer vertraulichen Sitzung einlud, wusste ich, dass diese Begegnung alles verändern könnte. Der Leiter des Sicherheitskommittees las einen Bericht vor, der sechs Namen auf der Todesliste des iranischen Regimes nannte – darunter Shorsh Shahbaz, Journalist und Mitglied der Parteiführung, Mousa Babakhani, politischer Aktivist und Mitglied des Zentralkommittees der Partei, – und mein eigener.
Die Bedrohungen gegen mich nahmen zu. Gleichzeitig wurde ich immer wieder von einer unbekannten Person zu einem Treffen gedrängt, während ich in ständiger Angst lebte, vom Regime als nächste Person eliminiert zu werden. Diese Gefahr war nicht nur auf mich beschränkt – auch meine Familie wurde mehrfach vom Sicherheitsdienst verhört und unter Druck gesetzt, um mich zum Schweigen zu bringen. Das Regime setzte systematisch Unterdrückung ein, um jede Opposition zu bekämpfen.
Jin, Jiyan, Azadi
Am 16. September 2022 erlebte der Iran eine Wendung, als Jina (Mahsa) Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei starb. Ihr „Vergehen” war „unangebrachte Kleidung” und ihr Tod löste Proteste in Kurdistan aus, die sich wie ein Lauffeuer auf den gesamten Iran ausbreiteten. Der Slogan „Jin, Jiyan, Azadi” (zu Deutsch „Frau, Leben, Freiheit”) wurde zum Ruf einer ganzen Generation, die gegen das Regime aufstand.
Als politisches Mitglied der Demokratischen Partei Kurdistan-Irans reagierte ich sofort. Gemeinsam mit anderen Aktivist*innen organisierten wir Proteste und setzten alles daran, die globale Aufmerksamkeit auf das Leid der iranischen Bevölkerung zu lenken.
Doch statt auf die Forderungen der Menschen einzugehen, reagierte das iranische Regime mit brutaler Gewalt. Am 28. September 2022, nur wenige Tage nach Beginn der Proteste, griffen die Revolutionsgarden das Zentrum der Demokratischen Partei Kurdistans in der Stadt Koya sowie zivile Camps in der kurdischen Region im Irak mit Raketen und Drohnen an. Unsere gefallenen Freund*innen mussten wir nachts in aller Stille beerdigen, begleitet von ständiger Angst, entdeckt zu werden.
Das Exil ist für mich kein Ende, sondern eine Möglichkeit, den weltweiten Kampf für Freiheit und Menschenrechte fortzusetzen.
Trotz allem gab ich meine journalistische Arbeit nicht auf. Ich setzte weiterhin alles daran, die Welt über die Menschenrechtsverletzungen im Iran zu informieren.
Die Flucht in die Schweiz
Schliesslich informierte mich das Sicherheitskomitee der Partei, dass mein Leben in unmittelbarer Gefahr war. Ich musste Kurdistan schnell verlassen. Mit Hilfe eines Parteimitglieds wurde ich heimlich nach Istanbul gebracht. Doch selbst dort blieb die Gefahr präsent, die türkischen Behörden könnten mich an den Iran ausliefern.
Nach einer Woche in Istanbul startete ich meine Reise über das Meer nach Italien. In einer stürmischen Nacht auf dem offenen Meer rettete uns ein Kreuzfahrtschiff, das uns nach Italien brachte. Zwei Tage später erreichte ich die Schweiz.
Trotz der Sicherheit, die ich in der Schweiz gefunden habe, belasten mich die Erinnerungen an die schrecklichen Erfahrungen der letzten Jahre.
Dieses Memoir soll den Menschen in der Schweiz verdeutlichen, wie politisch und zivilgesellschaftlich aktive Iraner*innen täglich unter einem repressiven Regime leiden. Das Exil ist für mich kein Ende, sondern eine Möglichkeit, den weltweiten Kampf für Freiheit und Menschenrechte fortzusetzen. Inmitten der Unsicherheit meiner Zukunft hier appelliere ich an die Schweiz, Mitgefühl und Verständnis für unser Leid zu entwickeln und unseren Kampf als einen für eine gerechtere Welt zu sehen.
Dieser Artikel ist im Rahmen der Serie Stimmen aus den Camps erschienen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 30 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1820 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1050 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 510 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?