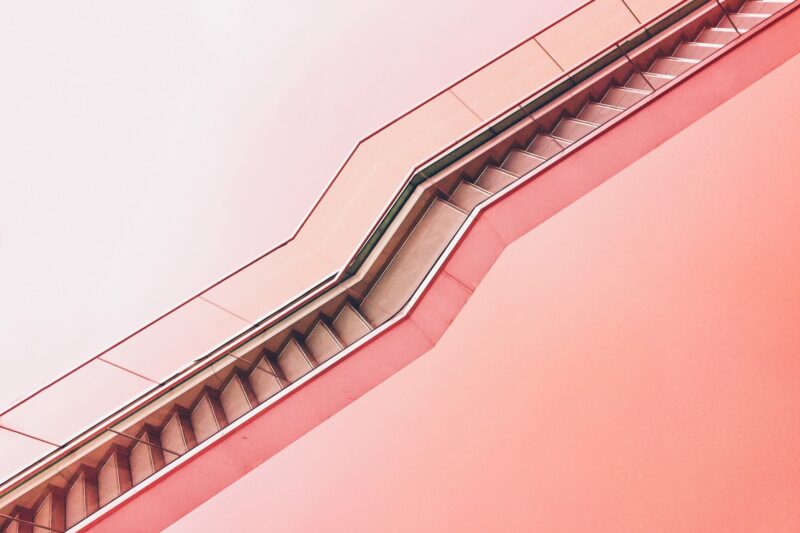Wer einen catchy Titel für sein Buch wählt, der muss immer und immer wieder aushalten, auf den Titel angesprochen zu werden; selbst schuld. In meinem Fall – ich habe ein Buch geschrieben, das den Titel „Keine Aufstiegsgeschichte” trägt – lautet die Frage: Bist du nicht doch aufgestiegen? Ich bekomme sie in jedem Interview zu meinem Buch gestellt, bei ausnahmslos allen Lesungen und sämtlichen Veranstaltungen, auf denen ich spreche.
Und weil es gerade irgendwie in Mode zu sein scheint, seine Privilegien zu checken, hier der als Kolumne getarnte Selbstversuch: Bin ich aufgestiegen?
Diese Kolumne? Schreibe ich doch mit links! Also mit der linken Hand, denn seit zwei Monaten habe ich eine Sehnenscheidenentzündung. Um fair zu sein, so ganz schreibe ich sie nicht mit der linken Hand, ich fange zwar mit links an, aber nach circa dreissig Sekunden flippe ich aus: Alles geht viel zu langsam.
M e i n l i n k e r Z e i g e f i n g e r s c h w e b t s u c h e n d ü b e r d e r T a s t a t u r, B u c h s t a b e f ü r B u c h s t a b e w i r d e i n g e g e b e n, bis meine mangelnde Impulskontrolle schliesslich übernimmt und dafür sorgt, dass ich auch diesen Text in bewährter und chaotischer Siebenfingertechnik schreibe. Hätte ich doch nur bloss nicht Nein gesagt, als mir meine Mutter mit sechzehn einen Zehn-Finger-Schreibkurs spendieren wollte.
Diese Sehnenscheidenentzündung führt mich zur (erneut gewonnenen) Erkenntnis, dass selbstständige Arbeit in aller Regel Unsicherheit bedeutet. Wenn ich vor einer Podiumsdiskussion krank werde, wird die Veranstaltung ohne mich stattfinden und ich bekomme kein Geld. Und auch meine Sehnenscheidenentzündung verschleppe ich, denn auf das Geld aus meinen beiden Kolumnen kann ich nicht verzichten u n d m i t d e m l i n k e n Z e i g e f i n g e r t i p p t e s s i c h n i c h t g u t. Auch mein Buch, an dem ich gerade arbeite, schreibt sich nicht von allein. Also schreibe ich weiter, trotz Entzündung im Handgelenk.
„David gegen Goliath“ ist hier Programm. Olivier David
gegen die Goliaths dieser Welt. Anstatt nach unten wird nach oben getreten. Es geht um die Lage und den Facettenreichtum der unteren Klasse. Die Kolumne dient als Ort, um Aspekte der Armut, Prekarität und Gegenkultur zu reflektieren, zu besprechen, einzuordnen. „David gegen Goliath“ ist der Versuch eines Schreibens mit Klassenstandpunkt, damit aus der Klasse an sich eine Klasse für sich wird. Die Kolumne erscheint ebenfalls als Newsletter.
Wieder Schulden machen
Freiberuflich arbeiten heisst Armutsrisiko: Es braucht nur ein paar Ausfälle und alles steht kopf, denn so wie fast alle Freiberufler*innen gehöre ich zu denjenigen, die keine Rücklagen bilden können. Schlimmer noch: Ich habe Schulden. Keine hohen Schulden, aber Schulden.
Und ich studiere. Für das Studium bin ich einer der lucky ones, der Bafög, also finanzielle Unterstützung des Staats bekommt, elternunabhängig, Jackpot. Das sind 850 Euro, dazu darf ich noch 330 Euro dazuverdienen. Würde ich allein leben, läge ich damit unterhalb der Armutsgrenze. Komm her, du geiler Aufstieg, was bist du gut zu mir!
Durch meine Arbeit verdiene ich mehr Geld als ich darf, also muss ich dem Bafög-Amt jährlich Geld zurückzahlen. Für das vergangene Jahr waren es in etwa 4’500 Euro. Inflation, gestiegene Lebensmittelpreise, die hohen Energiepreise – ich hatte es nicht geschafft, die 4’500 Euro in Gänze zurückzulegen. Dumm gelaufen. Also wieder Schulden machen.
Die ehemaligen Nachbar*innen aus der Strasse, in der ich aufgewachsen bin, haben keine Stimme. Mit dem Buch und meinen beiden Kolumnen, die ich schreibe, habe ich mir dagegen eine Stimme verliehen.
Wenn ich irgendwann mit dem Studium fertig sein sollte, habe ich noch mal ein paar Tausend Euro Schulden beim Bafög-Amt. Ich bin dann irgendwo zwischen Mitte und Ende dreissig, habe viele Jahre nicht in die Rentenkasse eingezahlt und mein Rentenbescheid liegt unterhalb der Mindestrente. Vorausgesetzt, ich bin von nun an bis zum Rentenbeginn nicht krank.
Meine Geschichte sagt mir, dass ich davon besser nicht ausgehen sollte. Mit Mitte dreissig habe ich bereits Krebs, eine Herzmuskelentzündung, psychische Erkrankungen und Arthrose gehabt – damit habe ich keine Chance, in eine Berufsunfähigkeitsversicherung aufgenommen zu werden.
Neben der ökonomischen Perspektive gibt es auch eine kulturelle. Hier wird es unangenehm für mich, denn da haben die zahlreichen Journalist*innen, mit ihrer Frage nach meinem Aufstieg vermutlich einen Punkt. Die ehemaligen Nachbar*innen aus der Strasse, in der ich aufgewachsen bin, haben keine Stimme. Mit dem Buch und meinen beiden Kolumnen, die ich schreibe, habe ich mir dagegen eine Stimme verliehen. Mir wird zugehört, ich kann auf Podien und dann und wann im Fernsehen meine Meinung verbreiten. Mit dem Studium generiere ich kulturelles Kapital, das mir helfen kann, anschliessend Fuss zu fassen.
Von Arbeiter*innenkindern und allen anderen Arbeiter*innen auch
Viele der Leute, die so wie ich aus der Armuts- oder Arbeiter*innenklasse kommen, nennen sich Arbeiter*innenkinder. Damit verweisen sie auf eine Position in der Klassengesellschaft, die sich im Fahrstuhl nach oben befindet. Aufstieg durch Bildung heisst dieses Versprechen.
Während die Eltern noch mit ihren Händen schuften mussten, studieren sie. Sie lernen die Kulturtechniken der akademischen Welt und schon wähnen sie sich, der Lage ihrer Eltern entkommen zu sein. Viele beschäftigen sich dann, wenn sie über Klasse reden, nicht mehr mit der Ausbeutung, die für die Armut ihrer Eltern gesorgt hat, sondern mit den verinnerlichten Spuren sozialer Herkunft und mit der Diskriminierung, die ihnen aufgrund dieser Herkunft widerfährt.
Es gibt gute Gründe, an der Sinnhaftigkeit dieser Verschiebung zu zweifeln, allein die Zahlen geben es her: Laut einer Studie der OECD braucht man für einen nachhaltig gelungenen Aufstieg aus Hartz 4 in die sogenannte Mitte der Gesellschaft 180 Jahre beziehungsweise sechs Generationen. Ein grosser Teil dieser sich im Aufstieg wähnenden Gruppe wird nach dem Studium also Schwierigkeiten haben, sich beruflich im akademischen Betrieb oder in der Kultur- und Medienindustrie durchzusetzen.
Ich plädiere für einen realistischeren Blick auf Arbeit und Klasse.
Was bleibt in einer Gesellschaft, in der der Kampf um den Statuserhalt und der Abstieg die Regel ist, während der Aufstieg die popkulturell aufgeladene Ausnahme bleibt? Schlecht bezahlte Jobs, in denen junge, überqualifizierte Uniabsolvent*innen arbeiten.
Manche gebrauchen nach dem Studium ihre Hände, um zu arbeiten. Wie ihre Eltern.
Das ist nicht schlimm, nein, es ist höchstens tragisch. Denn unter ihnen sind welche, die sich – ob um sich des Abstandes gegenüber ihren Eltern zu versichern oder aus dem Wunsch heraus, sich der Unterschiede zwischen ihnen und Akademiker*innenkindern an der Uni bewusst zu machen – Arbeiter*innenkinder nennen. Ganz so, als hätten sie die ruppige Arbeitswelt ihrer Eltern für immer hinter sich gelassen.
Ich plädiere für einen realistischeren Blick auf Arbeit und Klasse. Für mich bedeutet es, dass ich mich weder kleinmachen will, indem ich meine Erfolge schmälere, noch dass ich mich als proletarischen Arbeiter begreife, der mit seinen Händen arbeitet. Denn das tue ich nicht, wenngleich meine Sehnenscheidenentzündung gerade eine andere Meinung dazu hat.
Es kann aber jederzeit sein, dass der Fall eintritt, dass ich meine Hände zum Arbeiten benutzen muss – so wie es schon viele Male eingetreten ist – und ich mit schlechter Laune und meinen Bewerbungsunterlagen bewaffnet vor der Zeitarbeitsfirma, vor der Bäckerei oder dem Warenlager stehe und Einlass begehre. Was macht das nach Distinktion strebende Arbeiterkind in mir dann?
Wie soll ein Gefühl für die eigene Klassenlage in der unteren Klasse entstehen, wenn ständig alle Leute, die irgendwas von sich erzählen oder kreativ arbeiten, aus ihr herausgerechnet werden oder sich selbst aus ihr herausrechnen?
Meine Art des Umgangs könnte man als eine Art depressiven Realismus beschreiben, der für eine bessere Welt kämpft, der sich aber nicht von unrealistischen Aufstiegsnarrativen von jenen vereinnahmen lässt, die die Botschaft zu verkaufen haben, dass am Ende doch alles gut wird.
Es wird nicht alles gut – es sei denn, wir sorgen dafür. Das Aufstiegsnarrativ sorgt jedenfalls nicht dafür, dass alles gut wird, soviel ist sicher. Dem Herausrechnen und Ausklammern von kreativen Teilen der Unterklasse kommt eine wichtige, spaltende Funktion im Klassenkampf zu. Wie soll ein Gefühl für die eigene Klassenlage in der unteren Klasse entstehen, wenn ständig alle Leute, die irgendwas von sich erzählen oder kreativ arbeiten, aus ihr herausgerechnet werden oder sich selbst aus ihr herausrechnen – nur damit sie dann doch nicht fair bezahlt werden. Und prekär und unsicher beschäftigt den Clown für die Kulturbourgeoisie spielen?
Ich mache da nicht mit. Als Autor nicht und auch nicht als jemand, der sicher noch mal seine Hände zum Arbeiten benutzen muss.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?