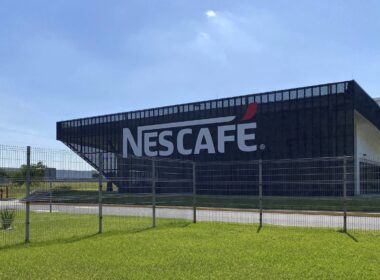Eine Frau steht mit ihren zwei Kindern in einer einfachen Lehmhütte. Die Wände sind schwarz vor Russ. Ihr Lächeln in die Kamera wirkt gezwungen. Die Kleidung der drei ist schmutzig.
Das beschriebene Bild zeigt die Armut einer Familie in den peruanischen Hochanden. Hochgeladen ist es auf der Webseite von Tuki Wasi. Das Projekt hat die ehemalige offene Feuerstelle, auf der die Familie bis anhin ihre Mahlzeiten gekocht hatte, durch einen Lehmofen ersetzt. Der schon etwas heruntergekommene Ofen nimmt prominent die Hälfte des Fotos ein. Demonstrativ stehen riesige Töpfe darauf.
Tuki Wasi ist eine Kooperation zwischen dem französischen Unternehmen Microsol und der Schweizer Stiftung KliK – zwei private Akteure, die im Rahmen des Pariser Klimaabkommens die CO2-Emissionen der Schweiz reduzieren wollen.
Das Projekt soll einen „Beitrag gegen die globale Erderwärmung setzen”, so die Eigenbeschreibung. Bis zu 60’000 Kochöfen sollen es werden, derzeit sind es 1’000. Finanziert durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten.
Es ist ein Pilotprojekt und gleichzeitig ein wichtiger Baustein der Schweizer Klimapolitik. So bizarr es klingen mag: Die Schweiz will bis zu einem Viertel ihrer versprochenen CO2-Reduktionen im Ausland erreichen. Seit Oktober 2020 ist das effektiv möglich, weil die Schweiz und Peru damals den weltweit ersten Vertrag unterzeichneten, mit dem obligatorische Reduktionen im Rahmen des Pariser Abkommens ins Ausland verlagert werden können.
Mittlerweile ist das Projekt angelaufen: Im November 2021 unterzeichnete die Stiftung KliK den ersten Kaufvertrag von CO2-Zertifikaten aus Peru. Das eingesparte CO2 wird dem Ausstoss von Verbrennungsmotoren in der Schweiz angerechnet. „Eine Pioniertat im Klimaschutz”, meinte der Bund in einem Interview mit dem Direktor von KliK, Marco Berg. Kritiker:innen monieren dagegen, dass dadurch laufende Entwicklungs- durch Klimaschutzprojekte ersetzt werden könnten und die Schweiz damit ihren hohen CO2-Ausstoss aufrechterhalten kann. Denn wer im Ausland CO2-Emissionen reduziert, muss weniger im Inland unternehmen.
Von Paris über Bern in die Hochanden
Mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die Schweiz im Jahr 2015 dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2030 auf die Hälfte derer aus dem Jahr 1990 zu reduzieren. Laut dem CO2-Übergangsgesetz, das nach dem Nein zur letzten Vorlage im Eiltempo vom Parlament beschlossen wurde, darf momentan bis zu einem Viertel dieser Reduktionen im Ausland stattfinden. Dies wird unter einer Bedingung explizit durch das Pariser Abkommen erlaubt: Um gültig zu sein, muss es sich um Investitionen handeln, die sonst nicht getätigt worden wären.
Laufende Entwicklungsprojekte etwa, die den CO2-Ausstoss verringern, darf sich das finanzierende Land nicht anrechnen. Gemessen wird das eingesparte CO2 in International Transfer Mitigation Outcomes (ITMOs), die ähnlich wie CO2-Zertifikate über Unternehmen gehandelt und den Staaten angerechnet werden.
CO2-Zertifikate bemessen den eingesparten CO2-Ausstoss verschiedener Akteure. Der Bund stellt die Zertifikate an die CO2-reduzierenden Akteure aus, die diese verkaufen, um so die Investitionen für ihre CO2-Ersparnisse zu finanzieren. Gekauft werden sie beispielsweise von Akteur:innen aus der Mineralölbranche, die damit den eigenen Ausstoss „kompensieren”.
Diese Art der CO2-Kompensation gibt es schon seit Jahren, nur durften CO2-Zertifikate im Ausland bislang nicht auf die Klimabilanz im Sinne des Pariser Abkommens angerechnet werden. Bereits mit dem auslaufenden CO2-Gesetz aus dem Jahr 2013 wurden verschiedene Akteur:innen dazu verpflichtet, ihren CO2-Ausstoss zu kompensieren – so etwa die Schweizer Erdölvereinigung, heute Avenergy. Mit diesem Ziel gründete sie die Stiftung KliK, die CO2-Zertifikate im In- und Ausland aufkauft, finanziert durch einen Aufschlag von 1,5 Rappen pro Liter Treibstoff, der verkauft wird.
Wichtige CO2-Emittent:innen wie die Erdölbranche pochen darauf, möglichst viele CO2-Zertifikate im Ausland kaufen zu können. Sie wollen bis zu 90 % ihrer Kompensationen im Ausland tätigen, weil dies deutlich günstiger ist. Im Jahr 2018 unterstützte ein grosser Teil des Parlaments die Idee. Wenn auch nicht in dieser Höhe: Das Parlament setzte fest, dass ein Viertel der CO2-Reduktionen der Schweiz im Ausland stattfinden kann.
Die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard begründete den Schritt mit den grösseren Möglichkeiten, im Ausland CO2 zu reduzieren: „Wir haben schon sehr vieles gemacht. Wir sind seit zwanzig Jahren Mitglied des Kyoto-Protokolls; die meisten Staaten dieser Welt sind das nicht. Deshalb sind sie auch bezüglich des Pro-Kopf-Ausstosses wie des globalen Ausstosses von CO2 auf einem ganz anderen Niveau als die Schweiz”, sagte sie, mit Lob für die Schweiz nicht geizend, anlässlich einer Vernehmlassung am 4. Dezember 2018 im Parlament.
Doch das Ganze hat einen Haken. Auf dem Schweizer Territorium gelangen pro Jahr und Kopf 5.5 Tonnen Klimagase in die Luft, deutlich mehr als die 1,36 Tonnen pro Person, die es in Peru sind. Berechnet man zusätzlich den CO2-Ausstoss eines Landes anhand des eigenen Konsums, so steigt der Schweizer CO2-Ausstoss durch den Import von im Ausland produzierten Produkten nochmals markant – laut Our World in Data im Jahr 2019 um ganze 215,9 Prozent. Zählt man also die Emissionen der Importprodukte dazu, dann werden aus den 5,5 Tonnen pro Person 14 Tonnen pro Person, was uns vom Mittelfeld nach oben zu den Grossemittent:innen katapultiert.
Die Schweiz generiert also durch ihren Konsum CO2 im Ausland. Dieser Ausstoss wird laut Pariser Abkommen im Entstehungsland angerechnet und nicht in der Schweiz. Gleichzeitig kann die Schweiz im Ausland Projekte zur Reduktion vom CO2-Ausstoss durchführen, diese aber im Inland anrechnen.
Kochöfen als Gesundheitspolitik
Doch was hat das alles mit der verarmten Familie in den Hochanden und ihrem Ofen zu tun?
In Peru kochten laut der Regierung im Jahr 2007 knapp 2,4 Millionen Menschen auf einfachen Feuerstellen. Der Holzverbrauch ist durch das offene Feuer besonders hoch und aufgrund fehlender Kamine wird die Luft in den Innenräumen durch die giftigen Verbrennungsgase belastet und stellt somit ein enormes Gesundheitsproblem für die Bevölkerung und insbesondere Frauen und Kinder dar, die sich besonders oft in der Küche aufhalten.
Dem sind sich auch internationale Akteur:innen und die peruanische Regierung bewusst. Nachdem ein Bericht der Weltbank im Jahr 2007 empfahl, die Kochstellen zu ersetzen, wurde im Jahr 2009 die Kampagne „eine halbe Million verbesserter Kochöfen: Für ein Peru ohne Rauch” von der Regierung ins Leben gerufen.
Unterstützt durch die niederländische und deutsche Regierung stellte der peruanische Staat bis ins Jahr 2010 mehr als 150’000 Kochöfen für die betroffene Bevölkerung zur Verfügung. Weitere 150’000 wurden damals versprochen. Über den Entwicklungsfonds des peruanischen Entwicklungsministeriums (FONCODES) wurden über die folgenden Jahre im ganzen Land Kochöfen gebaut, einmal 700, ein andermal 50’000. Alle paar Monate berichtet die FONCODES über weitere Projekte.
Längst bauen auch internationale Hilfsorganisationen Kochöfen.
Das Geschäft mit dem CO2-Ausstoss
„Gemeinsam”, „innovativ”, „ermächtigend”: So stellt sich das Pariser Unternehmen Microsol im Internet vor. In den auf der firmeneigenen Webseite eingebundenen Videos sind atemberaubende Landschaften zu sehen und hippe Musik läuft im Hintergrund, während der Lösungsansatz zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung erklärt wird. Kurz: Der Markt macht’s.
Im Prinzip macht Microsol aber nichts anderes als Hilfsorganisationen und der peruanische Staat. Es lässt Kochöfen bauen und betreut die Bevölkerung bei deren Instandhaltung und Benützung. Dabei ist das Unternehmen in Provinzen aktiv, in denen auch der Staat Kochöfen baut. Ein wichtiger Unterschied jedoch besteht: Das Unternehmen finanziert sich über den Verkauf von CO2-Zertifikaten und verdient somit mit dieser vermeintlichen Entwicklungshilfe Geld.
Das Perfide: Das Unternehmen verkauft sich gegen aussen als eine weitere Hilfsorganisation. Der Onlineauftritt wird mit Bildern geschmückt, in denen verschmutzte Gesichter, kleine Kinder in verdreckter Kleidung und lächelnde Frauen in die Kamera blicken. Hin und wieder ist ein chic gekleideter Mann zu sehen, der die neuen Kochöfen ganz professionell untersucht. Wer ganz nach unten auf der Webseite scrollt, findet ein Banner, das zum Spenden aufruft.
Besucher:innen der Webseite erfahren nicht, dass es sich bei Microsol um eine „Société par actions simplifiée” (kurz S.A.S.) handelt – eine in Frankreich existierende Mischform zwischen einer Aktiengesellschaft und einer GmbH mit mehreren Eigentümer:innen.
Microsol ist das Unternehmen, welches die Schweizer CO2-Kompensation im Auftrag der Stiftung KliK umsetzt. Auf die Profitorientierung ihres Kooperationspartners angesprochen meint Mischa Classen von der Stiftung KliK: „Wenn Microsol Geld verdient für gute Arbeit und damit weitere Projekte ermöglichen kann, ist das nur richtig.”
Eine magere Bilanz
Laut der Infobroschüre eines ähnlichen Projektes von Microsol, bei dem 77’000 Kochöfen in Kooperation mit NGOs und der Regionalregierung gebaut wurden, bekamen 406’000 Menschen verbesserte Kochstellen zur Verfügung gestellt. Der alljährliche CO2-Ausstoss soll dabei um 75’526 Tonnen gesenkt worden sein.
Dividiert man jedoch diese grossen Zahlen auf die Anzahl der Begünstigten, so ergibt das gerade einmal 186 kg CO2-Ersparnis pro Kopf. Also weniger als die 201 kg CO2, die MyClimate für einen Linienflug von Zürich nach Stuttgart pro Person berechnet. Zwei Städte, zwischen denen eine Distanz von 200 km liegt, die innerhalb von drei Stunden mit dem Zug zurückgelegt werden kann.
Classen von der Stiftung KliK meint dazu: „Die Berechnung zeigt eindrücklich, wie klimaschädlich unser Verhalten respektive wie aufwendig die Kompensation ist.” Und erläutert: „Der Wert von Kochofenprojekten sind insbesondere die Gesundheitseffekte durch fundamental verbesserte Luftqualität in den Häusern und Kochhütten.”
Der „Beitrag gegen die globale Erderwärmung” ist also doch eher Entwicklungspolitik. Dann sollten doch zumindest die Ausgaben stimmen. Im Gegensatz zu den genauen Angaben bezüglich der erreichten Personen, des eingesparten CO2 oder der geschaffenen Jobs macht Microsol auf der eigenen Webseite keine Angaben zu den Kosten pro Kochofen.
Die Stiftung KliK ist transparenter. In einer Pressemitteilung gibt sie an, in der Pilotphase des Projektes zwei Millionen Schweizer Franken für 2’000 gebaute Kochöfen ausgeben zu wollen. Bislang sind rund 1’000 Öfen fertiggestellt worden. Für die Pilotphase kommt ein Endpreis von 1’000 Franken pro Ofen zustande. Diese hohen Kosten entstünden aufgrund der initialen Entwicklungsinvestitionen, erklärt Classen: „Microsol hat beispielsweise eine NGO gegründet, um die vertragliche Abwicklung der Zahlungen mit den intermediären Ofenbauer:innen sauber zu regeln.” In Zukunft erwarte man deutlich geringere Kosten pro Ofen.
Doch machen diese hohen Preise überhaupt Sinn? Zum Vergleich: Die peruanische Regierung informierte im Jahr 2017 bei einem eigenen Kochofenprojekt, das 50’000 Kochöfen finanzierte, 36’599’980 Soles (umgerechnet 11,3 Millionen Schweizer Franken) ausgegeben zu haben. Pro Kochofen sind das 732 Soles, also 225 Schweizer Franken. Zum Aufbau der Öfen gehörte auch die technische Unterstützung für die Instandhaltung.
Laut Classen sei ein Vergleich nicht möglich: „Sie vergleichen hier unterschiedliche Sachen”, schreibt er per Mail. „Das Angebot von Tuki Wasi beinhaltet die fortlaufende Überwachung und den langfristigen Unterhalt der Öfen, was zwar die Kosten treibt, aber für einen nachhaltigen Wertewandel in Bezug auf Kochen notwendig ist.”
Doch wieso eine eigene NGO aufgebaut werden musste, erklärt diese Antwort nicht. Vielleicht hätte auch einfach die peruanische Regierung – viel günstiger – unterstützt werden können. Aber dann wäre die CO2-Reduktion Peru angerechnet worden.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 23 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1456 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 805 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 391 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?