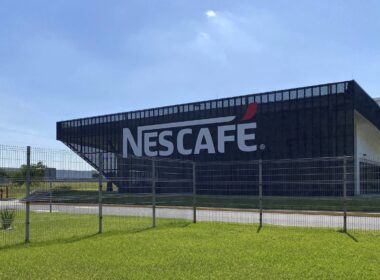Der kleingewachsene Héctor Luis Vicencio Quintana steht auf einem Hügel über seiner Heimatstadt, im Hintergrund eine Strasse, die direkt zu den Häusern führt. Sein Blick wirkt lakonisch, fast tragisch. Er richtet die Augen auf sein Zuhause und sagt: „Wir haben unsere eigene Zukunft zerstört.”
Das Städtchen heisst Andacollo, doch die Geschichte könnte in irgendeiner der Bergbaustädte stattfinden, die in den kleinen Tälern der chilenischen Anden liegen. Es sind Städte, die seit jeher mit der Suche nach Mineralien verbunden sind.
Um die Suche nach Gold und anderen Metallen entstehen Geschichten, Mythen und religiöse Zeremonien. So ist auch Andacollo als Wallfahrtsort bekannt. Zweimal jährlich kommen katholische Gläubige aus dem ganzen Land, um der Jungfrau von Andacollo zu huldigen. Über den kleinen Häusern der Stadt, am zentralen Platz, thronen zwei riesige Kirchtürme: Das Gold der Berge ist Segen und Fluch zugleich.
Um die Stadt herum befinden sich zwei riesige Gruben. Sie sind das Resultat der Arbeit zweier Bergwerke, die sich in den 90er-Jahren angesiedelt und tief in den Berg hineingefressen haben. Die eine ist heute inaktiv. In der anderen fahren haushohe Lastwagen das Gestein zu riesigen Sortiermaschinen. Dort werden Kupfer, Gold und das seltene Molybdän durch chemische und elektrische Verfahren aus der Erde gewaschen.
Die Mine gehört dem kanadischen Unternehmen Teck, dass der Stadt und ihren Bewohner*innen einst Wohlstand versprach. Doch dieser wird in Form von Gold direkt aus dem Bergbau zum Flughafen transportiert und landet ein paar Stunden später in Zürich. In der Schweiz wird es verarbeitet und verkauft. Währenddessen bleibt in Andacollo ein riesiges Staubecken zurück, gefüllt mit Schwermetallen wie Arsen, Quecksilber und Zyanid, die zum Auswaschen von Gold und Kupfer verwendet werden.
Auch Vicencio lebte einst vom Gold in den Bergen, dann wurde er wegen seines Kampfes für die Umwelt entlassen. Heute sieht er, wie seine Heimat durch die endlose Suche nach Reichtum zerstört wird. In ganz Chile hat die Suche nach Wohlstand einen Preis: die Ausbeutung aller natürlichen Ressourcen und die Vergiftung der Böden und Gewässer.
In diesem ersten Teil der vierteiligen Serie geht es um die Zerstörung eines Ortes – seit der Kolonialisierung durch die spanische Krone bis heute.
Was vom Gold übrigbleibt
Andacollo gibt es nur, weil Gold unter dem Boden schlummert. Als die spanischen Kolonialherren Anfang des 17. Jahrhunderts den Ort erreichten, beschrieben die ersten Briefe an die spanische Krone die Hügel um Andacollo als äusserst reich an Gold und Kupfer.
‚Anta’ bedeutet in der indigenen Sprache Quechua Gold oder Kupfer und ‚Collo’ Hügel. Um die Hügel von Andacollo entstand mitsamt der Suche nach den Metallen ein religiöser Kult. Zweimal im Jahr reisen bis heute tausende Gläubige in die trockene und hügelige Landschaft, um der Jungfrau von Andacollo zu huldigen. Ein Glaube, der ebenfalls der Gründung der Kleinstadt entspringt.

Angeblich sah ein Kind Anfang des 17. Jahrhunderts die Jungfrau Maria in der Nähe von Andacollo erscheinen. Grund genug, um den Ort für heilig zu erklären und eine riesige Kathedrale zu bauen. Heute weisen Historiker*innen darauf hin, dass Jungfrauerscheinungen von der spanischen Krone erfunden wurden, um religiöse Bräuche der Indigenen zu übertünchen und wertvolle Orte zu markieren. Archäologische Funde stärken die Vermutung, dass Andacollo schon vor der spanischen Krone ein wichtiger zeremonieller Ort war.
Heute leben in der Kleinstadt ungefähr elftausend Menschen, Vicencio ist einer davon. Im Gespräch erzählt er, wie die jungen Leute unter der Woche in benachbarte Städte pendeln. Denn hier gibt es im Unterschied zu früheren Zeiten kaum Arbeit. Bis Ende der 1990er-Jahre lebten die Menschen vom handwerklichen Goldabbau: Sie bohrten kleine Löcher in den Boden und wuschen dann das Gold mit Quecksilber aus der Erde, entweder zu Hause oder in den Dutzenden Werkstätten rund um die Stadt. Die giftigen Reste lagerten sie in Sandbergen gleich neben ihren Häusern ab.
In vier Kapiteln widmet sich das Lamm dem Bergbau in Andacollo. Der Fall zeigt exemplarisch auf, wie legaler Goldabbau im globalen Süden funktioniert und was dieser für die lokale Bevölkerung bedeutet.
- 1. Teil: Das verfluchte Gold
- 2. Teil: Widerstand gegen den sauren Regen
- 3. Teil: Im Sumpf der Behörden
- 4. Teil: Ein Hafen aus Gold
Vicencio begann im Alter von 26 Jahren in den kleinen Löchern der handwerklichen Goldminen zu graben – die einzige Arbeit, die er finden konnte. Er studierte in der nahe gelegenen Stadt La Serena und war Mitglied der Sozialistischen Partei, doch 1973 putschte sich das Militär an die Macht. Vicencio wurde inhaftiert und gefoltert, später kam er frei, doch sein Studium konnte er nicht fortsetzen und niemand wollte ihm wegen seiner linken Ideale einen Job geben. Also musste er in den Minen nach Gold suchen. Eine Arbeit unter Lebensgefahr, die er damals aber noch nicht ernst nahm.
Er erinnert sich: „Damals haben wir uns keine Sorgen um unsere Gesundheit gemacht. Wir fühlten uns immun.” Niemand habe Atemschutzmasken benutzt. Man habe Geld sparen und keine teuren Filter kaufen wollen. Aber gerade das Bohren von Sprenglöchern im Inneren der Mine und die anschliessende Explosion verursachen viel Staub, der Auslöser für Silikose ist.
Die klitzekleinen Staubpartikel setzen sich in der Lunge ab, können aber vom Körper nicht abgebaut werden. Dies führt zu Entzündungen und der Bildung von Bindegewebe in der Lunge. Das Atmen wird immer schwieriger, die Stimme wird heiser und schwächer, bis die Menschen buchstäblich ersticken.
Die Ärztin Muriel Ramírez von der Katholischen Universität des Nordens sagt, dass in Andacollo mehr Menschen an Lungenproblemen sterben als im Durchschnitt. Fünfzig Prozent mehr als auf nationaler Ebene. „Die Betroffenen sind hauptsächlich Männer über 60 Jahre, die seit Jahrzehnten in den Minen arbeiten und keine adäquaten Schutzelemente benutzt haben”, sagt sie.
Doch nicht nur die Bergarbeiter sind gemäss Ramírez betroffen: „Nach den Gesundheitsvorschriften dürfte hier eigentlich niemand leben.” Die giftigen Hügel mitten in der Stadt seien bereits Grund genug, zusätzliche Bauten zu verbieten. Doch die Realität sieht anders aus.
Anfang der 1990er-Jahre versuchte die neue demokratische Regierung, ausländische Investoren anzuziehen, und siedelte zwei Bergbauunternehmen in Andacollo an. Eine davon, die Dayton-Goldmine, ist inzwischen stillgelegt, während die andere, die Kupfer- und Goldmine von Teck, seit 1995 in den Anden in Betrieb ist und voraussichtlich bis 2031 weiterarbeiten wird.
Die grossen Minen verdrängten den handwerklichen Bergbau und lösten damit vormals ein Problem: Anstatt der Abraumhalden im Zentrum der Stadt baute man nun zwei riesige Stauseen, wo die giftigen Überreste weit über der Stadt gelagert werden. Traurig erinnert sich Vicencio daran, dass unter ihm die letzte natürliche Quelle im Tal begraben wurde. Mittlerweile wird das Wasser für die Mine und die Bevölkerung aus benachbarten Tälern hochgepumpt.
Andacollo bleibt bis heute eine kontaminierte Stadt. Laut dem Nationalen Dienst für Geologie und Bergbau gibt es mittlerweile 121 Abraumhalden in Andacollo.

Im Jahr 1996 begann Vicencio bei Teck zu arbeiten. Er war jung und bekam einen Job, nachdem viele kleine Bergwerke schliessen mussten und ältere Leute von den grossen Bergwerken abgelehnt wurden. Teck und Dayton siedelten über den besten Gold- und Kupferadern an, vertrieben die handwerklichen Mineur*innen, brauchten aber weitaus weniger Leute, als zuvor in den Löchern gearbeitet hatten.
Vicencio sagt, dass die Arbeitsbedingungen damals viel besser und der Lohn am Ende des Monats garantiert gewesen sei. Auch Schutzkleidung sei zur Verfügung gestellt worden. Doch mit den besseren Arbeitsbedingungen für die Arbeiter*innen begannen die Umweltprobleme.
Die Minen sind riesige offene Löcher. Bohrungen, LKW-Transport und vor allem Sprengungen verursachen gewaltige Staubwolken, die sich über Andacollo ausbreiten.
Das Ausmass ist erschreckend: Seit 2009 gilt Andacollo als „gesättigte Gemeinde”, eine Gemeinde, in der die Feinstaubbelastung den chilenischen Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Jahresdurchschnitt überschreitet. Zum Vergleich: Die Schweiz und die Weltgesundheitsorganisation haben den Grenzwert auf einen Jahresdurchschnitt von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft festgelegt.
Die Erklärung zur gesättigten Gemeinde bedeutet, dass in Andacollo keine neue Industrie angesiedelt werden darf. 2015 trat ein Plan zur Verringerung der Umweltverschmutzung in Kraft. Obwohl er als Fünf-Jahres-Plan zur „Erreichung normaler Luftqualitätsbedingungen” projiziert wurde, setzte man ihn im Jahr 2020 stillschweigend fort. Bis heute überschreitet Andacollo regelmässig die ohnehin schon hohen Grenzwerte. Und trotzdem soll die Mine von Teck erweitert werden.
Giftige Riesen
Neben den kleinen Häusern der Stadt thronen die gelben Riesen. Sandberge, die zum Teil schon vor Jahrzehnten verlassen wurden. Im fest gewordenen Sand sind Rillen zu erkennen, an denen an den wenigen Regentagen im Jahr das Wasser hinunterfliesst, direkt auf die Strasse und in die Gärten der Häuser. Giftiger Schlamm als Abschiedsgeschenk jahrhundertelanger Minenaktivitäten.
In der nächsten Strassenecke, ein kleines Krankenhaus – das einzige weit und breit. Marianela Rojas arbeitet hier, sie ist die Präsidentin der Gewerkschaft des Gesundheitspersonals CONFUSAM. Sie erzählt: „Unserer Gesundheit geht es schlecht, es gibt viele Atemwegserkrankungen aufgrund von Covid, aber auch wegen der Luftverschmutzung.”

Laut offiziellen Zahlen, die das Lamm per chilenischem Öffentlichkeitsgesetz zugänglich gemacht wurden, liegen die Herz- und Kreislaufkrankheiten, also jene, die zum Teil auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind, weit über dem nationalen Durchschnitt.
Im Jahr 2009 lag die Sterblichkeitsrate durch solche Krankheiten auf nationaler Ebene bei 49,8 pro 100’000 Einwohner*innen, während sie in der Gemeinde Andacollo 181,7 betrug, also mehr als das Dreifache der nationalen Rate. Bis 2019 hat sich der Unterschied zwischen dem nationalen Durchschnitt und der Gemeinde Andacollo verringert, bleibt aber deutlich höher. 72,6 Todesfälle pro 100’000 Einwohner*innen, gegenüber 110,8 in Andacollo. Auch die Kindersterblichkeit liegt mit 11,7 bei 1’000 lebend geborenen Kindern weit über dem nationalen Durchschnitt von 6,9.
Doch dem Spital der Stadt fehlt es an allem. Es wirkt heruntergekommen, die Farbe blättert von den Wänden ab, die Maschinen sind alt. Rojas erzählt, dass es kaum medizinische Spezialist*innen gebe, denn es fehle an Geld. Ausserdem wolle hier niemand wohnen. Für fast alle Eingriffe müsse man über die Passstrasse in die nächste Stadt Coquimbo, die rund 50 Kilometer entfernt liegt.
Andacollo ist mit derselben Realität konfrontiert wie viele andere Bergbaustädte Chiles: Die gesundheitlichen Einrichtungen sind in einem schlechten Zustand, die Bevölkerung leidet unter den Auswirkungen der Umweltverschmutzung.
Verschiedene Studien haben im Fall von Andacollo einen hohen Gehalt von Quecksilber in den Abraumhalden gemessen sowie eine besondere Gesundheitsgefährdung für die lokale Bevölkerung durch Feinstaub und Schwermetalle.
Eine 2012 von der School of Public Health der Universidad de Chile durchgeführte Studie untersuchte die gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder von Feinstaub aus Minenabfällen, die in der Bucht von Chañaral, nördlich von Andacollo in der Atacama-Region, abgelagert wurden.
Die Studie kommt unter anderem zum Schluss, dass die Atemwegsfunktion der untersuchten Schulkinder durch erhöhte Feinstaubwerte beeinträchtigt wird, was bei langfristigem Exponiertsein sogar zu chronischen Krankheiten führen kann. Verstärkt wird dies durch das Vorhandensein von Schwermetallen im Feinstaub, die Entzündungseffekte auf der Ebene des Lungenparenchyms hervorrufen können. Und so überrascht auch nicht, dass die Kindersterblichkeit mit zehn Fällen pro 1’000 fast doppelt so hoch ist wie im nationalen Mittel.
In Chañaral gibt es gerade einmal sieben Abraumhalden. Eine sehr viel geringere Menge als im benachbarten Andacollo.
Für Ivanna Olivares, eine Umweltaktivistin aus der Region von Coquimbo, spiegelt die Situation in Andacollo wider, was in vielen Gemeinden im chilenischen Norden geschieht: „Andacollo, Illapel und La Higuera sind die Gemeinden, in denen sich die meisten Altlasten in der Region sammeln. Ein Grossteil der Abfälle befindet sich innerhalb des Stadtgebiets, einige sogar in der Nähe von Wohnhäusern, Schulen oder Wasserläufen.” Dies beeinträchtige die Lebensmittelqualität, die Gesundheit, insbesondere der schwächsten Bevölkerungsgruppen wie Kinder und älteren Menschen.
Eine Studie aus dem Jahr 2020, die in Andacollo durchgeführt wurde, untersuchte den Zusammenhang zwischen der Feinstaubbelastung (PM10) und dem Vorhandensein von stillgelegten Bergwerksabfällen. Die Schlussfolgerungen sind eindeutig: „Die Emissionen aus stillgelegten und inaktiven Abraumhalden zeigen, dass das PM10-Inventar ansteigt, so dass es notwendig ist, die gesetzlichen Regelungen über Emissionsfaktoren zu ändern und an die chilenische Realität anzupassen.” Sprich: Die Halden sollten nicht weiter in der Stadt existieren, da sie eine enorme Feinstaubbelastung darstellen. Und: Die chilenische Norm erlaubt viel zu hohe Feinstaubwerte.

Gerne würde auch die Medizinerin Muriel Ramirez weitere Studien durchführen, doch es fehlt an Geldern und die öffentlichen Messanlagen entsprechen kaum den internationalen Standards. „Die einzige Messstation, die nicht dem Bergbauunternehmen gehört, wird weder akkurat noch regelmässig gewartet”, so Ramírez. Aufgrund dessen ist es unmöglich, die Daten als vertrauenswürdig einzuordnen. Das zuständige Umweltministerium sollte dringend Verbesserungen durchführen, hat dies bislang allerdings weder angekündigt geschweige denn umgesetzt.
Andacollo ist dadurch zu einem Paradebeispiel für eine durch Abraum kontaminierte Stadt geworden, doch das Problem der Bergbauabfälle ist ein landesweites. Der Mangel an staatlicher Aufmerksamkeit war einer der Hauptfaktoren für den unkontrollierten Bau der Halden.
Zwar wurde bereits im Jahr 1970 das erste Gesetzesdekret erlassen, das den Bau der Halden regelte. Doch es dauerte 37 Jahre, bis eine Verordnung erlassen wurde, die sich der Stilllegung von Abraumhalden widmete. Denn um die Absonderung von Schadstoffen zu verhindern, müssen die Halden versiegelt werden. So sind alle Abraumhalden, die zwischen 1970 und 2007 gebaut wurden, sich selbst überlassen – niemand ist für die Folgen verantwortlich.
Die Umweltaktivistin Ivanna Olivares meint, der Bergbau würde seine Kosten durch Umweltverschmutzungen wie den Bergbauhalden externalisieren. Der Gewinn geht, die Verschmutzung bleibt. Das Stichwort dafür ist Extraktivismus. Daher sei es für sie „eine Priorität, zu einem post-extraktivistischen Wirtschaftsmodell überzugehen, weil die Klimakrise dies verlangt, ebenso wie die tiefe Krise der Gemeinschaften und Gebiete, die für die Aufrechterhaltung dieses wirtschaftlichen Modells geopfert wurden”, schliesst sie.
Für die Gewerkschafterin Rojas ist die Ungerechtigkeit offensichtlich. Sie erinnert sich, dass das Bergbauunternehmen Teck in Kanada ein neues Krankenhaus in der Nähe seiner Bergbauanlagen gebaut hat, in Chile hingegen nicht.
Diese Kombination vom Abbau natürlicher Ressourcen, der fehlenden Gewinnbeteiligung der lokalen Bevölkerung und der Zerstörung der Umwelt birgt Konfliktpotenzial. Nach Angaben des chilenischen Nationalen Instituts für Menschenrechte (INDH) kämpfen an 128 Orten im ganzen Land Menschen gegen konkrete Umweltprobleme, ausgelöst durch die ansässige Industrie. 27 Prozent davon stehen in direktem Zusammenhang mit dem Bergbau, wobei die Menschen vor allem das Menschenrecht auf eine gesunde und schadstofffreie Umwelt einfordern.
Auch in Andacollo hat sich die Bevölkerung mehrmals gegen die Verschmutzung erhoben. Hector Vicencio war jeweils dabei, heute kämpft er weiter gegen die Umweltverschmutzung. Doch es wirkt wie ein Kampf gegen Windmühlen.

Diese Reportage wurde mit Unterstützung von JournaFONDS recherchiert und umgesetzt.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?