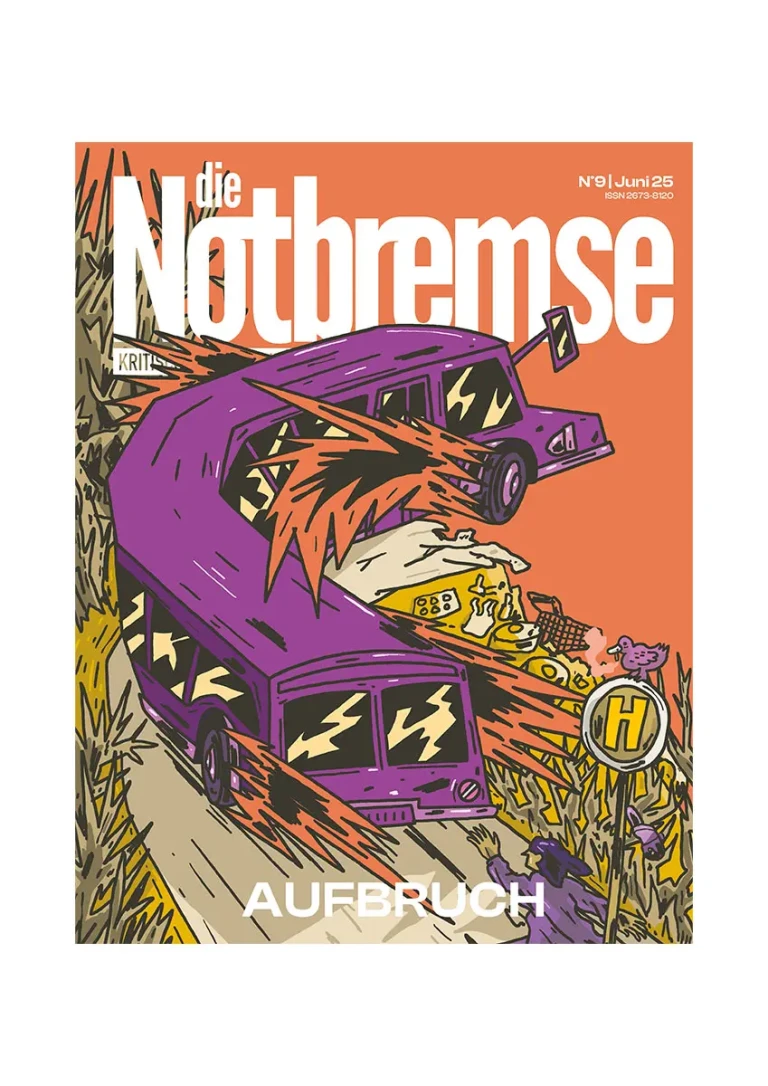„Wie viel Mal schlafen” von Nekane Txapartegi, Iraitz Lizarraga Gomez und Izaro Lizarraga Galdos
Die Idee für das Bilderbuch hatte die baskische Autorin Nekane Txapartegi, als sie als politische Gefangene inhaftiert war. Mit Briefen blieb sie über die Gefängnismauern hinweg mit ihrer jungen Tochter in Verbindung. Darin erzählten sie sich Geschichten aus einer Fantasiewelt, in der sie Piratinnen sind. Ihr Schatz: Die baskische Sprache, die sie mal verstecken, mal verteidigen müssen.
„Wie viel Mal schlafen” erzählt von einer kämpferischen Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die der Staat voneinander trennte. Und davon, wie sehr Kinder unter Repression leiden – aber auch gegen sie ankämpfen, auf ihre ganz eigene Art.
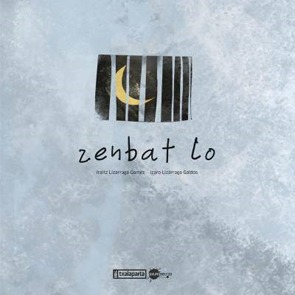
Nekane Txapartegi, Iraitz Lizarraga Gomez und Izaro Lizarraga Galdos: „Wie viel Mal schlafen.” Übersetzung aus dem Baskischen: Garazi Ugalde und Lena Pritschard. Txalaparta Verlag, 2024. Bei Paranoia City Buchhandlung erhältlich.
„Die Notbremse”
Was gibt es Besseres, als politische Themen, die zugänglich, witzig und spannend erzählt sind? In den Comics von der Notbremse erzählen die Autor*innen gesellschaftsrelevante Geschichten, verpackt in ausgeklügelten Illustrationen.
Die kürzlich erschienene neunte Ausgabe des Magazins widmet sich dem Thema Aufbruch und stellt die Frage, wie unsere Gesellschaft auf die besorgniserregenden politischen Entwicklungen unserer Zeit reagieren kann.
Notbremse Magazin. Kritische Comics zur Gegenwart. Im Eigenverlag.
„Ich möchte nicht die perfekte Geschichte schreiben” von Mani Owzar und Binta Kopp
Autor*in Mani Owzar und Fotografin Binta Kopp porträtieren in diesem Buch queere, rassifizierte Aktivist*innen aus der Schweiz. Dabei geht es um Personen, die sich für Diversität in der Kulturbranche einsetzen, in der Öffentlichkeit mehr Sichtbarkeit für queere, rassifizierte Personen schaffen und für politische Rechte kämpfen.
Das Buch entstand im Kontext der rechtsextremen Angriffe auf die Drag-Story-Time in Zürich und möchte dazu beitragen, das Gefühl der Ohnmacht zu überwinden und neuen Mut zu schöpfen.
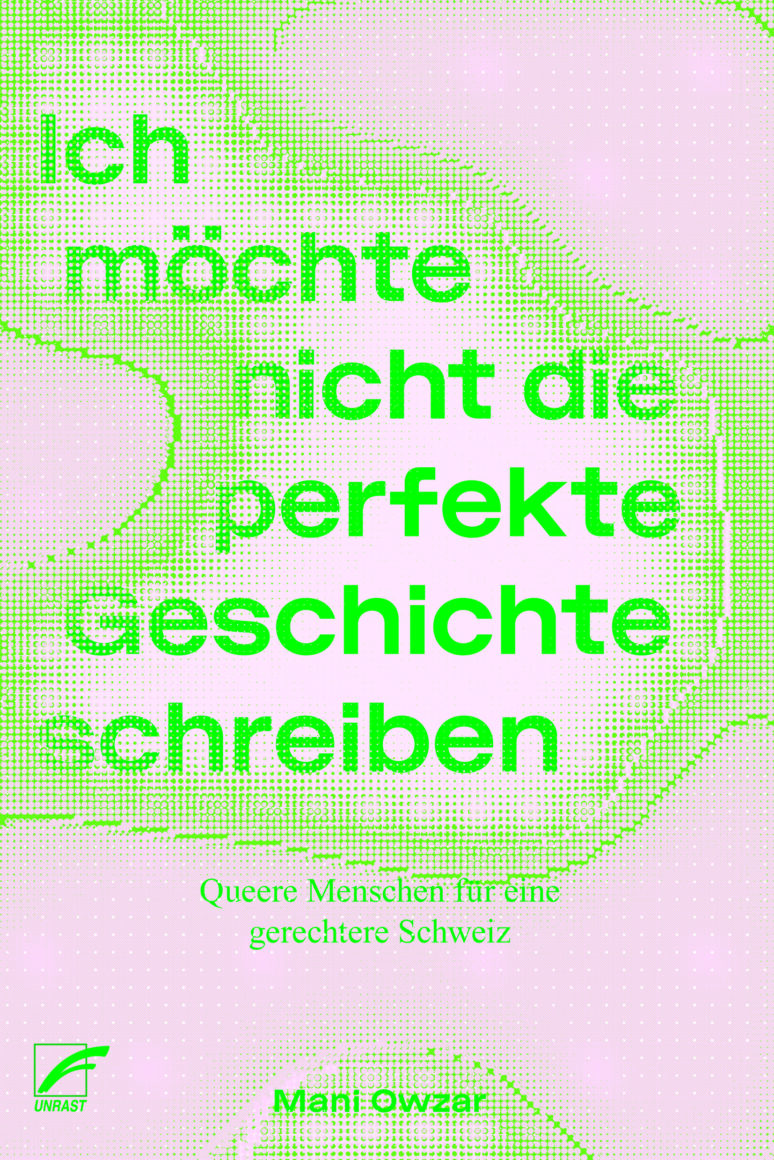
Mani Owzar und Binta Kopp: „Ich möchte nicht die perfekte Geschichte schreiben. Queere Menschen für eine gerechtere Schweiz”, Unrast Verlag 2025. Bei Paranoia City Buchhandlung erhältlich.
„What do we want?” von Cyrill Hermann
Am 20. August 2018 begann Greta Thunbergs Protest vor dem schwedischen Parlament, der eine weltweite Schüler*innenbewegung gegen die Klimakrise auslöste – auch in der Schweiz, wo Cyrill Hermann aktiv wurde. Im Buch gibt der*die Klimaaktivist*in Einblick in die letzten sechs Jahre Klimabewegung und diskutiert ihre strategischen Überlegungen sowie die Verbindung von Neokolonialismus und Klimakrise.
„Wenn wir etwas aus der Pandemie gelernt haben, dann das: Die Politik ist fähig zu handeln, und zwar schnell.”
Cyrill Hermann in „What do we want?”
So kommen aktivistische Stimmen aus Weltregionen zu Wort, die nach Jahrhunderten kolonialer Ausbeutung besonders stark von den Folgen der Klimakrise betroffen sind.
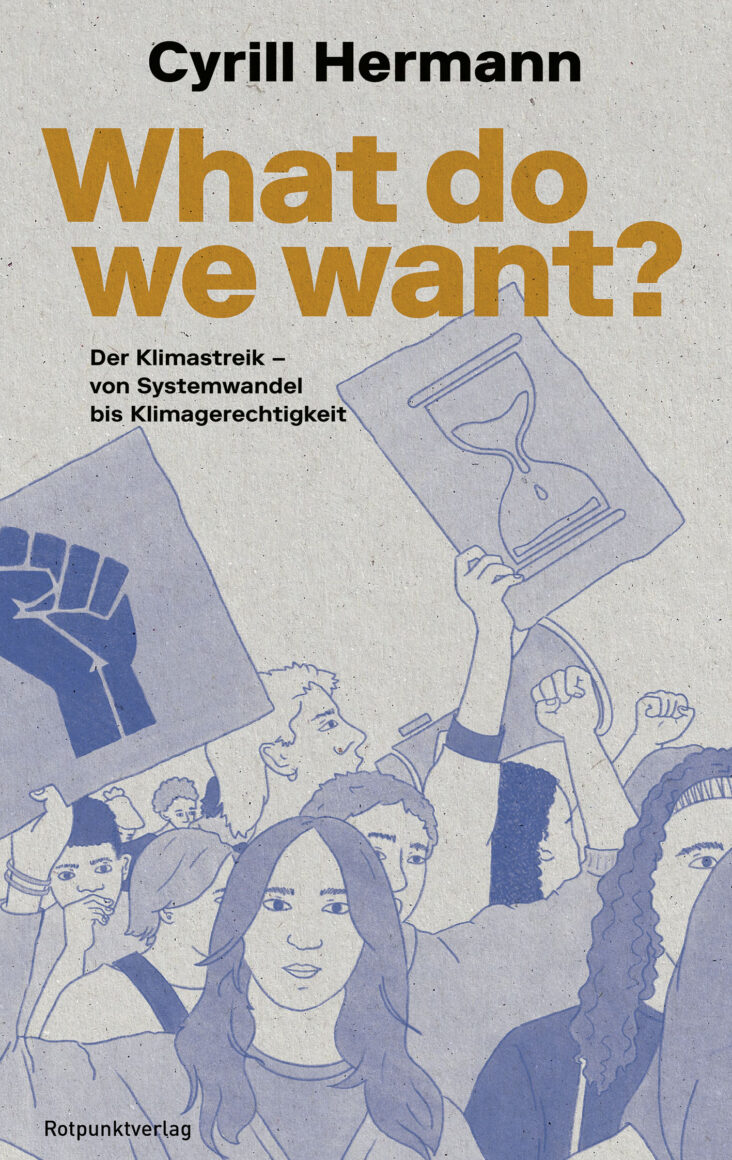
Cyrill Hermann: „What do we want?”, Rotpunktverlag 2025. Bei Paranoia City Buchhandlung erhältlich.
„RadioDock” von Ana Scheu Amigo und Anaïs Bourgogne
„RadioDock” heisst der brandneue Podcast der beiden Zürcher*innen Ana Scheu Amigo und Anaïs Bourgogne. Der dokumentarische Podcast legt da an, wo persönliche Geschichten zu finden sind, die viel über die Welt erzählen, in der wir leben. In der ersten Folge geht es um die Massenkündigungen der Sugushäuser in Zürich und um fünf Bewohnerinnen, die davon berichten, was die Kündigung mit ihnen gemacht hat – und wie sie sich gemeinsam gewehrt haben.

Ana Scheu Amigo, Anaïs Bourgogne: „RadioDock”.
„Im Meer waren wir nie” von Meral Kureyshi
Die namenlose Ich-Erzählerin zieht gemeinsam mit ihrer Kindheitsfreundin Sophie deren Sohn Eric gross und kümmert sich gleichzeitig um die lebensmüde 94-jährige Lili, Sophies Grossmutter.
„Unter Wasser ist der einzige Ort, wo ich nichts denke.”
Namenlose Ich-Erzählerin in „Im Meer waren wir nie”
In melancholischer Sprache erzählt die Berner Autorin Meral Kureyshi in ihrem Roman „Im Meer waren wir nie” von Familie in all ihren Formen, von Migration und Herkunft – und von der unaufgeregten Fürsorge und Solidarität unter verschiedenen Frauengenerationen.
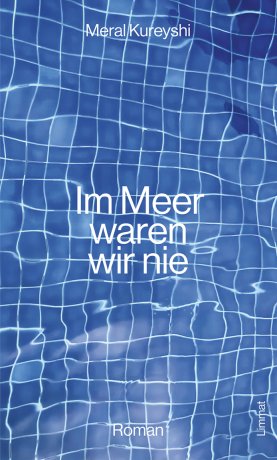
Meral Kureyshi: „Im Meer waren wir nie”, Limmat Verlag 2025. Bei Paranoia City Buchhandlung erhältlich.
„Was ich dir nicht sage” von Anja Nunyola Glover
Für ihr erstes Buch „Was ich dir nicht sage” fand die Antirassismus-Expertin Anja Nunyola Glover keinen Verlag. Eine Absage wurde sogar damit begründet, man habe „schon ein Buch einer Schwarzen Frau veröffentlicht”. Kurzerhand veröffentlichte Glover ihr Buch selbst – und landete damit mehrere Wochen auf der Schweizer Bestsellerliste.
„Oft wurde mir schon vorgeworfen, dass ich, wenn ich immer und überall nach Rassismus suchen würde, ihn auch überall finden würde. Genau so ist es.”
Anja Nunyola Glover in „Was ich dir nicht sage”
Glover schreibt für das Mädchen, das sie einmal war. Nicht um Rassismus zu definieren, sondern um zu zeigen, was er mit Menschen macht: mit ihrem Körper, ihrer Psyche und ihrer gesellschaftlichen Position.
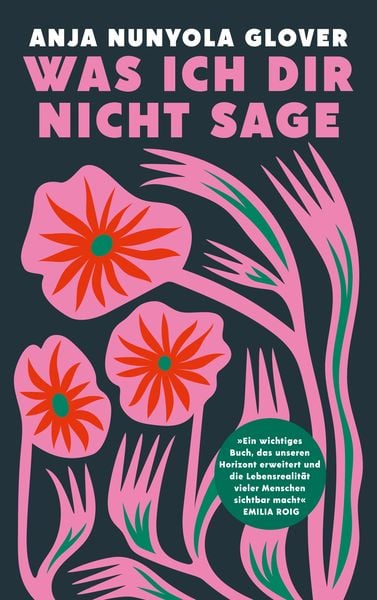
Anja Nunyola Glover: „Was ich dir nicht sage”, nunyola agentur 2024. Bei Paranoia City Buchhandlung erhältlich.
„Bolo’Bolo” von P.M.
P.M. präsentierte 1983 in Bolo’Bolo eine konkrete anarchistsiche Utopie. Diese basiert auf kleinen Gemeinschaften (sog. bolos), die autonom voneinander agieren und kooperieren. Mit wenig Dogma, dafür viel 80er-Kreativität fragt das längst kultige Buch: Wollen wir unseren Planeten völlig zerstören? – Nein. Also sollten wir in bolos leben. Wir haben die Wahl: Ob Biblio-bolo, Bi-bolo, Poly-bolo, Marx-bolo, Vegibolo, Basket-bolo, Baby-bolo, Punko-bolo, … oder einfach im: Normalo-bolo. Und für die, die sich vom 80er-Schalk nicht abgeholt fühlen, meinte P.M. mal: „Bolo’bolo heisst ja eigentlich nichts anderes als Kommunismus.”
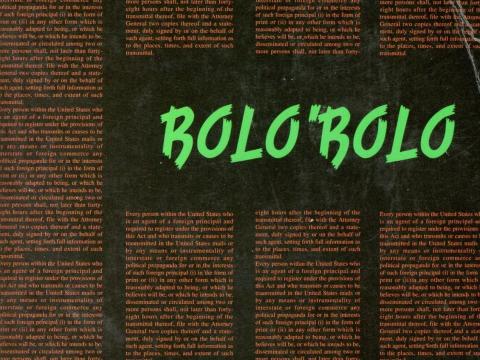
P.M.: „Bolo’Bolo”, Paranoia City Verlag in den 80ern. Bei Paranoia City Buchhandlung erhältlich.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 6 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 572 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 210 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 102 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?