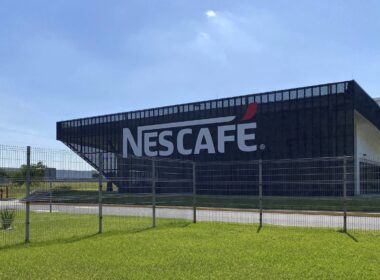In Topolobampo geht die Sonne auf. Hier an der westmexikanischen Pazifikküste bereitet sich der Fischer Marcos Figuera Villegas darauf vor, mit seinem kleinen Boot in die Lagunenlandschaft zu fahren. Kurz vor Abfahrt in die Bucht von Ohuira, die für ihre Feuchtgebiete und den Reichtum an Meerestieren bekannt ist, grüsst er andere Fischer*innen. Einige tragen T‑Shirts mit der Aufschrift „Aquí no” – hier nicht – sowie gleichlautende Aufkleber auf den Motoren ihrer Boote.
Die Stimmung ist getrübt, denn in unmittelbarer Nähe baut der deutsch-schweizerische Konzern Proman eine Ammoniakfabrik für die Produktion von Düngemittel. Eine tickende Zeitbombe für die einzigartige Natur, wie einige Fischer*innen behaupten.
Als der Aussenbordmotor anspringt, verstaut Figuera sein Handy in einer umgebauten PET-Flasche. „So kann ich es hören, wenn der Motor läuft”, sagt er. In der Ferne sind kleine Boote zu sehen, die ihre Netze einholen, während Pelikane und andere Vögel auf der Suche nach Nahrung über ihnen kreisen.
Topolobampo liegt im mexikanischen Bundesstaat Sinalona – weltweit bekannt aufgrund des gleichnamigen Drogenkartells von Sinaloa, das es regelmässig in die europäischen Nachrichten schafft. Auf den ersten Blick ist in der Bucht von Topolobampo wenig von den illegalen Machenschaften zu spüren. Hier leben die Menschen seit Jahrzehnten von der Fischerei und dem Tourismus. Doch all dies, so sagen die Fischer*innen, ist nun durch die mexikanische Tochtergesellschaft GPO des Konzerns Proman bedroht.
Inmitten der Bucht will Proman eine Ammoniakfabrik bauen. Als Teil des nationalen Infrastruktur-Investitionsabkommens der mexikanischen Regierung plant Proman, 1.2 Milliarden Dollar in die Anlage zu investieren, die 2’200 Tonnen Dünger für Mexiko, Asien, Kalifornien und Südamerika produzieren soll. Finanziert wird das Projekt ausschliesslich von der deutschen KfW IPEX-Bank mit Sitz in Frankfurt.
Proman konzentriert sich auf die Herstellung von Ethanol und Düngemitteln. Bei Letzterem ist Ammoniak ein wichtiger Bestandteil. Gegründet wurde das Unternehmen in Deutschland. Im Jahr 1994 hat es den Hauptsitz schrittweise nach Wollerau im Kanton Schwyz verlegt – ein Tiefsteuerort. In Wollerau teilt es sich einen Bürokomplex mit mehreren anderen Unternehmen, die Produktion findet derweil woanders statt.

Seit 2013 steht eine unfertige Fabrikanlage auf dem Gelände der Proman in Topolobampo. Die Bewohner*innen der anliegenden Ortschaften haben sich nun zusammengeschlossen, um den Ausbau und die Inbetriebnahme der Fabrik zu verhindern, da die Gefahr besteht, dass Feuchtgebiete in der Gegend weiter zerstört werden und der Fischbestand zurückgehen könnten.
Gemeinsamer Kampf
Dutzende von Aktivist*innen und deren Familien versammeln sich an einem Donnerstagabend auf einem überdachten Platz, der nur wenige Schritte vom Schiffsanleger von Topolobampo entfernt ist. Am Eingang hängt ein Transparent, das sich direkt an den Präsidenten Andrés Manuel López Obrador richtet: „Herr Präsident, wir Fischer vertrauen Ihnen: Nein zur Ammoniakanlage”, steht in grossen Lettern geschrieben.
López Obrador hat versprochen, die vom Bau betroffenen Gemeinden anzuhören. Doch die bisherigen Konsultationsverfahren stellen die Bewohner*innen nicht zufrieden.
„Aquí no” ist der Name des Kollektivs, in dem sich Angehörige der indigenen Volksgruppen der Mayo und Yoreme, Fischer*innen und Beschäftigte des Tourismus im Norden Sinaloas zusammengeschlossen haben. Das Kollektiv organisiert sich weit über Topolobampo hinaus.
Sie sind überzeugt, dass durch die Anlage 4‘500 Fischer*innen direkt in ihrem Lebensunterhalt bedroht würden. Besonders erschrecken tut sie die Risikoeinschätzung des Unternehmens selbst. Diese geht davon aus, dass ein Leck in den Ammoniakleitungen der zukünftigen Anlage von nur 3.6 Zoll, etwa 10 Zentimeter, für so gut wie alles Leben im Umkreis von zwei Kilometern tödlich sein könnte.

In Pressekonferenzen gingen Vertreter*innen des Unternehmens von einer geringen Wahrscheinlichkeit solcher Lecks aus. Doch ungenaue Angaben zur möglichen Menge an Ammoniak, die bei einem Leck auftreten könnte, bis die Ventile geschlossen sind, nähren die Angst der Bevölkerung. Gerade Explosionen wie jene im Hafen von Beirut in Libanon vor zwei Jahren, bei der ein riesiges Ammoniaklager detonierte, bestärken die Befürchtung der Bevölkerung, dass auch in dem von Korruption, Misswirtschaft und fehlender Kontrolle geplagten Mexiko ähnliche Vorfälle stattfinden könnten.
Im Konflikt mit den Indigenen
Die mehrheitlich indigene Bevölkerung der Umgebung ist wütend. Sie sieht sich ihrer Rechte beraubt. Verschiedene Orte in der Bucht von Topolobampo gelten für Indigene zudem als rituelle Stätten. Rund zehn davon verteilen sich an den Ufern der Bucht.
Eigentlich müsste aufgrund des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation zum Schutz indigener Völker, kurz ILO 169, das von Mexiko unterzeichnet ist, jedes grössere Infrastrukturprojekt in einem indigenen Gebiet von der Bevölkerung bewilligt werden.
Doch erst nach mehreren Jahren des Kampfes fand am 9. und 10. Juli 2022 die lang erwartete Anhörung der Indigenen statt. In 12 von 13 Versammlungen, die in mehreren Ortschaften abgehalten wurden, stimmte die Mehrheit für den Bau und Betrieb der Anlage.
Wie repräsentativ dieses Ergebnis ist, bleibt dahingestellt, denn mehrere Gemeinden nahmen gar nicht erst an der Versammlung teil. Sie kritisierten die im Vorhinein fehlende Aufklärung und forderten einen Aufschub der Entscheidung, damit sich die Bevölkerung informieren kann.
Die Gegner*innen der Anlage behaupten zudem, dass Stimmen gekauft worden seien. Es sollen sogar Befürworter*innen mit dem Lastwagen an die Versammlungsorte für die Abstimmung gebracht worden sein. Der Kleinfischer René Santos kritisierte zudem stellvertretend für viele seiner Mitstreiter*innen, dass viele Gemeinden mitbestimmen durften, obwohl sie weit entfernt von der „Zeitbombe” leben und somit auch nicht direkt betroffen seien.
Dort, im Hinterland, wäre das Argument der Arbeitsplätze deutlich ausschlaggebender als die unmittelbare Zerstörung der Natur, so Santos. Der Gouverneur von Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reagierte mittlerweile auf die Kritik der indigenen Gemeinden an der Rechtmässigkeit des Verfahrens und kündigte an, dass der Oberste Gerichtshof Mexikos über die Gültigkeit der Abstimmung entscheiden wird.
Ein Naturheiligtum
Die Lagunen um Topolobampo gelten als sogenanntes Ramsar-Gebiet. Die Bezeichnung stammt aus einem Abkommen, das im Jahr 1971 in der gleichnamigen iranischen Stadt unterzeichnet wurde und die sinnvolle Nutzung von Feuchtgebieten und ihren Ressourcen regelt. Etwa 90 Prozent der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen sind dem Abkommen mittlerweile beigetreten.
Die Bucht wird in einer weltweiten Liste von Feuchtgebieten von Bedeutung für das Ökosystem des Planeten aufgeführt und ist wichtiger Rastort für Zugvögel. Trotz der Bezeichnung als Ramsar-Gebiet, gibt es derzeit keinen besonderen rechtlichen Schutz der Lagunenlandschaft.

Schon jetzt hat der Bau der bislang noch nicht in Betrieb genommenen Anlage Teile des Feuchtgebietes zerstört. Beim Bau des Fabrikgeländes im Jahr 2013 wurden Teile der Sumpflandschaft mit einem Steinwall bedeckt und ein Mangrovenwald abgeholzt.
Irritierenderweise behauptet das mexikanische Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (SEMARNAT) in seiner 2018 veröffentlichten Umweltverträglichkeitsprüfung das Gegenteil: „Das Projekt erfordert nicht die Beseitigung irgendeiner Art von Waldvegetation oder die Änderung der Landnutzung auf Waldland.”
Diana Escobedo Díaz, Forscherin am Nationalen Polytechnischen Institut von Mexiko, war an der Ausarbeitung eines Manifests über die Umweltauswirkungen des Baus der Anlage beteiligt und gehört zu den Gegner*innen des Projekts. Sie weist darauf hin, dass das Gebiet der Lagune bereits heute durch ein nahe gelegenes Stromkraftwerk geschädigt wird und rät daher dringend davon ab, weitere Schäden am Umweltsystem hinzunehmen.
Das Naturgebiet ist aufgrund seiner Artenvielfalt und den dort beheimateten Delfinen und Walen ein Tourismusmagnet. Jüngste Infrastrukturprojekte der Regierung sollen diesen Wirtschaftssektor weiter ausbauen. Eine Schädigung der Natur hätte dramatische Auswirkungen auf den Tourismus, befürchten manche Anwohner*innen.
Auch der Betrieb der Anlage könnte, ganz ohne besondere Vorkommnisse, erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, so Joel Retamoza López, Sprecher der Umweltallianz von Sinaloa. Er weist darauf hin, dass bei der Ammoniakproduktion Wasser aus der Bucht zur Kühlung der Anlage verwendet wird. Das wieder abgeleitete und erwärmte Kühlwasser könnte die unmittelbare Wassertemperatur und damit das Ökosystem beeinträchtigen, meint der Umweltaktivist.

Das Unternehmen Proman hält sich derweil bedeckt. Auf Medienanfragen von das Lamm gingen bis Redaktionsschluss keine Antworten ein. Auf der Webseite lassen sich keine Medienmitteilungen zum Bau der Fabrik finden. Einzig die Jahresberichte des Unternehmens erwähnen den – zum Unbehagen des Unternehmens – langsamen Fortschritt beim Bau der Anlage und die damit verbundenen finanziellen Risiken.
Statt auf Kritik einzugehen, versucht sich Proman auf dem internationalen Ethanolmarkt als grösster Anbieter zu etablieren. Die Webseite wirbt mit Unternehmensverantwortung im Umweltbereich, Hilfe bei der Bekämpfung von Armut und den Auswirkungen der Klimakrise auf die lokale Bevölkerung von Ländern, in denen das Unternehmen aktiv ist.
Vermutlich fehlte es dem Projekt in Topolobampo lange Zeit an einer vollständigen Finanzierung. Zwar begannen 2013 die Bauarbeiten für die Fabrik, doch das halb fertige Gelände lag lange Zeit brach. Erst ein Kredit von 1.2 Milliarden Dollar von der deutschen KfW IPEX-Bank im Jahr 2020 ermöglichte die Fortsetzung der Bauarbeiten. Die KfW IPEX-Bank ist eine staatliche Kreditanstalt, die zum Auftrag hat, Exporte deutscher Unternehmen zu fördern.
In einer Medienmitteillung aus dem Jahr 2020 wird angegeben, dass von den 1.2 Milliarden US-Dollar, die für den Bau der Anlage benötigt werden, mehr als die Hälfte für den Kauf von Maschinenteilen aus verschiedenen Ländern Europas verwendet werden. Als Teil des Kredits verpflichtete sich Proman dazu, die nahe gelegenen Mangrovenflächen, die vormals durch den Bau zerstört wurden, zu regenerieren und die lokale Kleinfischerei zu unterstützen.
Wie das Versprechen umgesetzt werden soll, beschreibt das Unternehmen derweil nicht.
Langer Atem
In dem Dorf Lázaro Cárdenas, gegenüber von Topolobampo, auf der anderen Seite der Lagune, bricht die Nacht ein. Menschen bewegen sich in Richtung Stadtzentrum. Auch hier findet eine Versammlung zu der Ammoniakanlage und ihren Auswirkungen statt.
Manche Fischer*innen äussern die Meinung, dass die Fischbestände bereits zu stark zurückgegangen sind und dass es besser wäre, auf ein anderes Geschäft umzusteigen, da die Fischerei nicht mehr rentabel sei. Das Unternehmen hat ihnen besser bezahlte Arbeit, Bildungsstipendien, medizinische Versorgung und sogar Lebensmittel angeboten.
Am Anleger steht der Fischer René Álvarez. Er berichtet von langen Tagen mit wenig ergiebigem Fang. In seiner Hand hält er eine Box mit frisch gefangenen Krabben.
Die Anlage von Proman ist in der Ferne am Horizont der Bucht zu sehen, die Fischerboote nähern sich ihr nicht. Alvárez meint: „Ich werde weiter fischen, solange ich kann, und wir werden weiterkämpfen”, während er den Motor seines Bootes mit dem Satz „Aquí no” ein weiteres Mal anschmeisst.
Artikel aus dem Spanischen übersetzt von Malte Seiwerth.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?