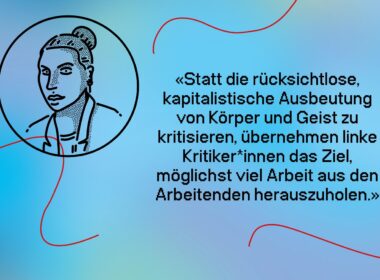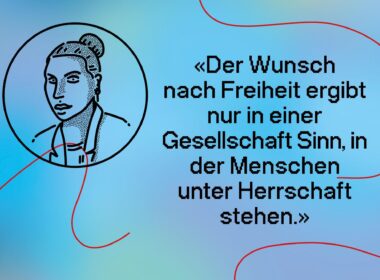Am Valentinstag haben mein Freund und ich uns statt Schokolade und Blumen einen Konsens-Workshop gegönnt. Organisiert wurde die Veranstaltung von „Die Feministen”, durchgeführt wurde sie von „Zwischenwelten” – zwei Vereine, die ich wärmstens empfehlen kann.
Passend zum heteronormativen Kitsch-Feiertag ging es grundsätzlich um Konsens beim Sex beziehungsweise Konsens in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es war ein schöner, intensiver Abend, an dem wir viel zugehört, gefragt und geübt haben.
Bei mir ist nach den drei Workshop-Stunden vor allem ein Aspekt hängen geblieben: Wir können Konsens – also die Einwilligung aller Teilnehmenden in eine Handlung – erst dann herstellen, wenn wir unsere eigenen Grenzen spüren und kommunizieren können. Und obwohl das logisch klingt, überspringen wir diesen Punkt erstaunlich oft.
Beim Konsens-Einholen geht es eben auch um den Konsens mit sich selbst.
Wir wissen manchmal gar nicht, was wir wollen, weil wir es uns nicht gewöhnt sind, in uns hineinzuhören. Und wenn wir wissen, was wir möchten, hält uns je nachdem Angst, Scham oder Unsicherheit allzu oft davon ab, es zu kommunizieren. Wir möchten die Gefühle des Gegenübers nicht verletzen, wollen selbst keine Ablehnung erfahren oder fühlen uns nicht wohl genug, um uns zu öffnen.
Grenzen und Fragen
Es geistert – wenig hilfreich – die Vorstellung herum, dass Grenzen setzen etwas Negatives sei. Wenn ich eine Einladung zum Abendessen ablehne, bin ich unsozial. Wenn ich meinem Kollegen nicht beim Zügeln helfe, bin ich ein*e schlechte*r Freund*in. Wenn ich die neue Sexpraktik, die mein*e Sexualpartner*in vorgeschlagen hat, nicht ausprobieren möchte, bin ich prüde.
Ob das von meinen Mitmenschen tatsächlich so wahrgenommen wird, ist eine andere Frage. Nur schon, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie negativ auffalle oder unsympathisch wirke, kann dazu führen, dass ich meine eigenen Grenzen schliesslich ignoriere. Dabei profitiere nicht nur ich selbst, sondern alle um mich herum davon, wenn ich klar sagen kann, was ich will und was nicht. Wenn mein Gegenüber darauf vertrauen kann, dass ich Nein sage, wenn ich etwas nicht will, kann es auch meinem Ja umso mehr Vertrauen schenken.
Dabei möchte ich nicht sagen, dass es die Hauptverantwortung der Person ist, die etwas nicht möchte, Nein zu sagen. Sondern, dass es beim Konsens-Einholen eben auch um den Konsens mit sich selbst geht. Und das ist eine Aufgabe, die einem leider niemand abnehmen kann.
Wenn wir uns endlich darauf einigen, dass Konsens die Grundlage für eine (sexuelle) Handlung ist, kann eine Handlung in Abwesenheit von Konsens nur Gewalt bedeuten.
Das Ganze tönt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Wir navigieren Konsens jeden einzelnen Tag, und wir sind meistens relativ gut darin. Wenn wir ein fremdes Haus betreten möchten, klingeln und warten wir; wenn wir zusammen eine Pizza bestellen, einigen wir uns auf den Belag; wenn wir uns etwas ausleihen möchten, fragen wir zuerst die Eigentümerin. Und wenn ein „Nein” als Antwort kommt, hören wir auf oder suchen nach einer anderen Lösung.
Sobald es dann aber um Sex geht, haben wir das Gefühl, dass wir die Gedanken des Gegenübers lesen können (oder müssen) und fragen darum gar nicht mehr nach. Das führt zu absurden Situationen, Grenzüberschreitungen und nicht zuletzt sexualisierter Gewalt.
Sex im Patriarchat
Konsens ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wird Konsens sehr positiv wahrgenommen und auch verkauft; wir wollen das umsetzen, wir können das leben, nachzufragen ist sexy, ein explizites Ja ist wichtig.
Andererseits sprechen wir als Gesellschaft erst seit wenigen Jahren darüber. Die Schweizer Politik debattiert immer noch, ob die Konsenslösung ins Gesetz geschrieben werden soll oder ob „Nein heisst Nein” nicht doch eigentlich reicht. Spoiler: Tut’s nicht. Wenn wir uns dann aber endlich darauf einigen, dass Konsens die Grundlage für eine (sexuelle) Handlung ist – ja, sein muss –, kann eine Handlung in Abwesenheit von Konsens nur Gewalt bedeuten. Und wie sollen wir als Gesellschaft, aber auch als Individuen mit diesem Fakt umgehen können?
Der erste Schritt ist, das gravierende Ausmass dieser Erkenntnis nicht zu leugnen, und es dann aber genauso wenig zu akzeptieren.
Habt ihr schon mal Sex initiiert, obwohl ihr eigentlich einfach gehalten werden wolltet?
Kim Posster hat in analyse & kritik zu dieser Doppeldeutigkeit eine sehr spannende Frage gestellt: „Was also, wenn man davon ausgehen muss, dass Menschen und vor allem cisgeschlechtliche Männer im Patriarchat auch ‘wahre Bedürfnisse’ entwickeln, die mit Konsens grundsätzlich unvereinbar sind?”
Ich kann diese Frage nicht beantworten und möchte euch eigentlich vor allem den zitierten Text ans Herz legen. Denn als Teil der privilegierten und gewaltausübenden Gruppe habt ihr, liebe Männer, eine Verantwortung, euch intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
In unserer Gesellschaft werden weiblich gelesene Personen in Bezug auf Sex generell als Objekte gesehen, die selbst kaum Lust empfinden, dafür aber dem Lustgewinn anderer dienen sollen. Dagegen kämpfen Feminist*innen schon seit Jahrzehnten an. Gleichzeitig werden auch Männer in Bezug auf Sex eingegrenzt. Es gibt zum einen das weitverbreitete Stereotyp, dass jeder Mann zu jeder Zeit Lust auf Sex hat. Das schürt falsche Erwartungen und baut bei besagten Männern einen riesigen Druck auf.
Zum anderen hat der ehemalige The Daily Show-Host und Comedian Trevor Noah die interessante These aufgestellt, dass viele Männer nur über Sex wirklich Intimität erleben dürfen. Auch das hat mit Konsens zu tun. Habt ihr schon mal Sex initiiert, obwohl ihr eigentlich einfach gehalten werden wolltet?
Damit ihr Konsens navigieren könnt, müsst ihr euch selbst im Klaren darüber sein, was ihr wollt und braucht. Wenn ihr das kommuniziert, könnt ihr erst damit anfangen, eurem Gegenüber zuzuhören.
Und wie kommt ihr an diesen Punkt? Na, durch Üben natürlich.
Lohnungleichheit, unbezahlte Care-Arbeit, sexualisierte Gewalt, aber auch der Kampf gegen toxische Maskulinität, die Abschaffung der Wehrpflicht und homosoziale Gewalt sind feministische Themen – und werden als „Frauensache“ abgestempelt. Dadurch werden diese Themen einerseits abgewertet, andererseits die Verantwortung für die Lösung dieser Probleme auf FINTA (Frauen, inter, non-binäre, trans und agender Personen) übertragen.
Das ist nicht nur unlogisch, sondern auch unnütz: Die Ursache des Problems liegt nicht auf der Betroffenen‑, sondern auf der Täterseite. Es sind eben Männersachen. Deshalb müssen Männer als Teil der privilegierten Gruppe Verantwortung übernehmen und diese Probleme angehen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?