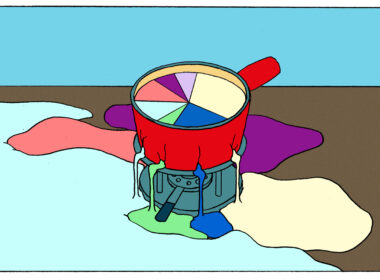Wie schlimm steht es wirklich um die Welt? Das weiss niemand ganz genau. Eine Nachricht jagt die nächste – wie einen Überblick gewinnen, das Chaos ordnen? Wir helfen, indem wir ausgewählte News häppchenweise servieren und einordnen. So liefern wir Ihnen einmal pro Monat Anhaltspunkte zur Lage der Welt aus Lamm-Sicht.
Heute: 13 Milliarden pro Jahr für die Armee // Frankreich zwingt Grossunternehmen zu mehr Sorgfalt // Die CS liefert ein Beispiel, wieso es vielleicht gerade das, was Frankreich tut, auch in der Schweiz braucht
Bad News 1: Die FDP will plötzlich eine Riesenarmee
Was ist passiert? FDP-Nationalrat Thierry Burkart hat einen Vorschlag gemacht, der eigentlich nur mit solider kognitiver Dissonanz begründet werden kann: Das Armeebudget solle mehr als verdoppelt werden. 13 statt 5 Milliarden Franken will Burkart jedes Jahr für die Armee ausgeben. Der Grund? Die geopolitische Lage. Schliesslich wisse man nicht, wann der nächste Krieg ausbreche.
Weshalb ist das wichtig? Traditionell kämpft vor allem die SVP für höhere Militärausgaben. Es gibt aber im gesamten Bürgerblock AnhängerInnen eines grösseren, stärkeren Militärs. Nur hat das gemeinsame höhere Interesse eines ausgeglichenen Staatsbudgets diese bis jetzt von solchen Hirngespinsten abgehalten. Dass sich nun Verteter der FDP öffentlich mit solchen Vorschlägen zu Wort melden und die SVP rechts überholen, ist daher bemerkenswert.
Aber: Der Vorschlag ist so abgefahren, dass er im Parlament keine Chance haben wird. Auch wurde vergangene Woche bekannt, dass das Verteidigungsdepartement aufgrund der von den Bürgerlichen selbst verordneten Schuldenbremse im letzten Jahr 300 Stellen streichen musste. Doch angesichts dessen, dass auf der ganzen Welt Regierungschefs plötzlich für höhere Rüstungsbudgets weibeln und Amerika seine Nato-Verbündeten nur noch schützen will, wenn diese ihre Armee stärken, könnte auch in der Schweiz in den kommenden Jahren der Druck für eine grösseres Armeebudget zunehmen.
Good News: Frankreich geht
Was ist passiert? Frankreich hat etwas getan, das die Schweiz unter keinen Umständen tun will. Dabei geht es um ein so sperriges wie abstraktes Wort: die Sorgfaltsprüfungspflicht. Am 22. Februar verabschiedete die französische Nationalversammlung einen Gesetzesvorschlag, der von französischen Konzernen verlangt, dass sie all ihre Tätigkeiten einer Sorgfaltsprüfung unterziehen. Das heisst: Sie sollen überprüfen, ob sie der Umwelt oder Menschen schaden. Und zwar nicht nur bei Aktivitäten in Frankreich selbst, sondern auch im Ausland. Ob die Unternehmen die dort gültigen Gesetze einhalten, spielt dabei keine Rolle.
Das neue Gesetz verlangt von den Unternehmen einen konkreten Sorgfaltsplan. In diesem Plan muss das Unternehmen Risiken für Umwelt und Menschenrechte identifizieren, analysieren und priorisieren; erläutern, wie es Tochter- und Subunternehmen sowie Zulieferer regelmässig überprüfen will; angemessene Gegenmassnahmen zur Vermeidung und Milderung von Menschenrechtsverletzungen darlegen; ein Warnsystem zur Entgegennahme von Beschwerden entwickeln — und zwar zusammen mit Gewerkschaften; sowie ein Verfahren festlegen, mit dem es überprüfen kann, ob die Massnahmen fruchten. Wenn das Unternehmen seine Pflichten vernachlässigt, können betroffene Personen klagen. Gerichte können Strafen bis zu 30 Millionen Euro verhängen.
Weshalb ist das wichtig? Bei vielen Umwelt- oder Sozialkatastrophen wie etwa beim Einsturz der Nähfabrik Rana Plaza in Bangladesch, wo mehr als 1000 Menschen ums Leben kamen, weisen die multinationalen Konzerne jede Verantwortung von sich. Einerseits hätten sie ja die vor Ort geltenden Gesetze eingehalten. Andererseits ist es üblich, solche potenziell rufschädigenden Tätigkeiten an Subunternehmen auszulagern. Die Sorgfaltsprüfung anerkennt nun, dass Unternehmen ihre Verantwortung nicht einfach an diese Subunternehmen abschieben können. Dahinter steckt die Überzeugung, dass die Konzerne in einer ungleich stärkeren Position sind als die lokalen Subunternehmer oder auch die Gesetzgeber der Staaten, in denen die gefährlichen Arbeiten durchgeführt werden.
In der Schweiz hat eine NGO-Koalition mit der Konzernverantwortungsinitiative einen weiterreichenden Verfassungsartikel vorgelegt. Der Bundesrat hat diesen ohne Gegenvorschlag abgelehnt. Nach der Diskussion im National- und Ständerat wird das Volk wohl darüber abstimmen, ob es in der Verfassung festhalten will, dass Unternehmen ihre Geschäftstätigkeiten systematisch auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltrisiken überprüfen und falls nötig Massnahmen ergreifen müssen.
Aber: Frankreich nimmt mit dem Gesetz zwar eine Vorreiterrolle ein. Das Gesetz muss jedoch noch definitiv vom Präsidenten verabschiedet werden. In Frankreich ist es aber möglich, dass 60 ParlamentarierInnen eine Beschwerde gegen ein neues Gesetz einlegen. Das ist am 23. Februar geschehen. Nun muss der Verfassungsrat entscheiden, ob das Gesetz der Verfassung widerspricht. Dann erst kann der Präsident das Gesetz unterzeichnen.
Auch das Instrument der Sorgfaltsprüfung ist eine Krücke. Eigentlich wünschen sich die LobbyistInnen für das Gesetz, dass Unternehmen auch im Ausland nach den Gesetzen ihrer Sitzländer haften. Dass also Schweizer Unternehmen in der Elfenbeinküste Schweizer Standards einhalten sollten. Doch das ist rechtlich utopisch. Die Sorgfaltsprüfung ist etwa, wie wenn man seinem Kind, bevor es das Wochenende bei den Grosseltern verbringen wird, sagt, es solle doch nicht all die Süssigkeiten, die Oma nonstop verteilt, einfach in sich hineinstopfen und stattdessen daran denken, wie sehr es seinen Zähne schadet. Das Kind wird, wenn es denn die Gesetze der Familie verstanden hat, artig nicken damit dem Sorgfaltsplan zustimmen- und bei Oma trotzdem alle Süssigkeiten in sich hineinstopfen.
Bad News 2: Die CS schweigt
Was ist passiert? UmweltschützerInnen beschuldigen eine Grossbank? Nichts Neues im Westen — könnte man denken. Doch gerade vor dem Hintergrund von Frankreichs neuem Gesetz ist der aktuelle Fall spannend. Und das kommt so: Greenpeace beschuldigt Credit Suisse, die grösste Geldgeberin der umstrittenen Dakota-Access-Pipeline in den USA zu sein. UmweltschützerInnen und Sioux protestieren seit langem gegen die Pipeline, die unter einem Stausee hindurchführen soll. Sie befürchten, dass das Grundwasser verunreinigt wird. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung steht aus. Obama hatte das Projekt im Dezember gestoppt, doch Trump wies mit einem seiner ersten präsidentiellen Dekrete an, das Projekt wieder aufzunehmen.
Greenpeace behauptet nun, dass die CS bis zu 850 Millionen Dollar an Firmen vergeben habe, die in das Projekt involviert seien. Die NGO fordert die Grossbank auf, sofort aus dem Projekt auszusteigen. Doch die CS schaltet auf stur. Sie behauptet, weder in das Projekt involviert zu sein noch eigene Richtlinien zu verletzen. Ersteres, so Greenpeace, stimmt nicht, weil die CS eben doch indirekt Geld in die Pipeline pumpt. Und zweiteres sei ein Witz, denn die Richtlinien seien „nicht mehr als ein Deckmäntelchen, mit dem die Grossbank der Öffentlichkeit nachhaltiges Wirtschaften vorgaukelt”.
Weshalb ist das wichtig? Der Fall ist deshalb so interessant, weil andere Banken, aus dem Projekt ausgestiegen sind. Die Royal Bank of Scotland beendete die Zusammenarbeit im Herbst 2015, die grösste norwegische Bank DNB entledigte sich im November 2016 allen Beteiligungen an Firmen, die mit der Dakota-Pipeline verbandelt waren. Schwedens Nordea-Bank stösst diese Beteiligungen momentan ab und der holländische Finanzriese ABN Amro erklärte, er steige aus allen Geschäften mit den Pipeline-Firmen aus, wenn mit den Sioux keine Lösung gefunden werde.
Die CS wiederum verweist auf ihre internen Richtlinien. Aber was bringen diese, wenn es keine ernsthafte externe Kontrollen gibt? Und was sollen Richtlinien, wenn niemand büssen muss, falls sie verletzt werden? Der Fall der Dakota-Pipeline zeigt exemplarisch, wie eine Sorgfaltsprüfung à la France zumindest die Frage aus dem Weg räumen könnte, ob nun die CS in irgendeiner Form überhaupt Verantwortung an etwaigen späteren Umweltschäden trüge. Die Bank müsste, hätte die Schweiz ein ähnliches Gesetz wie Frankreich verabschiedet, in einem Plan darlegen, wie sie dieses Risiko einschätzt, was sie zu tun gedenkt, um das Risiko zu minimieren — und was geplant ist, falls sie sich irrt und das Grundwasser tatsächlich verschmutzt wird.
Aber: Auch wenn UmweltschützerInnen nun zu Protesten auf dem Paradeplatz aufrufen — dass die CS sich aus dem Projekt zurückziehen wird, erscheint unwahrscheinlich. Und falls doch, dann nur, weil sich das finanzielle Risiko aus Sicht der Bank nicht lohnt. Das Geld würde anderswo investiert. In sinnvollere Projekte? Das wird nur die CS selbst wissen — solange es keine Sorgfaltsprüfungspflicht gibt.
Artikel‑, Hör- und Filmtipps zu den Ereignissen im Februar
- Podcast: Ein schwarzer Musiker hat sich zum Ziel gesetzt, weisse RassistInnen zu FreundInnen zu machen.
- Ein Mann mit einer Sammlung an menschlichen Köpfen? Komplett legal — und vielleicht gar im Interesse der Menschheit.
- Die neuen Rechtsextremen gründen nicht auf den Nazis. Und eine andere aktuelle Denkströmung sollte aufpassen, dass sie nicht den NeofaschistInnen zudient.
- Können wir uns auf dem Mars eine neue Welt bauen? Technisch ist es vielleicht schon bald möglich, aber welche psychischen Herausforderungen warten auf die ersten SiedlerInnen auf dem Mars? Die Nasa hat das mit einem Langzeitexperiment versucht herauszufinden: Sechs Menschen während acht Monaten in einer Mars-Simulation. Guess what happened. Die New York Times hat das Experiment mit einem 360°-Video dokumentiert.
- Eine Gesellschaft mit extremer Armut hat für SozialforscherInnen einen extremen Vorteil: Es lassen sich ganz günstig Sozialexperimente durchführen. Deshalb soll in Kenia nun das weltgrösste Experiment mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gestartet werden.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 20 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1300 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 700 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 340 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?