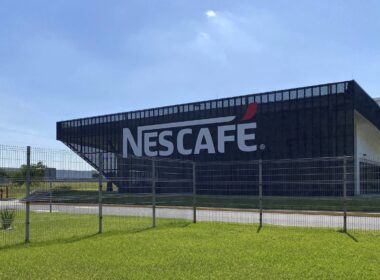Was wurde diese naturbelassene flache Fläche im mexikanischen Südosten nicht schon alles genannt? Für den mexikanischen Staat war Yucatán als eine „Region von Rebellen” verschrien, bis diese nach einem fünfzigjährigen Krieg zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast vollständig unterworfen und kolonialisiert wurde. Lange bezeichneten Anthropolog*innen und Historiker*innen die Halbinsel demnach auch als „eine abgelegene Welt”. Seit fast einem halben Jahrhundert kennt die Welt Yucatán, das die viereinhalbfache Grösse der Schweiz umfasst, als „das Land der Mayas”.
Bis heute dient die Vermarktung der indigenen Kultur und Sprache als erfolgreicher Teil dieser Kommerzialisierungsstrategie.
In den 1970er-Jahren erschliesst die mexikanische Regierung die traumhaft schönen, kilometerlangen Sandstrände, die archäologischen Stätten und die reichhaltige Biodiversität für die just beginnende globale Tourismusindustrie. Bis heute dient die Vermarktung der indigenen Kultur und Sprache als erfolgreicher Teil dieser Kommerzialisierungsstrategie.
Seitdem ist Yucatán für einige zum Sehnsuchtsort touristischer Träumereien geworden. Für viele ist es nach wie vor das Zuhause, das ein Leben in Fülle und Würde bereithalten könnte. Für die anderen ist es indes die stählerne fleischgewordene Projektionsfläche eines staatlichen Versprechens.
Unter der Erde
Es ist Mitte August und die Schwüle in dem Dörfchen Homún im Norden der Halbinsel Yucatán kennt kein Erbarmen. Homún liegt im gleichnamigen Bundesstaat Yucatán und formt zusammen mit den Bundesstaaten Campeche und Quintana Roo den mexikanischen Teil der Halbinsel. Auf der weitläufigen überdachten Terrasse ihres Hauses sitzt Maribel Ek’am und beobachtet ihre Gäste. Ihre Augen sprechen von innerer Ruhe, aber auch von Bestimmtheit.
„Wir sind gesegnet mit Naturschätzen”
Maribel Ek’am, Hüterin einer sogenannten Cenote, einer mexikanischen Wassergrotte
„Wir sind gesegnet mit Naturschätzen”, sagt Ek’am und eine stolze Freude ist in ihrer wohlklingenden Stimme zu vernehmen. Die 49-Jährige wohnt wenige Meter vom Eingang einer Hunderte von Metern langen Grotte entfernt. „Ich bin eine der Wächterinnen der Cenotes”, sagt sie, „ich beschütze diesen verletzlichen und heiligen Ort, der voll mit Leben und sauberem Süsswasser ist.” Yucatán ist überhäuft von diesen halb offenen mit Grundwasser gefüllten Karsthöhlen, die Cenotes heissen und ober- wie unterirdisch zu finden sind. Über 8’000 dieser Cenotes soll es auf der Halbinsel geben. Sie dienen einem Teil der Bevölkerung als spiritueller Ort und als Einkommensquelle im Rahmen eines gemeindebasierten Tourismus’.
Homún liegt im Herzen des staatlichen Naturschutzsreservates Anillo de Cenotes, dem Ring der Cenoten. Nördlich davon findet man den 180 Kilometer breiten Krater von Chicxulub. Dort schlug laut wissenschaftlicher Annahmen vor 65 Millionen Jahren der Meteoroid ein, der das Ende der Dinosaurier einleiten sollte.
Derweil macht sich die Wächterin Ek’am für den Eintritt in die Grotte bereit. Nach wenigen Metern in die Tiefe nimmt die Schwüle erneut zu. Fledermäuse hängen von den Decken, Gesteinsformationen an den Wänden animieren die eigene Vorstellungskraft und Maribel Ek’am bewegt sich agil und kundig voran. Schon als kleines Mädchen kam sie zum Spielen und Verstecken hierher.
Heute führt sie interessierte Besucher*innen in die unterirdische Welt. Mal lässt die Grotte eine Höhe von zehn Metern und Platz für ein einstöckiges Einfamilienhaus mit einem grosszügigen Garten, mal schrumpft sie auf einen Tunnel mit einer Höhe von 1.40 Meter. Immer wieder tauchen kleinere und grössere Wasserbecken, die Cenotes auf. Maribel Ek’am führt durch sie hindurch, mal gehend, mal schwimmend, und fährt mit ihrer Erzählung fort.

Der Tourismus, erklärt sie, ermögliche einigen Dorfbewohner*innen ein verlässliches Einkommen, was sich positiv auf den Zusammenhalt auswirke. „Aber jeder Ort ist nur für eine bestimmte Menge an Gästen in einem bestimmten Zeitraum gedacht. Die Natur muss sich regenerieren können. Wird ihr diese Möglichkeit nicht gelassen, findet Zerstörung statt.” Die Wächterin der Cenote spricht, als würde die Natur für sie ein komplexes Beziehungsgeflecht mit den Menschen bilden, durch das sich beide zusammen immerfort weiterentwickeln. „Weder Homún noch die komplette Region dürfen touristisch explodieren. Wir würden unsere Schönheit verlieren.”
Die Visionen einer Regierung
Über 1’300 Kilometer von Homún entfernt liegt in Mexiko-Stadt der Nationalpalast des mexikanischen Staats- und Regierungspräsidenten Andrés Manuel López Obrador. Fast jeden Montag erwähnt López Obrador in seiner alltäglichen Pressekonferenz die Halbinsel Yucatán und das Vorzeigeprojekt seiner Regierung, den Tren Maya.
Das Projekt umfasst den Bau und die Modernisierung von mehr als 1’500 Kilometer Bahnstrecken in den drei Bundesstaaten der Halbinsel sowie in Chiapas und Tabasco, die die Südgrenze des Landes bilden. Das Eisenbahnprojekt wird mit seinen 34 Bahnhöfen grosse, mittlere und kleine Orte miteinander verbinden. Vor allem aber wird der Zug die weiten, unbesiedelten Gebiete des Biosphärenreservates Calakmul an der Südgrenze zu Guatemala bis zur Karibikküste Riviera Maya durchqueren. Im Dezember sollen die ersten Streckenabschnitte eröffnet werden.

Der Präsident des 127-Millionen-Landes sieht sich selbst als Anführer einer „vierten Transformation” von Mexiko, wie er seine Regierungszeit zu bezeichnen pflegt. Mit seinem Infrastrukturprojekt verspricht er den Menschen auf der Halbinsel sozialen Wohlstand, wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe. Motor dieser Prozesse soll der Tourismus sein – zusammen mit dem industriellen Warenverkehr, der im staatlichen Diskurs zwar so gut wie keine Erwähnung findet, aber über 70 Prozent der Einnahmen aus dem Tren Maya-Projekt generieren soll.
Der Tren Maya soll die Tourist*innenzahlen weiter in die Höhe schnellen lassen. Bereits im Jahr 2019 empfing die Halbinsel 32 Millionen an in- und ausländischen Tourist*innen. Im selben Zeitraum flogen nach Zahlen des mexikanischen Ministeriums für Tourismus mehr als zwei Millionen Europäer*innen nach Mexiko, davon 39’228 direkt von Zürich nach Cancún.
Doch der Tourismus-Boom, der mit weitreichenden Veränderungen einhergeht, bleibt nicht ohne Risiken.
Ein fragiles Gleichgewicht
Deutlich wird dies etwa in Mérida, der Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán. Dort ist inzwischen die Nacht über das Haus von Fernanda Lases Hernández hereingebrochen. Schwüle Hitze und unbewegliche Luft umhüllen das Leben in dieser beschaulichen Stadt, dessen historisches Zentrum gleiche Essenspreise kennt wie die europäischen Metropolen.
Lases Hernández, die als Forscherin an der Fakultät für Chemie der Nationalen Autonomen Universität Mexiko (UNAM) in Mérida arbeitet, ist eine feinfühlige Expertin, wenn es um die unterirdische Welt der Halbinsel geht. Dort, unter der Erde, beginnt ihr Kosmos. Ein subtiles und bescheidenes Lächeln auf ihrem Mund ist zu erkennen, wenn sie das Karstsystem erklärt, das die gesamte Halbinsel unter ihrer Oberfläche durchzieht.
In der Tat gleicht die Welt unter der Erde einem Schweizer Käse: Eine durchlässige Masse, die durch eine Vielzahl von Tunneln unterteilt ist und überall in der Region miteinander verbunden sind.
Dieses Karstsystem beherbergt zudem mit dem Sistema Sac Atun das grösste unterirdische Wasserreservoir der Welt.
Die Grotte von Maribel Ek’am ist nur ein kleiner Baustein darin. Dieses Karstsystem beherbergt zudem mit dem Sistema Sac Atun das grösste unterirdische Wasserreservoir der Welt. „Aufgrund der Durchlässigkeit des Gesteins besteht ein Gleichgewicht zwischen dem Süsswasser, das ins Meer fliesst, und dem Salzwasser, das in das Karstsystem eindringt.
Je näher man sich der Küste nähert, desto salziger wird das Wasser”, so die Wissenschaftlerin Lases Hernández. Sie warnt davor, dass dieses fragile Gleichgewicht bei einer Übernutzung des Wassersystems durch eine verstärkte Landwirtschafts- oder Immobilienindustrie, oder durch das Aufbohren des Gesteins für den Bau von Eisenbahnstrecken gestört werden würde. Dadurch entstehe die Gefahr, dass mehr Salzwasser in das unterirdische System gelange. „Die Folge ist, dass wir kein Süsswasser mehr haben werden, von dem sich das Ökosystem an der Oberfläche ernährt”, schliesst sie ihre Überlegungen ab. Ihr Haus, Mérida und die ganze Halbinsel sind zu dem Zeitpunkt schon in finstere Dunkelheit eingetaucht.
Zu viel Tourismus
Auch anderswo auf der Halbinsel werden die Pläne der Regierung kritisch beäugt. Zu sehr habe der Tourismus schon das Leben der indigenen Bevölkerung bestimmt, urteilt Ángel Sulub. „In der Grund- und Sekundarschule wird uns beigebracht, dass der Tourismus das Beste sei, was uns indigenen Gemeinschaften passieren kann. Wir lernen dort in Hotels, Bars und Restaurants zu arbeiten”, erklärt er mit Blick auf seine eigene Schulzeit. Ángel Sulub ist gross geworden und wohnhaft in Felipe Carrillo Puerto, eine Kleinstadt im Süden von Quintana Roo. Seinem Wohnort stehe das bevor, was andere an der Karibikküste gelegenen Orte wie Playa del Carmen, Tulúm oder Mahahual bereits widerfahren ist. Dort habe die Tourismusindustrie die indigene Identität und die Kultur der Maya weitgehend in sich einverleibt und zugunsten ökonomischer Kriterien an jene Industrie angepasst.

Die Ortschaft Felipe Carrillo Puerto wirkt zwar leicht verschlafen, doch unter der Oberfläche brodelt es. Nach der Verkündung des Baus des Zugprojektes Ende 2018 nahm die Gewalt erschreckend zu. Allein 13 Morde wurden hier im Jahr 2019 verübt, berichtet Sulub mit trüber Mine und verweist auf die Niederlassung einer auf nationaler Ebene operierenden Fraktion des organisierten Verbrechens in der Region.
Hier waren es nicht die Europäer*innen, die die indigene Bevölkerung auslöschten, sondern die Mexikaner*innen selbst, die – in den Worten des Gemeindezentrums – einen Genozid begingen.
Gemeinsam mit anderen Gefährt*innen gründete Ángel Sulub das Gemeindezentrum U kúuchil k Ch’i’ibalo’on. Erbaut am Rande der Stadt und im Dschungel gelegen, treffen hier Kultur, Gemeinschaft, Bildung sowie politische Diskussionen aufeinander. „Vor der militärischen Invasion des mexikanischen Staates in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fungierte Felipe Carrillo Puerto als Hauptstadt der letzten Maya-Autonomie”, erklärt er vor einer Bilderserie stehend, die die Widerstandsgeschichte der Region porträtiert. Hier waren es nicht die Europäer*innen, die die indigene Bevölkerung auslöschten, sondern die Mexikaner*innen selbst, die – in den Worten des Gemeindezentrums – einen Genozid begingen.
Unter dem Dach des Versammlungshauses macht es sich Sulub auf einem breiten Stuhl bequem. Wände gibt es hier keine, so gibt es trotz der stickigen Hitze eine angenehme Luftzirkulation. Sulubs Grosseltern waren Teil des letzten bewaffneten Widerstands, der sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ausdehnte.
Als Enkel führt er heute den Kampf seiner Vorfahren fort. Er vertritt als politischer Delegierter das Gemeindezentrum in dem landesweiten Zusammenhang Nationaler Indigener Kongress (CNI). Nüchtern konstatiert er, dass eine verfälschte Geschichte erzählt werde. Statt dass das Wissen um die eigene Vergangenheit Teil des offiziellen Narrativs wird, plant die Bundesregierung rund um den Tren Maya-Bahnhof in Felipe Carrillo Puerto die Eröffnung von Shops, die typische Maya-Souvenirs wie Kopien der Pyramide von Chichén Itzá oder des Kopfes des Herrschers Pakal verkaufen.
Trübe Aussichten
Mittlerweile ist Maribel Ek’am aus der Grotte neben ihrer Terrasse wieder herausgetreten. Die Stunden unter der Erde wärmten ihren Körper so sehr, dass sie draussen Kälte verspürt. Abschliessend formuliert sie eine so pragmatische wie verantwortungsvolle Perspektive auf die Tätigkeit ihrer Gemeinde: „Für uns steht der Tourismus für ein Einkommen, das andere Perspektiven ermöglicht, zum Beispiel, dass wir unseren Kindern ein Studium finanzieren können. Wir haben nicht vor, den Tourismus an unsere nachfolgenden Generationen als einzig mögliche Beschäftigung zu vererben”, schliesst sie sanft und hüllt sich in ein Handtuch.
Denn wirkt der Tourismus als einzige Quelle des Unterhalts, so kann sich dieser schnell als Falle entpuppen
Denn wirkt der Tourismus als einzige Quelle des Unterhalts, so kann sich dieser schnell als Falle entpuppen, aus der weite Teile der Bevölkerung nicht mehr herauskämen. So sieht es zumindest Ángel Sulub, der Vertreter des CNI. Die Inbetriebnahme des Tren Maya führe dazu, dass Indigene die Tourist*innen bei ihren Parties und in ihren Hotels auch in Zukunft als billige Arbeitskräfte bedienen werden. „Was von unserer Kultur übrig ist, wird vom Tourismus vereinnahmt und in etwas Folkloristisches verwandelt”, resümiert Ángel Sulub und behält seine beruhigende Ausstrahlung auch dann bei, als wenige Zentimeter neben ihm eine handflächengrosse Tarantel gemächlich das Gemeindehaus durchstreift.
Diese Reportage wurde finanziell durch den Medienfonds „real21 — die Welt verstehen” unterstützt. Wir danken!
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 30 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1820 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1050 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 510 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?