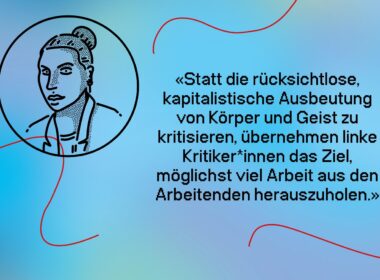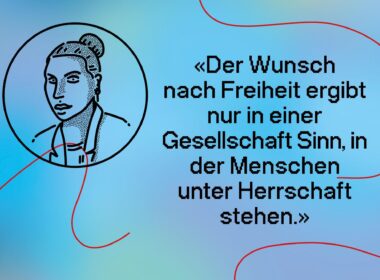Ich habe als Kind viel mit meinem Bruder und meinen Cousins gerangelt. Es war ein Kräftemessen; eine Möglichkeit, die eigene Stärke zu testen, zu spüren und auch zu kontrollieren. Manchmal ging’s zu weit und es endete in Tränen, aber wirklich böse wurden wir einander nie. Es waren sehr selten Kämpfe, die aus Wut oder Frustration entstanden. Es war einfach ein Spiel, und manchmal haben wir einander aus Versehen wirklich weh getan.
Mit meinen Cousinen oder Freundinnen machte ich das nie.
In der Schule beobachtete ich, wie Jungs miteinander rangelten, so wie ich es kannte. Aber je älter wir wurden, desto gewaltvoller wurden diese Auseinandersetzungen. Anders als ich es gewohnt war, hatten sie keine unausgesprochene Regel, nach der die Älteren und Stärkeren sich zurückhalten, auch mal einstecken und nur halb so fest zurückgeben. Nein, hier schlugen sie so fest zu, wie es ging – und der Stärkste gewann.
Darüber hinaus entwickelte sich physische Gewalt als Mobbing-Instrument. Die ruhigeren, schlaksigeren Jungs wurden zur Zielscheibe von der „coolen”, sportlichen Gruppe und wurden auf dem Pausenplatz regelmässig geboxt, geschlagen oder getreten.
Wenn ich daran zurückdenke, schockiert es mich, wie viel physische Gewalt Männer schon als Jugendliche erleben. Wie kann das in unserer Gesellschaft so normalisiert sein?
Gewalt als Mittel zur Lösung von Problemen
Von Anfang an: Gewalttaten gehen hauptsächlich von Männern aus – das ist kein Geheimnis. Dass Männer aber auch die Mehrheit der Geschädigten ausmachen, wird seltener thematisiert.
Gewalt ist ein grosses Wort: Grundsätzlich wird zwischen physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt unterschieden, die im privaten (Stichwort: häusliche Gewalt) oder öffentlichen Raum geschieht. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind drei von vier Opfern „schwerer Gewalt” – Vergewaltigungen ausgenommen – Männer. Im Gegensatz zu Frauen, die Gewalt mehrheitlich zu Hause erleben, sind Männer der Gewalt zudem mehrheitlich im öffentlichen Raum ausgesetzt. Und das schon sehr früh.
Das Wort „Jugendgewalt” begegnet uns in den Medien immer wieder. Erst kürzlich berichtete SRF, dass immer mehr Jugendliche ein Messer bei sich tragen, und letztes Jahr, dass in Zürich mindestens jede*r vierte*r Jugendliche*r schon Gewalt erlebt hat. Abgesehen von sexualisierter Gewalt spielt sich die Gewalt auch in diesem Alter mehrheitlich unter Jungs ab – die Wissenschaft spricht hier von homosozialer Gewalt.
Lohnungleichheit, unbezahlte Care-Arbeit, sexualisierte Gewalt, aber auch der Kampf gegen toxische Maskulinität, die Abschaffung der Wehrpflicht und homosoziale Gewalt sind feministische Themen – und werden als „Frauensache“ abgestempelt. Dadurch werden diese Themen einerseits abgewertet, andererseits die Verantwortung für die Lösung dieser Probleme auf FINTA (Frauen, inter, non-binäre, trans und agender Personen) übertragen.
Das ist nicht nur unlogisch, sondern auch unnütz: Die Ursache des Problems liegt nicht auf der Betroffenen, sondern auf der Täterseite. Es sind eben Männersachen. Deshalb müssen Männer als Teil der privilegierten Gruppe Verantwortung übernehmen und diese Probleme angehen.
Gemäss einer nordirischen Studie von 2006 hatte die grosse Mehrheit der 299 befragten Jungs im Alter von 11 bis 12 Jahren schon Gewalt erlebt: 90 Prozent sind getreten, 82 Prozent geschubst und 80 Prozent geschlagen worden. Drei Viertel der befragten Jungs betrachteten Gewalt zudem als ein akzeptables Mittel zur Lösung von Problemen.
Obwohl die Studie lange her und weit von uns entfernt ist, sind die Ergebnisse eindrücklich. Und Gewalt scheint auch in der Schweiz unter Jungs und Männern akzeptiert zu sein, um kleine bis grosse Konflikte zu lösen.
Als ich 2019 eine Homeparty schmiss, drangen zwei uneingeladene Männer in die Wohnung ein. Ich stellte mich ihnen mit meiner WG-Mitbewohnerin in den Weg und verlangte, dass sie unsere Wohnung verlassen. Sie bewegten sich nicht, meine Verzweiflung stieg. Als mein Freund sich hinter mich stellte und mir das Handy entgegenstreckte, damit ich die Polizei alarmieren konnte, schlugen die zwei Männer zu – endlich ein anderer Mann, mit dem sie die Situation aushandeln konnten.
So verängstigend die Situation auch war, liess sie mich vor allem mit Frustration und Wut zurück. Wie lächerlich und gleichzeitig erschreckend ist es, wie schnell Männer auf Gewalt zurückgreifen, wenn sie mit einem Problem konfrontiert sind und sie ihre Macht demonstrieren möchten? Wieso hängt Männlichkeit so eng mit Gewalt zusammen?
Der deutsche Soziologe Michael Meuser schreibt: „Männlichkeit wird konstruiert und reproduziert in einer Abgrenzung sowohl gegenüber Frauen als auch gegenüber anderen Männern.”
Sylka Scholz, ebenfalls deutsche Soziologin, führt hier aus, dass die Beziehung zu anderen Männlichkeiten „durch ein hierarchisch strukturiertes Über- und Unterordnungsverhältnis” bestimmt ist. Gemäss Scholz wird die soziale Ordnung unter Männlichkeiten unter anderem über körperliche Gewalt hergestellt. Diese homosoziale Gewalt werde insbesondere von jungen Männern zwischen 16 Jahren bis Anfang 20 ausgeübt.
Dominanzspiele oder Degradierung?
Es gibt verschiedene Theorien und Ansätze, um das Ausmass der Gewalt zu erklären, das Männer umgibt. Ein Beispiel ist das Konzept der hegemonialen Männlichkeit: Während männliches Gewalthandeln gegen Frauen dazu dient, männliche Dominanz zu sichern, dient gegen andere Männer gerichtete Gewalt unter anderem dazu, „sich der eigenen Männlichkeit zu versichern oder diese zu demonstrieren”, schreibt die australische Soziologin Raewyn Connell.
Und schon sind wir bei den Männlichkeitsanforderungen: Ein „richtiger Mann” hat stark zu sein, psychisch wie physisch, darf keine Schwäche zeigen, soll nicht übermässig emotional sein und muss Leistung erbringen. Männlichkeit wird konstruiert, also gelebt, und es ist ein ständiger Kampf, sich von Frauen und anderen Männern – die diese Anforderungen weniger oder gar nicht erfüllen – abzugrenzen.
Die pädagogische Männlichkeitsforschung betrachtet männliche Gewalt „als kompensatorisches Handeln, als Mittel der Problembewältigung”, schreibt Meuser in seinem Buchkapitel „Doing Masculinity”. Sie sei eine Reaktion auf Frustration, auf Versagensängste, auf Zurückweisung, auf Minderwertigkeitsgefühle, auf einen Mangel an Anerkennung. Sie diene als Mittel, um Unsicherheiten zu kompensieren und sie durch eine Demonstration von Stärke abzuwehren.
Es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera: Entweder du bist kontinuierlich der Gewalt ausgesetzt oder du machst mit, wirst „nur” ab und zu geschlagen und selbst zum Täter.
Meuser weist darauf hin, dass homosoziale Gewalt nicht nur eine Abwertung des Gegenübers impliziert, sondern auch die Anerkennung des Anderen bedeuten kann. Das treffe nicht auf jede Form homosozialer Gewalt zu, sondern nur auf Interaktionen, die „reziprok strukturiert sind” – also wenn beide Seiten Gewalt anwenden. Kennzeichnend für diese Gewalt sei ihre kompetitive Struktur: Es handle sich kurz gesagt um Dominanzspiele.
Lest das noch mal durch. Jungs prügeln sich, bestätigen so gegenseitig ihre Männlichkeit und schenken dem Gegenüber so Anerkennung. „Hey, Junge, geil zugeschlagen, du bist ja ein richtiger Mann”, oder was? Obwohl solche halb-freundschaftlichen Prügeleien vermeintlich im Einverständnis beider Parteien geschehen, ist das ein gefährliches Spiel.
Fehlt die Gegenseitigkeit, schreibt Meuser weiter, ist diese Gewalt nämlich nichts anderes als ein Mittel zur Ausgrenzung und Degradierung der geschädigten Person. Und jetzt kommt die wichtige Frage: Wie freiwillig ist die Teilnahme an diesen Machtspielen wirklich?
Die unausgesprochene Männlichkeitshierarchie
Als ich meinen Freund fragte, wann er das erste Mal physische Gewalt erlebt habe, zögerte er nicht: „Im Kindergarten”. Er relativierte aber schnell und meinte, das seien ja alles Spiele gewesen. Er erzählte, dass es erst in der Sekundarschule richtig schlimm wurde. Die Gewalt und ihre Intensität nahm zu, es tat auch mal richtig weh.
Ein klassisches „Spiel” nennt sich „Reingeschaut”: Eine Person formt mit Zeigefinger und Daumen ein Loch – wer reinschaut, bekommt einen Box auf den Arm. Mein Freund erzählte, dass es eine unausgesprochene Regel gab, wer bei diesen „Spielen” wen wie fest schlagen durfte. Die älteren und stärkeren Jungs hatten das Recht beziehungsweise die Pflicht, härter zurückzugeben als das Gegenüber, um die Rangordnung aufrechtzuerhalten. Wer sich nicht daran hielt, kassierte eine Bestrafung.
Ich denke, den allermeisten Jungs ist zumindest unterbewusst klar, dass sie sich in der Männlichkeitshierarchie irgendwo eingliedern müssen. Und wenn sie nicht zuunterst landen wollen, wo sie einfach generell angegriffen werden, müssen sie bei den Machtspielen mitmachen. Es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera: Entweder du bist kontinuierlich der Gewalt ausgesetzt oder du machst mit, wirst „nur” ab und zu geschlagen und selbst zum Täter.
Wer jetzt sagt „Teenager müssen halt Stress abbauen” oder „boys will be boys”, negiert, wie traumatisch solche Erfahrungen sein können.
Einer meiner Mitschüler in der Sekundarschule erfüllte die gängigen Männlichkeitsanforderungen zu wenig und machte bei den Dominanzspielen nicht mit. Die „coolen Jungs” verprügelten ihn so fest, dass seine Zahnspange kaputtging und er ins Krankenhaus musste. Er wechselte – natürlich – die Schule, Konsequenzen für die Täter blieben grösstenteils aus.
Ein anderer Mitschüler in derselben Klasse wurde ebenfalls verprügelt, weil er seine Männlichkeit wohl nicht genügend performte: Er war sehr sanft und ruhig, mit vielen Mädchen befreundet, erzielte gute Noten und trug eine Brille. Er hielt die Gewalt aus, er petzte nicht, er weinte nicht, er schlug nicht zurück. Bis er nach ein paar Jahren anfing, auch mal zurückzuschlagen und mitzulachen. Er war nicht mehr das Opfer der gewalttätigen Gruppe, sondern wurde in ihren Kreis aufgenommen.
Jetzt im Nachhinein verstehe ich, dass er durch sein stilles Leiden seine Männlichkeit unter Beweis stellen konnte („Das hat er gut ausgehalten”) und schliesslich in der Hierarchie aufstieg. Es war seine Bewältigungsstrategie, die scheinbar funktioniert hat. Aber zu welchem Preis?
Normalisierte Gewalt
Wer jetzt sagt „Teenager müssen halt Stress abbauen”, „Raufereien sind normal” oder „boys will be boys”, negiert einerseits, wie traumatisch solche Erfahrungen sein können. Andererseits übersehen diese Personen, dass die Gewalt nicht einfach verschwindet, sobald die Jungs erwachsen sind – wir erinnern uns an die anfangs erwähnte Statistik, in der Männer sowohl bei Täter*innen als auch Opfern den Grossteil ausmachen.
Ein weiteres Beispiel, das mir geblieben ist: Mein Bruder schert sich herzlich wenig um Männlichkeitsanforderungen, und während er so viel authentischer und glücklicher leben kann, wird er ungewollt zur Zielscheibe von Männern, die ihre fragile Männlichkeit verteidigen möchten. Als er vor ein paar Jahren mit Freund*innen spontan an einen Fussballmatch ging, hat er sich von einem Kollegen ein FCB-Shirt ausgeliehen. Als er über den Zürich Hauptbahnhof nach Hause fuhr, drohten ihm fremde Männer, dass sie ihn verprügeln würden, wenn er das Shirt nicht ausziehe.
Er ignorierte sie, lief etwas schneller auf sein Gleis zu und kam heil davon – aber dieses Glück haben nicht alle.
Das Lamm-Journalist Simon Muster hat in einem Artikel unter anderem davon erzählt, wie er in einem Park von zwei unbekannten Jugendlichen angegriffen und spitalreif geschlagen wurde. Er beschreibt, wie ihn dieses Erlebnis geprägt hat und fragt: „Was macht es mit der eigenen Männlichkeit, wenn Gewalt zwar integral zur performance ‘Mann’ gehört, aber allein schon ein paar laute (männliche) Stimmen auf dem Heimweg einen so lähmen, dass man sich nicht selbst schützen könnte, geschweige denn andere?”
Und ich frage mich, wieso wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir uns vor dieser Gewalt schützen können, statt dass wir diese normalisierte Gewalt als gesellschaftliches Problem angehen.
Ich hörte früher oft den Satz „Frauen schlägt man nicht”. Jungs ermahnten einander damit, falls jemand die „Regel” mal vergessen sollte. Andere prahlten vor Mädchen damit, um extra gut dazustehen. Was sie dabei nicht explizit sagen, aber eigentlich meinen ist: „Frauen schlägt man nicht, aber Männer schon”.
Abgesehen davon, dass diese Aussage nur so von patriarchalen Rollenmustern trieft, ist sie extrem problematisch. Natürlich schlägt man Frauen nicht. Man schlägt auch Männer und non-binäre Menschen – und andere Lebewesen – nicht.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 25 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1560 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 875 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 425 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?