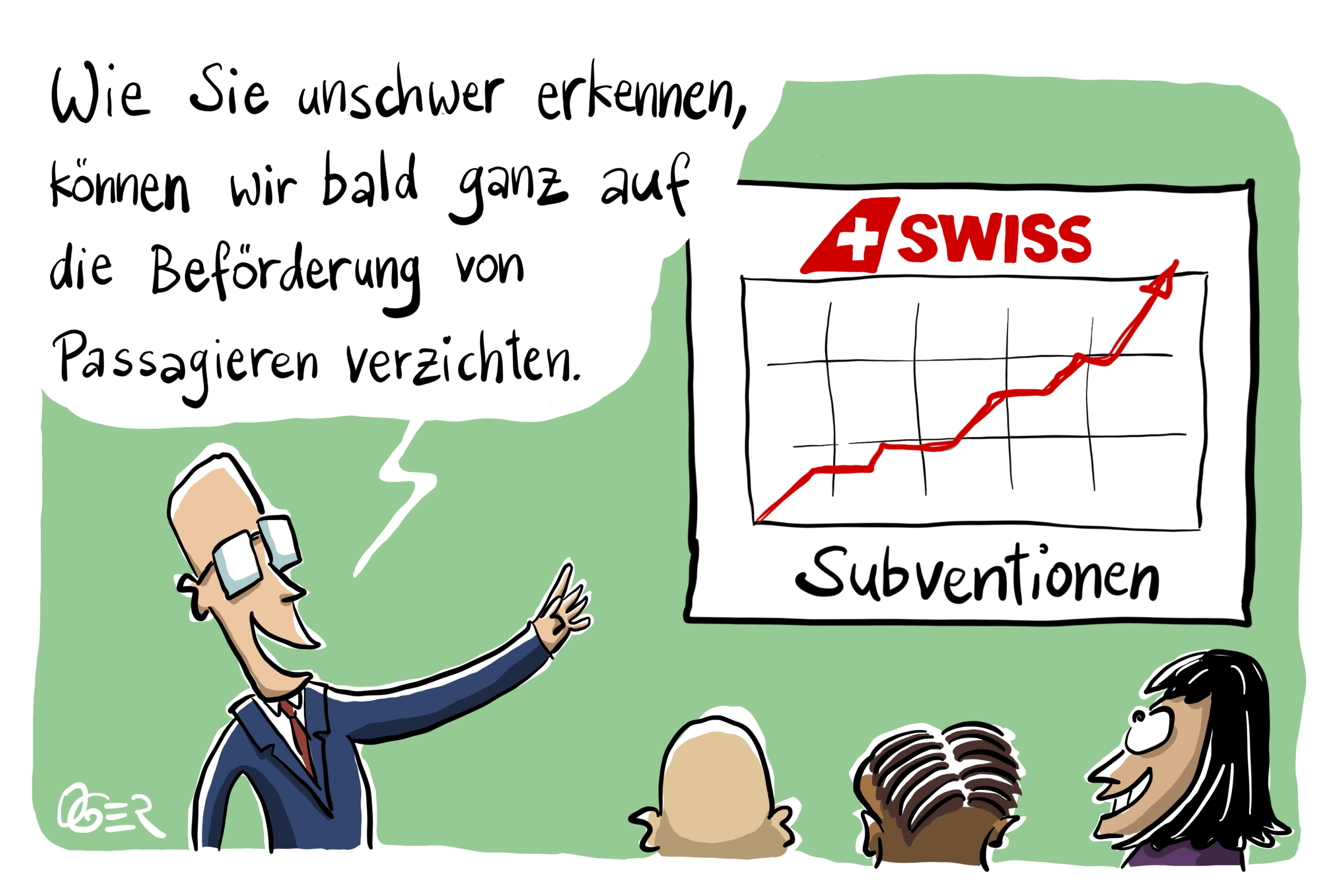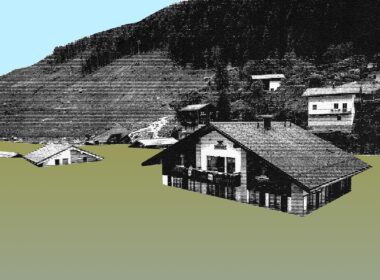Langsam ziehen Wolken über Llay Llay, einer Kleinstadt in den chilenischen Voranden, nur gut eine Stunde von der Hauptstadt Santiago entfernt. Man hört die nahe Panamericana, eine Autobahn, die von Patagonien über Santiago bis nach Alaska führt. Die Landschaft ist geprägt von Plantagen und den Schornsteinen einer riesigen Flaschenfabrik.
Es ist Hochsommer, das Thermometer zeigt mehr als 30 Grad im Schatten an und seit Wochen ist kein einziger Tropfen Regen gefallen. Die ländlichen Trinkwasserbestände verkünden einen kritischen Grundwasserstand – in den kommenden Wochen könnte in manchen Dörfern das Trinkwasser ausgehen.
Diese unscheinbare Kleinstadt, wie es Dutzende in Chile gibt, ist in der vergangenen Präsidentschaftswahl aus der Menge herausgestochen: Der linke Kandidat Gabriel Boric gewann hier mit über 70 Prozent der Stimmen gegen den rechtsextremen José Antonio Kast. Das sind knapp 15 Prozent mehr als der nationale Durchschnitt. Woran liegt das?
Wahlsieg der politischen Aussenseiter:innen
Am 19. Dezember zur Stichwahl herrscht im ganzen Land angespannte Stimmung, die Prognosen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kast und Boric voraus. Um Punkt 18 Uhr schliessen die Wahllokale. Bereits eine halbe Stunde danach ist klar: Chile wird ab dem 11. März einen 35-jährigen Präsidenten haben. Ein Präsident, der vor zehn Jahren als Studierendenführer die Wasserwerfer und Gasgranaten der Regierung abbekommen hatte, später ins Parlament gewählt wurde und dort – mit seinem Bart, Irokesenschnitt und Jeans – als politischer Aussenseiter galt.
Innerhalb kürzester Zeit kommen Hunderte Menschen im Zentrum von Llay Llay zusammen, um zu feiern. Sie schwenken Fahnen und umarmen sich vor Glück. Ein paar Personen stellen eine kleine Leinwand und Lautsprecher auf: Zu sehen ist die Liveschaltung der Rede des neuen Präsidenten, der in Santiago seine Verbundenheit zu den sozialen Bewegungen und dem laufenden verfassungsgebenden Prozess unterstreicht. Vor jubelnder Menge sagt er: „Nie wieder wird ein Präsident seinem eigenen Volk den Krieg erklären.”
Maria Jara Pereira und ihre 24-jährige Tochter Paz Yañez Jara sind in der Menge in Llay Llay: „Ich war die ganze Woche sehr nervös, mein Bauch schmerzte unaufhörlich”, erinnert sich Yañez. Dann die Erleichterung: Der Sieg von Boric ist für die beiden Aktivistinnen gleichbedeutend mit dem Ende der Repression.
Sie waren Teil der Revolte vom 18. Oktober 2019, die schlussendlich zum aktuellen verfassungsgebenden Prozess geführt hat. Der rechte Präsident Piñera reagierte auf die Proteste mit der Ausrufung des Ausnahmezustands. Seine Worte – „wir befinden uns im Krieg” – blieben im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung präsent. Es folgten massive Menschenrechtsverletzungen, die bis heute weitgehend ungestraft geblieben sind.
In Llay Llay äusserte sich die Kriegserklärung mit Schüssen auf Demonstrierende, willkürlichen Festnahmen sowie Folter auf der Polizeiwache. Bis heute werden Demonstrationen von der Polizei angegriffen, so zuletzt am 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Aktivistinnen Jara und Yañez erinnern sich, wie die Polizei am zentralen Platz Tränengasgranaten auf die Menge schoss und auf Frauen einprügelte.
Obwohl Yañez den Zettel drei Wochen danach für den linken Präsidentschaftskandidaten eingeworfen hatte, glaubt sie nicht, dass Boric viel verändern wird. Der ehemalige Parlamentarier gilt in linken Kreisen als Reformer, der die Probleme zu wenig radikal angeht. Zudem ist das Regierungsbündnis in beiden Parlamentskammern in der Minderheit, man wird Kompromisse eingehen müssen, die vermutlich zu einer Verwässerung von lang ersehnten Reformen führen werden. „Aber mit ihm werden wir mehr Freiraum haben, um unsere Forderungen kundzutun“, ist Yañez überzeugt. „Eventuell werden sie sogar gehört“, ergänzt sie auf Nachfrage.

Llay Llay im Auge der neoliberalen Krise
Jara lebt mit ihrer Tochter Yañez und ihrem Ehemann in einem Armenviertel der Kleinstadt. Enge Sozialbauten reihen sich aneinander, in der Nähe fährt ein Bus vorbei, der Feldarbeiter:innen zu den Avocadoplantagen bringt. Jara hat, seitdem sie zwölf ist, auf den Feldern gearbeitet. Mittlerweile ist sie im Lager einer Getränkeherstellerin angestellt. „Zum Glück”, findet sie. Ihr Rücken schmerzt von der harten Feldarbeit noch immer.
Doch wenn die beiden Frauen über die Probleme in Llay Llay und dem Tal des Aconcagua reden, geht es ihnen vor allem um die Umwelt. Das fehlende Wasser für die Kleinbäuer:innen, die ausgetrockneten Flüsse und Bäche, in denen man vor wenigen Jahren noch baden konnte, und die gelben Hügel gleich hinter ihrem Haus.
Yañez spricht vom grossen Wasserverbrauch der Minenunternehmen und Avocadoplantagen. Mit unterdrückter Wut in der Stimme sagt sie: „Mittlerweile bringen sich Hirten aufgrund der Trockenheit und der fehlenden Lebensgrundlage um.” Die Aktivistin erwähnt die höheren Krebsraten in den Dörfern um die naheliegende Kupferraffinerie des britischen Konzerns AngloAmerican. Die Zerstörung der Lebensgrundlage der ansässigen Menschen stimmt sie traurig, aber auch wütend.
Diese Probleme scheinen für die beiden Frauen drängender als ihre persönlichen Herausforderungen – obwohl sie eigentlich genug zu beklagen hätten. Das Haus der Familie ist klein, die Löhne am Existenzminimum. Beide kennen Geschichten von Menschen, die aufgrund schlechter medizinischer Versorgung ernsthafte Probleme bekamen, und Jara, die in drei Jahren eigentlich in Rente gehen soll, erwarten umgerechnet 40 Schweizer Franken aus dem privatisierten Pensionsfonds. Nur staatliche Zuschüsse werden ihre Rente auf 160 Franken heben. Dass sie damit leben kann, glaubt sie nicht. „Ich werde weiter arbeiten”, meint Jara etwas verbittert.
Der neue Präsident Boric will alle diese Probleme angehen. Der Mindestlohn soll auf umgerechnet 500 Franken erhöht werden, es soll ein neues solidarischen Rentensystem geschaffen werden und die neue Regierung verspricht den Bau mehrerer Tausend Sozialwohnungen. Zudem soll das Land bis zum Ende der Regierungsperiode aus der Kohle aussteigen, die gerechte Verteilung des Wassers soll garantiert und deren illegale Entnahme bekämpft werden.

Wandel als Frage des Überlebens
Pia Argagnon, eine ortsansässige Soziologin, erstaunt die Besorgnisse der beiden über die Umweltprobleme nicht: „Anhand der derzeitigen ökologischen Krise lässt sich am besten das Resultat der extraktivistischen Politik der letzten Jahre erkennen.” Denn um Rohstoffe abzubauen und zu exportieren, braucht es Wasser. Im Tal des Aconcagua sind die grössten Verbraucher:innen die Kupferminen, in den Anden die Avocado- und Weinplantagen.
Es waren die sogenannten geopferten Zonen – „Zonas de Sacrificio” im chilenischem Sprachgebrauch –, also Gemeinden wie Llay Llay mit extremen Umweltproblemen aufgrund der dort angesiedelten Industrie, die dem linken Boric am höchsten zugestimmt hatten. Darunter etwa Petorca, wo Schulen aufgrund von Wassermangel teilweise geschlossen sind, oder der Hafenort Quintero, wo regelmässig die Strände mit Öl und Kohle verschmutzt werden. Argagnon schlussfolgert: „An diesen Orten ist ein Systemwechsel eine Frage des Überlebens der lokalen Bevölkerung.”
Lange Zeit galt die Basis dieses wirtschaftlichen Systems, die 1980 unter der Militärdiktatur geschriebene Verfassung, als unantastbar. Dank der Proteste von 2019 erarbeitet derzeit ein Verfassungskonvent eine neue Magna Charta – es ist die erste chilenische Verfassung, die während einer Demokratie, und die erste überhaupt, die in Zeiten der Klimakrise geschrieben wird.
Aktivistinnen wie Yañez und Jara hoffen, dass ihre Forderungen in die Verfassung als Grundrechte aufgenommen werden. Derzeit steht der verfassungsgebende Prozess in der Halbzeit. Bis Juli haben die 155 Abgeordneten Zeit, den Text zu schreiben, danach stimmt die Bevölkerung darüber ab, ob der neue Text den alten ersetzen soll.
Es bestand die Angst, dass der rechte Kast versucht hätte, den verfassungsgebenden Prozess zu blockieren. Auch deshalb war der Wahlsieg Borics so wichtig, meint Argagnon. Sie erinnert daran, dass in Llay Llay die Wahlbeteiligung mit fast 60 Prozent um fünf Prozentpunkte über dem nationalen Durchschnitt lag: „Hier gab es eine besonders grosse Wahlmobilisierung, die vor allem von den linken Parteien getragen wurde.”
Der Faktor Kommunistische Partei
Nachdem in der ersten Wahlrunde der linke Boric mit 25 Prozent der Stimmen hinter dem rechtsextremen Kast lag, mobilisierten linke Gruppierungen und Parteien bis weit ausserhalb der eigentlichen Regierungskoalition aus der Kommunistischen Partei und dem Frente Amplio – ein Bündnis neulinker Parteien, vergleichbar mit Podemos in Spanien.
Die Kampagne „Eine Million Türen für Boric” wurde ins Leben gerufen. Im ganzen Land tourten Aktivist:innen von Haus zu Haus, von Tür zu Tür, um für Boric zu werben. Carlos Miranda war mit dabei. Der ehemalige kommunistische Bürgermeisterkandidat meint: „Zumindest in Llay Llay, aber meiner Ansicht nach auch im Rest des Landes waren Mitglieder der Kommunistischen Partei die tragende Kraft an der Basis, um einen Wahlsieg von Boric zu gewährleisten.”
Gemessen an den Parlamentarier:innen ist die KP die stärkste Kraft innerhalb der Regierungskoalition. In der offiziellen Wahlkampagne trat die KP hingegen zur zweiten Runde in den Hintergrund: Zu stark war die Angstkampagne von rechter Seite, eine Regierung mit kommunistischer Beteiligung würde in einer Diktatur, einem Kuba, Venezuela oder gar der Sowjetunion enden. Bis heute sehen nationale und internationale Kommentator:innen ein Problem in der Regierungsbeteiligung der KP.
Auch die NZZ behauptete nach der Wahl, die KP sei ein Problem für die Regierungskoalition von Boric: „Diese vertritt Positionen der traditionellen Linken Lateinamerikas: Solidarität mit Diktatoren von Castro bis Maduro, Verstaatlichung und radikale Umverteilung.” Der Unterton ist klar: Die KP sei eine Gefahr für die chilenische Demokratie.
Miranda widerspricht: Zwar würde man Aspekte der Revolution in Kuba würdigen, es hätten aber insbesondere jüngere Führungspositionen eine kritische Haltung zu den dortigen politischen Systemen. Aber: „Wir sind davon überzeugt, dass man nicht von aussen intervenieren darf, sondern die Länder ihre Probleme von innen lösen müssen.”
Miranda ist überzeugt: Auch wenn die KP den gleichen Namen trägt, unterscheidet sich die politische Tradition der Partei von jenen in Europa. „Wenn man unsere politischen Programme analysieren würde, könnte man durchaus sagen, dass wir seit den 40er-Jahren eher eine sozialdemokratische Partei sind”, meint er mit einem Grinsen im Gesicht. Heute sei man weit davon entfernt, massive Enteignungen zu verlangen.
Allende oder Pepe Mujica?
Orte wie Llay Llay wurden lange Zeit vom chilenischen Zentralismus ignoriert. In der Politik und den Medien geht es um Santiago und die Probleme der Hauptstadt. Der neue Präsident stammt aus dem südlichsten Zipfel Chiles. Er forderte schon vor langer Zeit eine Stärkung der Regionen gegenüber der Hauptstadt. Ein weiterer Grund für viele Menschen in Llay Llay, Boric zu wählen.
Hingegen stimmte gerade in den reichen Gemeinden der Hauptstadt um die 80 Prozent der dort ansässigen Bevölkerung für den rechtsextremen Kast. Es ging um erzkonservative Gesellschaftsideale, aber auch um die Wahrung der eigenen wirtschaftlichen Interessen. Die Angstkampagne zeigte ihre Wirkung, manche sprachen sogar von einer möglichen Wiederholung der Unidad Popular unter Salvador Allende.
Damals versuchte der demokratisch gewählte Sozialist Allende Chile auf friedlichem Weg zum Sozialismus zu führen. Es kam zu massiven Verstaatlichungen und gross aufgebauten Sozialprogrammen. Das Experiment scheiterte am Widerstand der wirtschaftlichen Elite, die in Zusammenarbeit mit den USA und dem eigenen Militär am 11. September 1973 putschte. Es folgten 17 Jahre einer der brutalsten Diktaturen Lateinamerikas.
Miranda glaubt nicht an eine Wiederholung des friedlichen Wegs zum Sozialismus. Die neue Regierung um Boric sei eher vergleichbar mit dem Frente Amplio und Pepe Mújica in Uruguay. Unter Mújica, der von 2010 bis 2015 als uruguayischer Präsident amtierte, wurde der Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche entkriminalisiert, der Sozialstaat ausgebaut und der Verkauf von Marihuana legalisiert.
Für Miranda geht es in der kommenden Regierung um Sozialreformen, Ökologie und mehr Demokratie. Man akzeptiere und verstehe die Komplexität der politischen Prozesse und suche die politischen Kompromisse. „Gerade in diesem Aspekt sticht Boric heraus”, meint Miranda. „Er ist äusserst bescheiden und gibt von Anfang an zu, sich auch täuschen und Fehler begehen zu können.”
Und trotzdem erwartet Miranda harsche Opposition. „Die Mächtigen werden sich gegen jeden Wandel wehren.” Auch könnten Menschen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren relativ schnell unzufrieden sein. „Die Minenarbeiter:innen, die zu relativ viel Geld gekommen sind und dicke Autos fahren, könnten sich gegen höhere Steuern oder Benzinpreise wehren.”
Boric wird mit Samthandschuhen vorgehen müssen, um die Stabilität seiner Regierung zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen soziale Ungleichheiten wie etwa die Wasserverteilung in Tälern wie der Aconcagua angegangen werden. Es ist ein Balanceakt zwischen Reformen und Aufrechterhaltung der Ordnung.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?