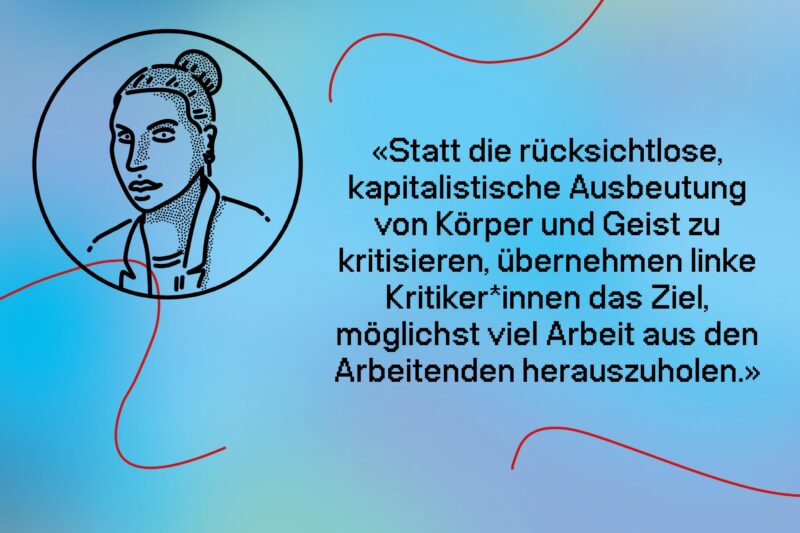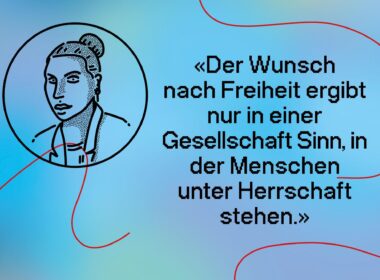Bundeskanzler Friedrich Merz findet, dass sich die Deutschen zu oft krankmelden. Man müsse darüber sprechen, wie man Anreize schaffe, dass die Menschen trotz Krankheit zur Arbeit gehen, sagte der CDU-Chef. Mit Verweis auf eine schwächelnde Wirtschaft erhob Merz in seiner Amtszeit schon mehrfach den Vorwurf, in Deutschland werde zu wenig gearbeitet. So stellte er bereits den Acht-Stunden-Tag in Frage und plädierte für eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit.
Wie erwartet werden nun auch diese neuen Äusserungen des Kanzlers von links kritisiert. Präsentismus – also das Arbeiten trotz Krankheit, oft sogar gegen ausdrücklichen ärztlichen Rat – führe in Wirklichkeit zu «mehr Krankheit und vermehrtem Krankheitsausfall». Durch erhöhte Unfallrisiken, mehr Fehler und sinkende Produktivität entstünden sogar deutlich grössere volkswirtschaftliche Schäden als durch krankheitsbedingte Ausfälle, argumentieren linke Kritiker:innen – und demonstrieren damit in zynischer Manier ihre konstruktive Logik: Das elementare Interesse an Ruhe im Krankheitsfall soll ausgerechnet dadurch zur Geltung kommen, dass es sich funktional dem entgegengesetzten Kapitalinteresse an maximaler Verwertung der Arbeitskraft unterordnet.
Anders gesagt: Ein grundlegendes Bedürfnis von Menschen erhält nur dadurch seine Berechtigung, dass es für die Wirtschaft profitabler ist, seine Befriedigung zuzulassen. Was im Umkehrschluss ansteht, wenn das Bedürfnis der Arbeitenden dem Kapitalinteresse entgegenläuft (der Regelfall), ergibt sich von selbst.
Anstatt sich im Interesse der Gesundheit als Gegner:in der rücksichtslosen, kapitalistischen Ausbeutung von Körper und Geist des Menschen aufzustellen, übernehmen linke Kritiker:innen so einfach die kapitalistische Zielsetzung, so viel Arbeit wie möglich aus den Arbeitenden herauszuquetschen.
Das basale Interesse von Menschen, sich bei Krankheit zu erholen, kommt in der Diskussion gar nicht mehr vor.
Linke Kritiker:innen teilen die Sorge um die Volkswirtschaft und widersprechen nicht, dass für deren Erfolg mehr gearbeitet werden müsse – bestreiten lediglich, dass Merz’ Vorschläge dafür taugen. Sie stellen nicht in Frage, dass für eine steigende Wirtschaftsleistung auch eine zunehmende Ausbeutung von Arbeitskraft erforderlich sei – verneinen nur, dass sie sich auf diese Weise realisieren liesse.
Kranke seien «weniger produktiv, arbeiten fehleranfälliger und stecken ihre Mitarbeitenden an». Krank zur Arbeit zu gehen sei deshalb auch volkswirtschaftlich unvernünftig. So argumentiert etwa Maurice Höfgen im Surplus Magazin.
In der taz darf man lesen, dass es Unternehmen teuer zu stehen kommt, wenn ihre Leute krank zur Arbeit gehen, denn dann steige das Risiko für Unfälle und Fehlentscheidungen. Erholung sei «ein wesentlicher Faktor einer funktionierenden Wirtschaft, kein ärgerlicher, unnötiger Kostenfaktor».
Diese Argumentationsweise ist im Fall einzelner Arbeiter:innen, die versuchen, ihre Vorgesetzten mit dem Argument höherer Produktivität vom Homeoffice zu überzeugen, durchaus plausibel. Arbeiter:innen sind schliesslich zu Recht in erster Linie an ihrem eigenen Fort- und Auskommen interessiert. Von einer politischen Kritik, die für sich in Anspruch nimmt, im Interesse der arbeitenden Klasse zu argumentieren, erwarte ich jedoch, dass sie den grundlegenden Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital offenlegt, anstatt die bedürfnisfeindliche Profitlogik einfach zu reproduzieren.
Das basale Interesse von Menschen, sich bei Krankheit zu erholen, kommt in der Diskussion dann nämlich einfach gar nicht mehr vor. Krankheit wird zum Produktivitätsproblem für Unternehmen, bei dessen Lösung sich zwei Managementkonzepte gegenüberstehen: Trotz Krankheit weiterarbeiten und dabei möglicherweise Fehler machen sowie andere anstecken – oder Pause machen, in der Zeit keine Leistung erbringen, dafür aber auch keine weiteren negativen Effekte produzieren.
Für die beste Lösung des Arbeitgeberproblems «Krankheit» strenge ich jedenfalls meinen Grips nicht an. Wer krank ist, will sich erholen – und nicht arbeiten. Wenn der Ausfall von Arbeiter:innen für das Kapital (und für Friedrich Merz als personifizierten Gesamtkapitalisten) ein Problem darstellt, dann liegt da offensichtlich ein Interessenkonflikt vor. Es steht uns besser, den mal ernst zu nehmen.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 10 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 780 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 350 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 170 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?