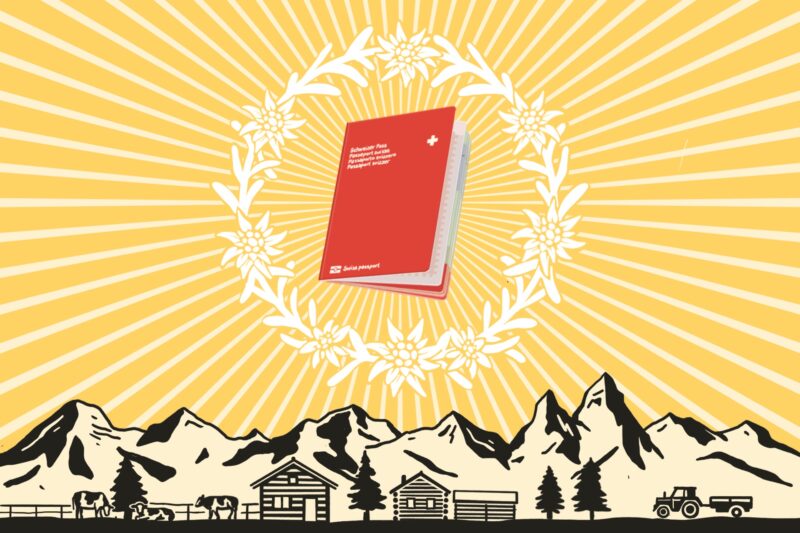Meinen neunzehnten Geburtstag verbrachte ich damit, die Höhe unserer Dorfkirche und die Wasserquellen der Brunnen in unserem Dorf auswendig zu lernen. Zwei Tage später – so kurz vor Weihnachten, dass die Geschenke schon fast unter dem Baum lagen – fand nämlich das Einbürgerungsgespräch meiner Familie statt.
Kurz nach meinem siebten Geburtstag waren meine Familie und ich von São Paulo, einer brasilianischen Mega-Stadt, in das Dorf in der Schweiz gezogen, in dem wir bis heute leben. Ich habe die gesamte obligatorische Schulzeit in der Schweiz verbracht und bin hier gross geworden. Dennoch sass ich kürzlich im Gemeindehaus und musste eine Gruppe fremder Menschen davon überzeugen, dass ich des Schweizer Passes würdig bin.
Die Einbürgerungspolitik in der Schweiz ist europaweit einer der restriktivsten. Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung hat keinen Schweizer Pass und keine politische Stimme.
Das Wort, welches man während des Einbürgerungsprozesses in der Schweiz wohl am meisten hört, ist „Integration”. Das Bürgerrecht für Ausländer*innen setzt viel voraus. Vor allem aber muss man eine „erfolgreiche Integration” in einem Gespräch bei der Gemeinde beweisen können. Das Absurde dabei: Auch die Kinder von Ausländer*innen, die hier geboren und aufgewachsen sind, müssen Belege dafür liefern, dass sie hierher gehören. Von einer erleichterten Einbürgerung können sie bis heute nicht profitieren. Die Idee, dass junge Menschen, die bereits ihr ganzes Leben in der Schweiz verbracht haben, einer Gruppe von fremden Menschen ihre Integration beweisen müssen, ist veraltet und der heutigen Realität fern.
Klimahysterisch und radikal oder unverantwortlich und faul: Es wird viel an jungen Menschen rumgenörgelt. Schlimmer als die Kritik ist aber ihre fehlende Repräsentation in der Öffentlichkeit. Während sich alle Welt über Anliegen der Jugend äussert, finden diese selbst nur in sozialen Netzwerken eine Plattform. Das ändert nun die Kolumne „Jung und dumm”.
Helena Quarck ist 18 Jahre alt und Schülerin. Sie ist als Siebenjährige aus Brasilien in die Schweiz gezogen und musste Deutsch lernen. Diese Beschäftigung mit Sprache hat sie zum Schreiben gebracht. Helena ist Redaktorin des Jugendmagazins Quint.
Die Einbürgerungspolitik in der Schweiz ist europaweit eine der restriktivsten. Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung hat keinen Schweizer Pass und keine politische Stimme. Auch beantragt nur ein Bruchteil der Ausländer*innen, die die Kriterien für eine Einbürgerung erfüllen, das Bürgerrecht. Gründe für ihre Zögerlichkeit gibt es viele. Darunter etwa die langen Wartezeiten, der bürokratische Aufwand und nicht zuletzt die Kosten, die je nach Kanton zwischen 800 und 3’600 Schweizer Franken liegen. Für viele Familien ist dieser Betrag eine Hürde.
Es wohnen also immer mehr Menschen ohne Schweizer Pass in diesem Land und ihre Einbürgerung bleibt restriktiv. Wir müssen uns daher fragen: Können wir noch von einer starken Demokratie sprechen, wenn ein Viertel der Bevölkerung, die von politischen Entscheiden betroffen ist, keine politische Mitsprache hat?
Seit einer Volksinitiative von 2017 wird die Einbürgerung der „Terzos”, also der dritten Generation der Eingewanderten, erleichtert. Sie wurde damals deutlich angenommen – die Mehrheit der Stimmberechtigten hat also erkannt, wie unsinnig es ist, diese Menschen, deren Eltern teilweise bereits in der Schweiz geboren waren, durch den langwierigen Einbürgerungsprozess zu schicken.
Gegenüber den Secondos und Secondas zeigte sich die Schweizer Bevölkerung nicht im selben Mass bereit, den Prozess zu reformieren. Es gab bereits drei Versuche, eine erleichterte Einbürgerung für die zweite Generation einzuführen. Alle scheiterten an der Urne. 2021 versuchten es Lisa Mazzone, Ständerätin der Grünen, und Paul Rechsteiner, Ständerat der SP, mit zwei Vorstössen erneut.
Wir sind in lokalen Vereinen tätig, sitzen in unseren Schulen, arbeiten und bezahlen hier Steuern – und das schon ihr ganzes Leben lang.
Rechsteiner forderte sogar einen Systemwechsel zum „ius soli”. Das würde bedeuten, dass Kinder, die in der Schweiz geboren werden, automatisch das Schweizer Bürgerrecht erhalten. Mazzone forderte eine „mildere” Variante: keine automatische, sondern eine erleichterte Einbürgerung für Secondos und Secondas. Im Interview mit der WOZ meinte Paul Rechsteiner: „Es wäre ein Rückfall in finstere Zeiten, wenn der Bundesrat nicht mindestens Lisa Mazzones Vorschlag aufnimmt.” Der Bundesrat lehnte beide Vorstösse ab. Die WOZ titelte: „Eine Ohrfeige für die jüngere Generation”.
Solche „Ohrfeigen” kassiert die junge Generation von Ausländer*innen in der Politik leider oft. Zum Beispiel von der Schweizerischen Volkspartei (SVP), die mit rassistischen Narrativen gegen die erleichterte Einbürgerung kämpft. 2017, kurz vor der Volksabstimmung zur erwähnten „Terzo”-Initiative, warnte die SVP vor „fatalen” Konsequenzen. Etwa vor eingebürgerten Kindern, die keiner weiblichen Lehrperson die Hand schütteln würden. Dass die SVP die Feindschaft gegenüber Ausländer*innen fördert und als politische Waffe benutzt, ist nichts Neues. Es hat mich dennoch überrascht, dass die Partei mit diesem absurden Narrativ auch auf Kinder im Primarschulalter zielt.
Anfang Jahres veröffentlichte SVP-Nationalrat Andreas Glarner einen Tweet mit einer verstörenden Aussage: Menschen, die in der Schweiz geboren sind, seien genauso wenig Schweizer*innen, wie eine Maus, die im Pferdestall geboren wurde, ein Pferd sei.
Herr Glarner greift hier nicht nur auf einen äusserst abwertenden Tiervergleich zurück, sondern beweist noch einmal, wie tief die SVP in den Topf der rassistischen Polemik greifen muss, um gegen eine erleichterte Einbürgerung für Secondos und Secondas zu hetzen. Argumente haben sie nämlich keine. Dass dieser Tweet von einem Nationalrat der wählerstärksten Partei der Schweiz kommt, ist erschreckend. Gerade weil es die SVP wegen ihrer rassistischen Position schafft, ihre grosse Wähler*innenbasis zu behalten.
Die erleichterte Einbürgerung für die zweite Generation von Ausländer*innen ist längst überfällig, nicht zuletzt um die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie aufrechtzuerhalten.
Die Zugehörigkeit zur Gesellschaft wurde Ausländer*innen der zweiten Generation in Form von drei abgelehnten Initiativen abgesprochen. Gleichzeitig verbreitet die stärkste Partei der Schweiz ein rassistisches Narrativ wie dieses von Andreas Glarner, welche ihre Ausgrenzung weiter fördert.
Verdienen Secondos und Secondas nicht mehr Anerkennung als das? Secondos und Secondas sind hier. Wir sind in lokalen Vereinen tätig, sitzen in unseren Schulen, arbeiten und bezahlen hier Steuern – und das schon unser ganzes Leben lang. Zu behaupten, diese Menschen müssten ihre Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft unter Beweis stellen, in der sie seit ihrer Geburt leben, ist sinnlos, denn diese Kinder sind seit ihrem ersten Atemzug Teil davon.
Der restriktive und willkürliche Einbürgerungsprozess hindert viele daran, ihr Bürgerrecht zu beantragen und eine politische Stimme zu haben. Die erleichterte Einbürgerung für die zweite Generation von Ausländer*innen ist längst überfällig, nicht zuletzt um die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie aufrechtzuerhalten.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 16 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1092 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 560 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 272 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?