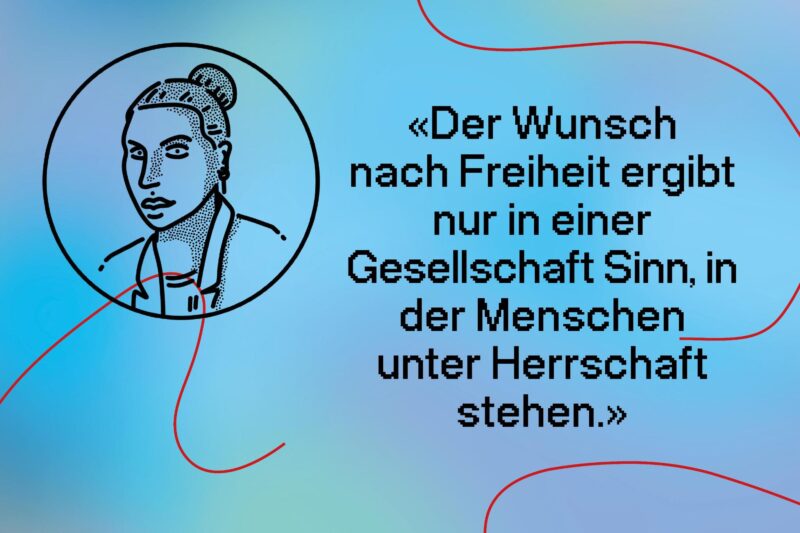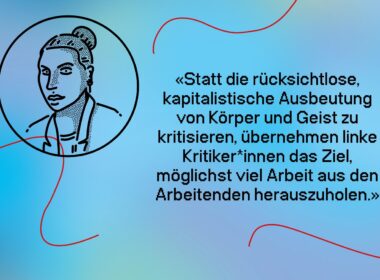Neulich ging es in einer Diskussion um Freiheit, die ein Genosse als Schlüssel zu einer besseren Gesellschaft lobte. Ich widersprach, denn in meiner Vorstellung einer vernünftigen Gesellschaft hat die Freiheit nichts zu suchen.
Freiheit gilt als höchster Wert, den sich die hiesige Gesellschaft gross auf die Fahnen schreibt. Im sogenannten Westen sind die Bürger*innen heute politisch und ökonomisch frei. Meist braucht es für die Zustimmung zu dieser Tatsache nicht mehr als den Negativvergleich zu «früher»: denn «damals» lebte man noch unter der Herrschaft eines Königs oder Kaisers und war dessen Anordnungen unterworfen. Politische Freiheiten, etwa Meinungs- oder Pressefreiheit, gab es nicht und die politischen Rechte waren vom gesellschaftlichen Stand abhängig.
Heute tritt die politische Herrschaft als die Macht auf, die Freiheit gewährt. Und das Volk versteht es genau so: Dankbar feiert es seine Freiheit als Möglichkeit, die eigenen Zwecke zu verwirklichen.
Alle dürfen arbeiten und in den meisten Fällen müssen sie es. Alle dürfen den Beruf wählen, den sie möchten – müssen jedoch die Konsequenzen tragen, wenn ihre Arbeitskraft nicht profitabel eingesetzt werden kann. Alle dürfen sich aufhalten, wo sie wollen und so oft in den Urlaub fahren, wie sie möchten – vorausgesetzt, sie besitzen den richtigen Aufenthaltsstatus, haben sich im Rahmen des staatlichen Regelwerks einwandfrei verhalten und verfügen über das nötige Kleingeld dafür – versteht sich.
Alle dürfen ihre Meinung äussern – innerhalb von Schranken, die durch die gesetzgebende Gewalt definiert werden. Dabei entscheidet letztere laufend, welche Äusserungen noch zulässig sind und welche beispielsweise bereits als volksverhetzend gelten und verboten werden. Und natürlich muss die Äusserung eine blosse Meinung bleiben und darf keinen Anspruch auf Durchsetzung erheben. Meinungsfreiheit ist daher nicht nur ein Recht – sie ist vor allem ein Gebot: «Im Grossen und Ganzen darfst du denken, was du möchtest. Daraus folgt aber noch überhaupt nichts, denn es ist ja nur deine Meinung.»
Die meisten Menschen sehen die Freiheit nicht als Zumutung, sondern als freundliches Angebot, ihre eigenen Zwecke zu verwirklichen.
Alle dürfen theoretisieren, sagen, publizieren und verbreiten, was sie wollen – ebenfalls innerhalb der gesetzgebenden Schranken und solange sie damit nur ihre Perspektive als eine von vielen einbringen, niemals aber Anspruch auf Geltung erhebt.
Und schliesslich dürfen auch alle frei wählen, was sie wollen – vorausgesetzt, die Partei zu ihren Gunsten setzt sich für den Erfolg der demokratisch-kapitalistischen Nation ein und hat bereits alle Hürden zur Zulassung bei der Wahl gemeistert.
Die meisten Menschen sehen diese Umstände nicht als Zumutung, die ihren materiellen Zwecken zuwiderläuft, sondern als freundliches Angebot, diese zu verwirklichen. Kritik richtet sich nie gegen die Freiheit selbst, sondern höchstens gegen ihre angeblich unzureichende Verwirklichung. Oder sie verhandelt das notwendige Mass an Begrenzung, das verhindern soll, dass die Freiheit des Einen die des Anderen untergräbt.
Diese Begrenzungen sind notwendig. In einer Gesellschaft, in der alle frei sind, zu tun und zu lassen, was sie wollen, braucht die Freiheit der Einzelnen Grenzen, damit die Vielen ihre Freiheit ausüben können. Die Grenzen sind also eine Konsequenz der Freiheit – nicht ihre Aufhebung.
Aber gegen Freiheit an sich stellt sich hier (fast) niemand und schon der blosse Verdacht ruft Entsetzen hervor: «Bist du etwa für Sklaverei?»
Menschen, die die Freiheit vermissen – wie mein Genosse – tun dies aus einem Ideal heraus: Sie wissen bereits, dass die Lohnarbeit kein freundliches, bedürfnisorientiertes Angebot ist, ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie wissen auch, dass sie sich nie für diese Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung entschieden haben, sondern hineingeboren wurden und sie ihnen nun täglich mit all ihren Folgen aufgedrückt wird.
Vielleicht merken sie auch, dass sie hier nicht wirklich zurechtkommen, dass sie ständig auf Grenzen und Schranken stossen, dass sie gerne anders leben würden – aber es ihnen nicht möglich ist. Gleichzeitig klammern sie sich eisern an das Ideal einer Freiheit, die in seiner Vorstellung nicht zu den unangenehmen Zwängen ihrer Leben passt. Vielleicht denken sie dabei auch an eine Gesellschaft, in der es um die Bedürfnisse der Menschen geht, statt um die Profite von Unternehmen.
Dann stellt sich aber die Frage: Wie passt denn die Freiheit in die Gesellschaft, die sich vorgestellt wird? Oder anders gefragt: Wie passt Freiheit überhaupt in Gesellschaft?
Freiheit in Gesellschaft ist absurd und macht überhaupt nur in einer kapitalistischen Ordnung Sinn.
Wenn ich von Freiheit spreche, dann meine ich natürlich nicht die Freiheit, sich seine Sockenfarbe selber aussuchen zu dürfen oder zu entscheiden, welchen Film man heute Abend schaut. Ich meine auch nicht die Freiheit, lieben zu dürfen, wen man eben liebt und sich ausdrücken zu dürfen, wie man sich eben ausdrücken möchte.
Ich meine die Freiheit des Individuums im gesellschaftlichen Zusammenhang. Die Freiheit in Fragen, bei denen es für die Gruppe wirklich um etwas geht: Arbeit, Produktion, Organisation und gemeinsame Entscheidungsfindung. Also: Wie wird produziert, was wird produziert, wie organisieren wir uns, wie planen wir? Das ist die Freiheit, die in der kapitalistischen und demokratischen Gesellschaft hochgehalten wird – und es ist die Freiheit, die Menschen in Konkurrenz zueinander zwingt, statt dass sie in kooperativer Zusammenarbeit ihre geteilten Anliegen gemeinsam und planvoll abwickeln.
Ich behaupte also: Freiheit in Gesellschaft ist absurd und macht überhaupt nur in einer kapitalistischen Ordnung Sinn. In sozialistischen Gesellschaften hat Freiheit nichts zu suchen.
Unterstütze unabhängigen Journalismus.
Das Lamm finanziert sich durch seine Leser*innen und ist für alle frei zugänglich – spende noch heute!
Freiheit heisst, tun und lassen zu können, was man will. Wer frei sein will, möchte die Erlaubnis, einen unbestimmten Willen in die Tat umzusetzen. Es geht nicht um einen konkreten Willensinhalt. Es geht ganz abstrakt darum, die Möglichkeit zu haben, den eigenen Willen zu verwirklichen. Das bedeutet: Der Wunsch nach Freiheit ergibt nur in einer Gesellschaft Sinn, in der Menschen unter Herrschaft stehen.
Wenn wir uns vorstellen, alleine auf der Welt zu sein oder als Einsiedler*in im Wald zu leben, wäre dieser Wunsch überflüssig. Wer ohne andere Menschen lebt – und damit ohne fremde Willen und Zwecke, die den eigenen widersprechen könnten – kommt nicht auf die seltsame Dopplung, «frei tun und lassen zu können, was man will». Denn man tut ja schon, was man will – was den eigenen gesetzten Zwecken entspricht.
In Gesellschaft hingegen, wenn Menschen als Teile eines Ganzen miteinander verbunden sind, ist Freiheit ein irrwitziges Konzept. Zusammenleben bedeutet, Arbeit zu organisieren, um sich zu versorgen. Es bedeutet, gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren und zu verteilen, Aufgaben zu koordinieren und Verantwortung zu teilen. In einem solchen Gefüge ist Freiheit weder im Interesse der Gruppe noch der Einzelnen.
In einer vernünftig organisierten Gesellschaft hat niemand ein Interesse an Freiheit.
Das sehen alle, die schon einmal versucht haben, ein beliebiges Projekt gemeinsam umzusetzen: Menschen in Zusammenarbeit einfach ihrer Freiheit zu überlassen – ‚macht mal, was ihr wollt‘ – statt die Arbeit in Teilarbeiten zu zerlegen, sinnvoll aufzuteilen und zu planen, ist Unsinn. Und das möchte auch keine Person, die Interesse am Gelingen des gemeinsamen Vorhabens hat.
Nebenbei bemerkt: Dass Arbeitsteilung Planung erfordert, wissen natürlich auch und gerade die grössten Kapitalist*innen. In jedem Unternehmen ist alles bis ins Detail durchorganisiert, jeder Arbeitsschritt festgelegt – niemand macht dort einfach, «was sie wollen». Das wäre auch unzweckmässig.
Freiheit in Gesellschaft ist nicht nur unvernünftig, wenn eine bedürfnisorientierte Versorgung aller das Ziel ist. Durch Freiheit hebt sich auch nicht einfach die gegenseitige Abhängigkeit auf. Menschen, die miteinander produzieren oder ihr Zusammenleben organisieren, beeinflussen sich zwangsläufig gegenseitig. Die Frage ist nur, ob die Menschen in einer Gesellschaft ihre gegenseitige Bedingtheit im Voraus anerkennen und dann gemeinsam planen – oder ob sich die Abhängigkeit erst im Nachhinein als Sachzwang durchsetzt.
Etwa wenn Automobilkonzerne wieder Werke schliessen und tausende Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit entlassen, weil die Profite nicht wie erwartet steigen und sich die Arbeiter*innen in Polen oder Tschechien günstiger ausbeuten lassen als ihre Kolleg*innen hierzulande. Immerhin konnten die Beschäftigten sich vorher freiwillig in die Dienste der Firma begeben (danke Berufs- und Arbeitsplatzfreiheit!) – das Risiko, das damit einhergeht, müssen sie jetzt natürlich selbst tragen.
Ganz ähnlich ergeht es dem kleinen Supermarkt an der Ecke, der schliessen muss, weil er bei den Preisen der Discounter einfach nicht mithalten kann. Heute insolvent, freute sich der Besitzer vor wenigen Jahren noch, dass er endlich einen Kredit von der Bank bekam und damit seinen Traum eines eigenen Ladens im Viertel Wirklichkeit werden lassen konnte. Die Lizenz dazu hatte er ja: Danke Gewerbefreiheit!
Menschen in Gesellschaft Freiheit zu verordnen bedeutet, sie zu zwingen, so zu handeln, als wären sie allein.
Freiheit ist also nicht nur eine Erlaubnis. In erster Linie ist sie eine staatliche Verordnung: «Sieh zu, wie du zurechtkommst! Die Erlaubnis (und die Verpflichtung!) alleine für dein Zurechtkommen zu sorgen, hast du. Innerhalb gewisser Schranken, damit du die Freiheit der anderen freien Einzelkämpfer*innen nicht verletzt, versteht sich. Aber innerhalb dieser Schranken darfst du mit deinem Eigentum – das ich dir gerne vor den Eingriffen der anderen freien Bürger*innen schütze – tun und lassen was du willst. Good luck!»
Das ist Freiheit: Sich in Gesellschaft so aufzuführen (und es zu müssen!) als wäre man allein.
Dem Genossen habe ich dann übrigens noch einen Vortrag von Peter Decker über die Freiheit empfohlen (nachzuhören im Marxistischen Vortragsarchiv, bei Spotify oder YouTube). Ich freue mich schon auf eine neue Diskussion – vielleicht dann in der nächsten Kolumne.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 15 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1040 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 525 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 255 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?