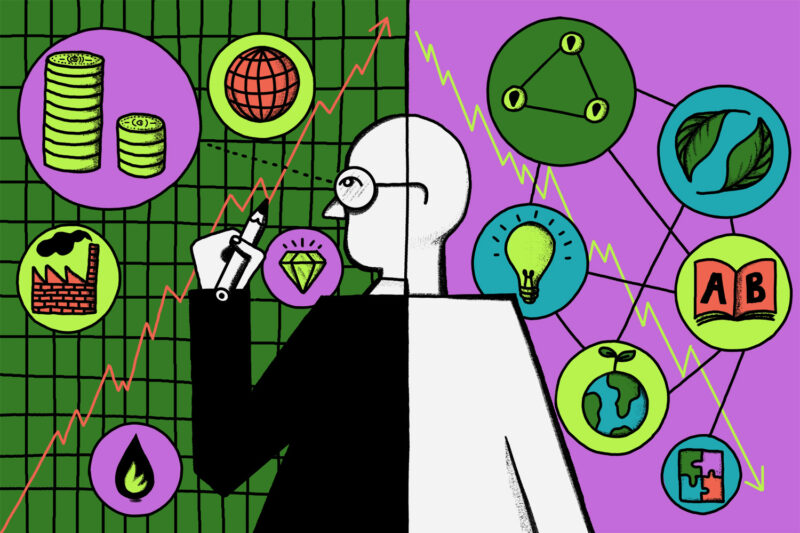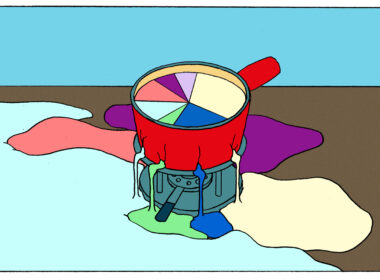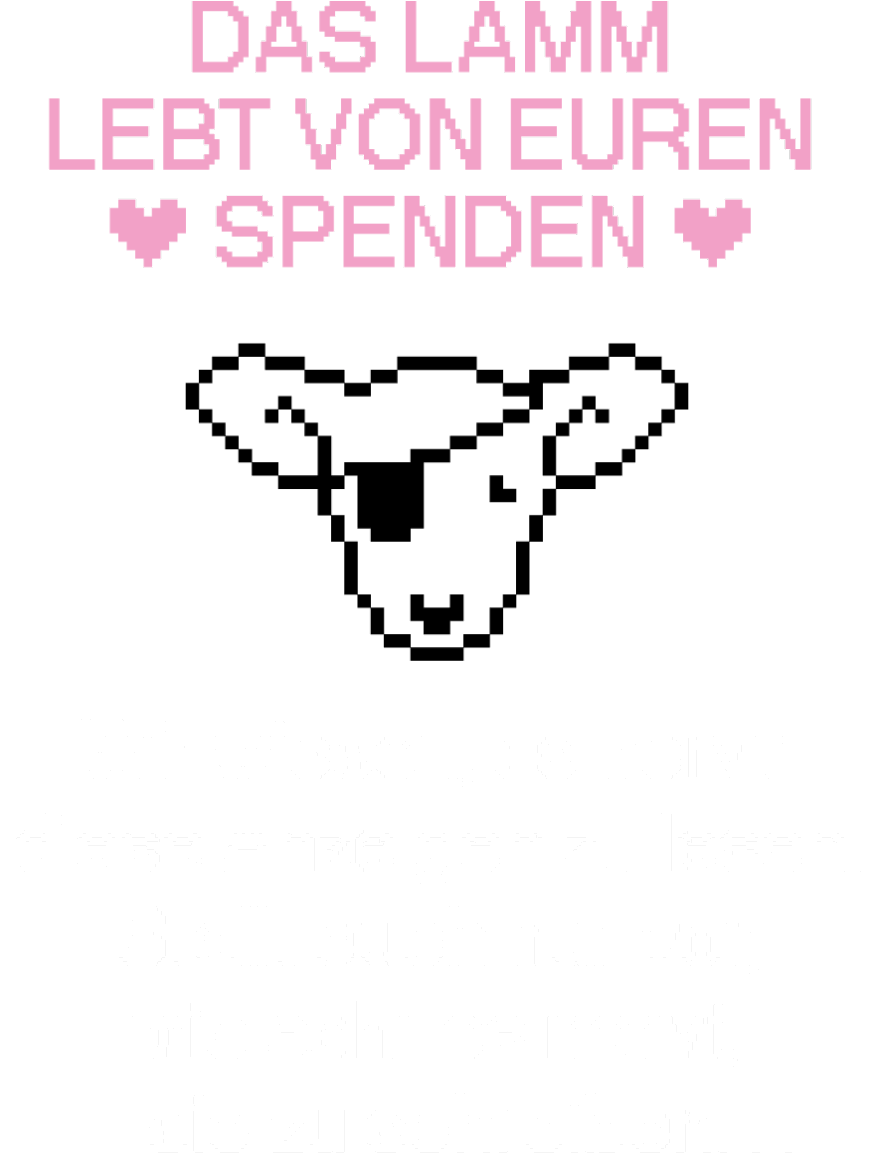Auch wenn auf der Bühne kein Lagerfeuer lodert: Der „Fireside Chat” mit UBS-Chef Sergio Ermotti soll ungezwungen wirken. Das Swiss Finance Institute (SFI), eine private Stiftung mit Sitz in Zürich, hat den Leiter der Schweizer Megabank im November 2023 zu ihrem 18. Jahrestreffen im Lake Side View Hotel in Zürich eingeladen. „Warum sollten Grossbanken höhere Anforderungen erfüllen müssen als andere Institute?”, fragt Ermotti ins Publikum. Schweizer Banken seien doch gut kapitalisiert und reguliert.
Das SFI gehört laut dem Ranking der W.P. Carey School of Business zu den besten 10 Finanzforschungszentren der Welt.
Das Ziel der Stiftung: die Schweizer Banken- und Finanzbranche international an der Spitze halten. Dafür fördert sie seit bald 20 Jahren ausgewählte Finanzprofessor*innen an Universitäten in der ganzen Schweiz. Und dies weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit.
Dass Banken, Unternehmen und Stiftungen einzelne Forschungsprojekte, Lehrstühle oder Forschungszentren an Universitäten finanzieren, ist nichts Ungewöhnliches. Doch die Förderung des Swiss Finance Institute funktioniert anders. Das Institut bezahlt einzelne Forscher*innen individuell – und zwar nur dann, wenn sie die akademischen Erwartungen der Stiftung erfüllen. Die Kriterien dafür legt der Stiftungsrat fest – er besteht mehrheitlich aus Bankenvertreter*innen. Die Finanzlobby vergibt also einen Bonus für die „akademische Exzellenz” von Forscher*innen. Und behält es sich vor, die Kriterien dieser Exzellenz zu definieren.
Dies legen Verträge, Sitzungsprotokolle und interne Richtlinien offen, die die Zusammenarbeit zwischen der Universität Zürich und dem SFI regeln und die das Lamm, dem WAV Recherchekollektiv und der Republik erstmals vorliegen.
Und die UZH ist kein Einzelfall: Das SFI arbeitet mit fast allen Schweizer Hochschulen zusammen – den Universitäten Genf, Basel, Lugano, St. Gallen und Lausanne, sowie der ETH und der EPFL. Wie kann es sein, dass ein Interessenverband ausgewählte Akademiker*innen grossflächig fördert, ohne dass die Universitäten transparent darüber Rechenschaft ablegen? Führt die äusserst ungewöhnliche Mischform von öffentlicher und privater Finanzierung, die das SFI praktiziert, nicht zu Interessenkonflikten? Und wie wird gewährleistet, dass die Wissenschaft ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und zu angemessenen Risikobewertungen kommt, wenn Forschung und Lehre an den Geldtöpfen des Finanzplatzes hängen?
Individuelle Gehaltserhöhungen
„Wir wollen die Schweiz als attraktiven Standort für Topforschende durch eine finanzielle Entschädigung fördern”, sagt Markus Bürgi im Stiftungssitzbüro des SFI im Kreis 1 mit Blick auf die Limmat. Bürgi ist Mitglied der Geschäftsleitung des SFI und amtiert in Adliswil als Stadtrat und Schulpräsident für die FDP. „Die Schweizer Universitäten verfügen nicht über die finanziellen Mittel, um mit den internationalen Lohnstandards in den Finanzwissenschaften mitzuhalten.”
Das SFI ist nicht als Hochschulinstitut akkreditiert wie etwa die Swiss Business School in Zürich. Es handelt sich auch nicht um ein An-Institut wie das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) der Universität Luzern. An-Institute sind zwar durch Universitäten akkreditiert, aber privat finanziert und organisatorisch unabhängig. Stattdessen ist das SFI als Think Tank zu verstehen, der aus Professor*innen besteht, die an Schweizer Universitäten im Bereich Finance und Banking angestellt sind. Das SFI bezeichnet sich dennoch als „Fakultät” mit „Fakultätsmitgliedern”.
Die 25 Professoren mit SFI-Lehrstuhl gehören zu den Auserwählten, die das SFI mit einem Bonus von 50‘000 Franken pro Jahr fördert.
Das SFI vergibt also keine akademischen Abschlüsse für die Kurse, die es anbietet – dies tun die Partneruniversitäten, an denen die Kurse stattfinden. Während die Universitäten die Bachelor- und Masterstudiengänge selbst organisieren und finanzieren, zeigt sich beim SFI-Doktoratsprogramm eine ungewöhnliche Vermischung: Das SFI verwaltet nicht nur die Zulassung der Bewerber*innen, sondern organisiert und finanziert auch einige der Kurse. Die Doktortitel werden dann aber von den Universitäten vergeben.
Von den 75 Professor*innen, die das SFI als „Fakultätsmitglieder” zählt, besetzen momentan 25 einen SFI-Lehrstuhl – es sind ausschliesslich Männer. Sie gehören zu den Auserwählten, die das SFI mit einem Bonus von 50‘000 Franken pro Jahr fördert – zusätzlich zu ihrem durchschnittlichen universitären Gehalt von rund 210‘000 Franken pro Jahr. „Während das Salär von den Universitäten ausgerichtet wird und auch deren normalen Gehaltsbestimmungen unterliegt, sorgt die SFI-Stiftung für eine Aufstockung der Ressourcen”, heisst es im Beschluss des Universitätsrates der UZH aus dem Jahr 2006, der die Zusammenarbeit mit dem SFI genehmigte. Es handelt sich also um eine Gehaltserhöhung.
Beträchtliche Zusatzverdienste
Die 50 „SFI-Fakultätsmitglieder” ohne Lehrstuhl können sich wie die SFI-Lehrstühle um einen sogenannten „Knowledge Exchange Contract” bewerben und damit auch 50‘000 Franken jährlich verdienen. Dafür müssen sie mindestens einmal pro Jahr zum Beispiel ein zweistündiges Seminar für geladene Führungskräfte von Finanzinstituten oder eine vierstündige „Masterclass” für Bankenfachleute halten, oder eine „Public Discussion Note”, also ein kurzes Statement zu einer öffentlichen Diskussion, verfassen.
Jedes Jahr engagiert das SFI rund 15 Professoren mit dem Ziel, so den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu fördern – in den letzten Jahren waren es auch hier ausschliesslich Männer. Bankfachkräfte können beispielsweise im Renaissance Tower Hotel in Zürich oder im Hotel Bellevue in Bern gratis die SFI-Masterclasses besuchen.
Am Department of Finance sind im Frühjahrssemester 2024 von den insgesamt 48 Kursen nur sechs nicht von einem SFI-affiliierten Professor oder seinen Doktorierenden unterrichtet worden.
Das SFI vergibt so auch Forschungsaufträge: Mit dem Global Financial Regulation, Transparency, and Compliance Index haben beispielsweise Steven Ongena und Christoph Basten von der Universität Zürich zusammen mit Forschenden vom SFI ein Ranking entwickelt, das Länder danach einstuft, inwieweit sie globale Finanzstandards anwenden. Die Schweiz belegt in diesem jährlich aktualisierten Index immer einen der ersten Plätze.
Wenn die SFI-Lehrstühle zusätzlich einen „Knowledge Exchange Contract” vereinbaren, wie es bei vier Professoren an der UZH der Fall ist, erhalten sie insgesamt sogar 100‘000 Franken pro Jahr. Doch wer bestimmt, wer gefördert wird? Und welches Wissen vermitteln die Forschenden ihren Studierenden?
SFI-Expansion an der Universität Zürich
Finanziert wird das Swiss Finance Institute grösstenteils durch die Mitgliedsinstitute der Schweizer Bankiervereinigung (SBVg), dem Dachverband fast aller Schweizer Banken und ausländischen Banken mit Sitz in der Schweiz. Die Banken seien „grundsätzlich proportional zu ihrer Grösse” beteiligt, wie Markus Bürgi sagt. Auch die SIX Group, die Schweizer Börse, trage einen entscheidenden Teil zur Stiftung bei. Mehr Details zur Finanzierung will Markus Bürgi aus der SFI-Geschäftsleitung nicht bekannt geben.
Bei ihrer Gründung im Jahr 2005 verfügte die Stiftung über ein Kapital von 75 Millionen Franken. Damals hat die SBVg drei bereits bestehende Stiftungen fusioniert. Im Jahr 2006 kamen dann die Universitäten als Partner dazu.
Laut dem ersten Vertragsdokument verpflichtete sich die UZH einerseits dazu, in den kommenden Jahren sechs SFI-Lehrstühle einzurichten. Andererseits willigte sie dazu ein, die sieben bestehenden Lehrstühle der Finanzwissenschaften, wenn sie durch Pensionierung oder Kündigung frei werden, mit Personen zu ersetzen, die sich für einen SFI-Lehrstuhl qualifizieren.
Diese Erwartungen hat die UZH erfüllt: Das Department of Finance ist in den letzten knapp 20 Jahren auf mehr als das Doppelte gewachsen, es verfügt heute über sechs SFI-Lehrstühle, und 13 der 19 Finanzprofessor*innen sind dem SFI als Mitglieder angeschlossen.
Was ausserdem aus den Verträgen hervorgeht: Das SFI finanziert an der UZH das Grundgehalt zweier Lehrstühle mit jährlich je 250‘000 Schweizer Franken.
SFI-Lehrstuhl: Professor*innen, die die SFI-Kriterien für „wissenschaftliche Exzellenz” erfüllen. Sie erhalten vom SFI 50’000 Franken pro Jahr und können sich um einen „Knowledge Exchange Contract” bewerben, der ihnen weitere 50’000 Franken pro Jahr einbringt.
SFI-Fakultätsmitglieder: Professor*innen, die beim SFI affiliiert sind. Sie können jährlich 2’000 Franken „individuelles Forschungsbudget” beim SFI beantragen und sich um einen „Knowledge Exchange Contract” bewerben und damit 50’000 Franken pro Jahr erhalten.
An der UZH bezahlt das SFI zudem das Grundgehalt von zwei SFI-Lehrstühlen im Umfang mit je 250’000 Franken pro Jahr. Aktuell betrifft dies die Professoren Felix Kübler und Zacharias Sautner.
Das prägt die Lehre und Forschung nachhaltig: Am Department of Finance sind im Frühjahrssemester 2024 von den insgesamt 48 Kursen für die Studierenden nur sechs Kurse nicht von einem SFI-affiliierten Professor oder seinen Doktorierenden unterrichtet worden.
Professor*innen im Bereich Banking und Finance können auf eigenen Wunsch hin den niederschwelligen Status als „SFI-Fakultätsmitglied” erlangen – sie müssen dafür nur ein Dokument zur Forschungsintegrität und Interessenkonflikten unterzeichnen. Die Frage drängt sich also auf: Unter welchen Bedingungen können Professor*innen einen SFI-Lehrstuhl und somit die 50‘000 Franken erhalten?
Zeitschriftenbasierte Kriterien und „good citizenship with SFI”
Die Auflagen sind vielfältig, wie ein Mustervertrag für einen SFI-Lehrstuhl zeigt: So müssen SFI-Lehrstühle dem Institutsdirektor jährlich über ihre forschungsrelevanten Aktivitäten Bericht erstatten und bei Publikationen oder Vorträgen ihre Zugehörigkeit zum SFI an erster oder zweiter Stelle erwähnen. Sie müssen für die SFI Research Paper Series schreiben und aktiv dazu beitragen, herausragende Talente an ihre Universität zu rekrutieren. Zudem evaluiert das SFI alle fünf Jahre die „wissenschaftliche Exzellenz” ihrer Lehrstuhl-Inhaber*innen und entscheidet, ob sie weiterhin ihren Bonus erhalten.
Gemäss dem Gründungsvertrag von 2006 sowie späteren Verträgen legt die Kriterien für eine SFI-würdige Exzellenz massgeblich der SFI-Stiftungsrat fest. Von den 14 Mitgliedern vertreten vier die Universitäten, die übrigen die Interessen der Banken. Darunter sind etwa Stefan Seiler von der UBS, Jochen Dürr von der Six Group oder Stephan Zwahlen von der Vereinigung Schweizerischer Vermögensverwaltungsbanken – Leute aus der Konzernleitung der Finanzinstitutionen.
Beraten wird der Stiftungsrat von einem wissenschaftlichen Beirat, der sich aus international renommierten Finanzwissenschaftler*innen zusammensetzt. Dieser orientiert sich bei seiner Bewertung der Akademiker*innen an sogenannten Top-Journals der Finanz- und Wirtschaftswissenschaften – dazu gehören beispielsweise das Journal of Finance oder das Journal of Financial Economics. Wer einen SFI-Lehrstuhl erhalten will, muss mindestens vier Publikationen in den vorgegebenen Journals während der letzten sechs Jahre ausweisen.
„Es handelt sich um legale Anreizstrukturen, die jedoch zu ideologischen Leitplanken werden können.”
Wirtschaftsprofessor, anonym
Ein Wirtschaftsprofessor an einer Schweizer Universität, der in diesem Artikel anonym bleiben möchte, sieht diese Bewertungsmethode kritisch: „Karriere beim SFI zu machen, ist nur möglich, wenn man die klassischen Mainstream-Positionen dieser Fachzeitschriften vertritt”. Damit meint er die neo-klassische Finanzmarkttheorie, in der es Themen wie die UN-Nachhaltigkeitsziele, kritische Finanzwissenschaft oder plurale Ökonomien traditionell schwer haben. „Es handelt sich um legale Anreizstrukturen, die jedoch zu ideologischen Leitplanken werden können”, kritisiert der Wirtschaftsprofessor die Praxis des SFI.
Zeitschriftenbasierte Kriterien – also die Anzahl Publikationen, Ansehen der Fachzeitschriften und Anzahl Zitationen – gelten unter anderem als problematisch, da sie das Forschungsverhalten negativ beeinflussen können: Forschende setzten eher auf Themen, die die hochrangigen Zeitschriften bevorzugen, meiden interdisziplinäre Ansätze oder wenden strategisches Zitieren an. Universitäten weltweit geben deshalb Gegensteuer, etwa mit den DORA-Richtlinien, die von zeitschriftenbasierten Kriterien abraten.
Die Universität Zürich, der das Department of Finance angehört, orientiert sich seit dem Jahr 2014 an diesen Richtlinien, im Gegensatz zum SFI, das sie erst im Mai 2023 in ihre Berufungs-Guidelines aufgenommen hat.
Ein SFI-internes Dokument vom September 2021, das die Kriterien für einen SFI-Lehrstuhl festhält, priorisiert die zeitschriftenbasierten Indikatoren, berücksichtigt aber auch Aspekte wie „internationales Ansehen” oder Einladungen zu Konferenzen. Bewerber*innen zu beurteilen, sei ein „subjektiver und diskretionärer Prozess, der sich nicht auf eine Reihe quantitativer Kriterien reduzieren lässt”, steht im Dokument. Zudem heisst es da: Wer sich für einen SFI-Lehrstuhl bewirbt oder seine Position erneuert haben will, sollte eine „history of good citizenship with SFI” aufweisen. Lässt sich diese etwa auch während Anlässen wie dem „Sparkling Wine-Tasting Event” oder der „Golf Trophy” erwerben, die laut Jahresbericht regelmässig stattfinden?
Mit seinen Vorgaben, in welchen Fachzeitschriften Professor*innen publizieren müssen, gibt das SFI einerseits bestimmte Forschungspositionen vor. Andererseits zählt ein diffuses Kriterium wie die „gute Mitgliedschaft”. Doch wozu das alles?
Komplexe Finanzprodukte vor Gemeinwohl, Neutralität vor öffentlicher Debatte
„Als Banken in den 80er-Jahren begannen, auf strukturierte Finanzprodukte zu setzen – also auf hochkomplexe Anlagen, mit denen spekuliert wird – verlangte das vermehrt Wissen aus der Mathematik und Informatik”, sagt Beat Bürgenmeier. Der emeritierte Professor amtierte als Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Genf, wo er das Lobbying der Banken direkt mitbekam.
„So wurde mit der Zeit zum Beispiel Wirtschaftsgeschichte immer weniger unterrichtet, weil dies nicht direkt nützlich ist für die Banken”, sagt er am Telefon. Dass der enge Fokus auf die Funktionsweise von Finanzprodukten für die Gesellschaft eine Gefahr darstelle, hätten jedoch die Bankenkrisen gezeigt. „Die Forschung an der Uni müsste stattdessen Vorschläge bringen, wie der Finanzsektor insgesamt besser organisiert werden könnte”, sagt Bürgenmeier.
Marc Chesney, erst vor kurzem emeritierter Professor am Department of Finance an der UZH hat klare Worte. In le temps problematisierte er kürzlich „eine kognitive Vereinnahmung dieser akademischen Welt, die sich den Ansichten und Interessen grosser Finanzinstitutionen anpasst”. Die universitären Finanzexpert*innen hätten beispielsweise zum CS-Crash Stellung beziehen sollen, findet Chesney.
Eine Suche in der Schweizer Mediendatenbank hat ergeben, dass sich von den SFI-Lehrstühlen in den letzten zwei Jahren tatsächlich kaum jemand zur CS-Übernahme durch die UBS geäussert hat.
Steven Ongena, der beim SFI einen Lehrstuhl innehat, kann sich das erklären: „Forschung hört an einem bestimmten Punkt auf und wird dann von politischen Entscheidungsträgern übernommen”, sagt er in seinem mit Pflanzen bestückten Büro am Department of Finance an der UZH. „Warum sollte ich Ihnen meine Meinung über die UBS und CS sagen?” fragt er und sagt, dass Grundlagenforschung das eine sei, die Meinungsbildung über ein bestimmtes Ereignis etwas anderes.
Ongena gehört zu den drei von 24 kontaktierten SFI-Lehrstuhl-Inhabern, die sich bereit erklärten, ein paar Fragen zur CS/ UBS zu beantworten: Weshalb die Schweiz erneut mit Staatsgarantien eine Bank retten musste oder welche Risiken die neue UBS birgt. Ongena hat unter anderem dazu geforscht, wie sich höhere Eigenkapitalanforderungen auf Banken auswirken. Dazu publiziert er bald einen Bericht für das SFI, worin er den Stand der Forschung aufzeigt, aber ohne sich auf eine spezifische Bank zu beziehen. „Ob Banken mehr Eigenkapital haben sollen oder nicht, hängt davon ab, was die Politik und die Bevölkerung in Bezug auf Risiko und Ertrag anstreben”, sagt er.
Und ob die neue UBS nicht zu gross sei für die Schweiz? Der international renommierte Finanzprofessor verweist auf die hohen Standards der Neutralität, die für Forschende gelten: „Um ehrlich zu sein, da es sich auch um eine sehr komplizierte Angelegenheit handelt, denke ich, dass es in dieser ganzen Diskussion sogar etwas kontraproduktiv sein könnte, einen festen öffentlichen Standpunkt dazu einzunehmen.”
„Die meisten Finanzprofessoren, die sich über das SFI in den Dienst der Finanzbranche stellen, sind ihrer Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, nicht nachgekommen.”
Prof. em. Beat Bürgenmeier, Universität Genf
13 der Professoren, die vom SFI 50’000 Franken oder mehr pro Jahr erhalten, haben gar nicht auf die Anfrage zur UBS/CS reagiert, und acht erklärten, dass dieses Thema nicht ihre Expertise sei – obwohl das SFI bei manchen von ihnen „Systemrisiken und Regulierung” als Fachwissen angibt.
Es ist nachvollziehbar, wenn Professor*innen nicht öffentlich zu Fragen Stellung nehmen wollen, die sie als ausserhalb ihrer Expertise betrachten. Doch es ist bemerkenswert, dass sich von den 24 führenden Finanzprofessoren der Schweiz kaum jemand zu einem Thema positioniert, das von absolut strategischer Bedeutung für das Land, die Politik und die Bevölkerung ist. Nimmt diese Art von universitärer Forschung ihren gesellschaftlichen Auftrag wahr?
„Die meisten Finanzprofessoren, die sich über das SFI in den Dienst der Finanzbranche stellen, sind ihrer Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, nicht nachgekommen”, sagt Professor Beat Bürgenmeier von der Universität Genf. „Dazu zu schweigen oder nicht öffentlich Kritik zu äussern, wie der Finanzsektor funktioniert, ist aus meiner Sicht ein Symptom davon, dass Abhängigkeiten bestehen.”
An der Uni vorbeimanövriert
Im Minimum sollten solche Abhängigkeiten transparent gemacht werden, indem die Universitäten ihre Geldquellen deklarieren. Wer auf der Website der Universität Zürich nach Hinweisen auf Finanzierungen des SFI sucht, wird jedoch nur teilweise fündig.
Die Transparenzliste der Drittmittel führt auf, dass das SFI dem Geschäftsführer des Department of Finance, Eckart Jäger, 4 Millionen Franken für die Jahre 2021 bis 2028 zugesprochen hat. Das entspricht den Lohnkosten der zwei Lehrstühle, die das SFI mit jährlich je 250‘000 Franken an der UZH finanziert. An welche Lehrstühle dieses Geld fliesst, verrät die Liste aber nicht.
Unter dem Register der Interessenbindungen von Professor*innen wird Christian Schwarzenegger in Verbindung mit dem SFI aufgeführt: Er vertritt die UZH als Prorektor im Stiftungsrat des SFI.
Aber weder die Drittmittelliste noch die Liste der Interessenbindungen führt die Boni und Zusatzverdienste der SFI-Professoren auf. Wer diese Entschädigungen erhält, ist auch der Liste der Stiftungsprofessuren der Universität Zürich nicht zu entnehmen – obschon das Grundgehalt von zwei Lehrstühlen ja vollständig vom SFI finanziert wird. Die Gelder für die Zusatzverdienste, so teilt die Pressestelle der UZH mit, liessen sich keiner der Transparenz-Kategorien zuteilen, da es sich um eine Auszeichnung für wissenschaftliche Exzellenz handle. Stattdessen werden die Bezahlungen administrativ als Nebenbeschäftigungen betrachtet.
Das heisst: Das SFI schliesst mit den Professor*innen Arbeitsverträge ab und zahlt sie direkt. Als vermutlich nicht unwillkommener Nebeneffekt unterliegen diese Vereinbarungen deshalb dem Privatrecht und konnten für diese Recherche nicht eingesehen werden. Professor*innen müssen ihre Nebenbeschäftigungen zwar melden, aber die UZH listet diese nicht öffentlich auf.
Indem sie die Gehaltserhöhungen als Nebenbeschäftigungen an der Anstellung als Universitätsprofessor vorbeimanövriert, kann die UZH das Prinzip der Lohngleichheit umgehen: Die Löhne von Professor*innen an eidgenössischen und kantonalen Hochschulen sind relativ strikt über Lohnklassen reglementiert, und es gibt wenig Freiheiten, sie via Drittmittel aufzustocken – jedenfalls in der Theorie.
Und wie sieht es eigentlich mit Berufungen aus?
Berufungen, die sich an den Kriterien der Banken orientieren
„Das SFI hat keinerlei Mitsprache an der Berufung von Professor*innen an der UZH, diese obliegt einzig den universitären Gremien”, schreibt die Pressestelle der UZH auf Anfrage. Formell kann das SFI bei Berufungen also nicht mitbestimmen. Dennoch muss sich die UZH aber an den vom SFI vorgegeben „Exzellenz-Kriterien” orientieren. Sie hat sich schliesslich vor knapp 20 Jahren vertraglich dazu verpflichtet, Lehrstühle zu schaffen, deren Professor*innen auch die SFI-Kriterien erfüllen. Diese Kriterien sind deshalb auch allen Instanzen bekannt, die in die Berufungsprozesse involviert sind, wie die UZH schreibt.
Obwohl das SFI formell kein Mitspracherecht an Berufungen hat, verfügt es über mächtige finanzielle Hebel, um die Universitäten unter Druck zu setzen.
Wenn die Universität Zürich nicht auf die Gelder des SFI verzichten will, muss die Forschung der ernannten Professor*innen der von der Finanzlobby vorgegebenen Richtung entsprechen. Dies gilt insbesondere auch für die je 250’000 Franken Grundgehalt für die zwei Professuren, die das SFI jährlich an die UZH zahlt. „Diese Beiträge werden nur dann fällig, wenn die UZH eine neue unbefristete Professur für Sustainable Finance einrichtet, welche die Kriterien für einen SFI Senior Chair erfüllt”, heisst es in einem Vertrag aus dem Jahr 2020.
Obwohl das SFI formell kein Mitspracherecht an Berufungen hat, verfügt es über mächtige finanzielle Hebel, um die Universitäten unter Druck zu setzen und Anstellungen gemäss seinen eigenen Präferenzen zu erwirken.
Die UZH weist diese Schlussfolgerung zurück: Sie besetze ihre Professuren gemäss ihren eigenen wissenschaftlichen Exzellenzkriterien. Allerdings schreibt sie auch: „Die Beiträge seitens der Privatindustrie via SFI sind wesentlich, um die besten Finanzforschenden an die Hochschulen in der Schweiz berufen und dort halten zu können.”
Akademisches Boni-System zum Wohle der Banken
Forschungsansätze, die die neoklassische Volkswirtschaftslehre infrage stellen und nachhaltigere Finanzmodelle entwickeln wollen, gäbe es schon lange. Laut Finanzprofessor*innen wie Anat Admati oder Marc Chesney dominieren in Hörsälen und akademischen Fachzeitschriften aber nach wie vor Tendenzen, die die Industrie begünstigen.
Statt die kritische Wissenschaft zu fördern und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, bevorzugen die Universitäten die finanziellen Zuwendungen und Prestige und passen ihre Forschung dabei den Interessen der Banken an. Es bleibt fraglich, für wen Professor*innen eigentlich primär forschen und publizieren, wenn ihr Einkommen sowohl mit öffentlichen Geldern als auch von der Finanzindustrie bezahlt wird.
Das SFI bestreitet, dass es Lehre und Forschung auch nur implizit beeinflusst und betont die Meinungsfreiheit ihrer Professor*innen. Die Stiftung verweist auf einen Meinungsartikel von SFI-Direktor François Degeorge in le temps, in dem er generell bestreitet, dass die Finanz- und Wirtschaftswissenschaften unter dem Monopol einseitiger oder interessengeleiteter Theorien leide.
Die UZH hebt hervor, dass ihre SFI-Lehrstuhl-Inhaber sehr wohl auch banken- und systemkritische Forschung betreiben und weist den Vorwurf zurück, dass die Gehaltserhöhungen einem akademischen Boni-System gleichen.
UBS-Chef Sergio Ermotti mag es jedenfalls freuen, wenn Banken nicht stärker reguliert werden, wie der SFI-Regulierungsindex implizit zu propagieren scheint. Oder wenn Forschende darauf verzichten, klare Eigenkapitalanforderungen an Banken zur Debatte zu stellen. Ermotti kam es wohl auch entgegen, dass die SFI-Finanzprofessor*innen schwiegen, als er auch im Jahr der staatlich unterstützten CS-Übernahme mehr als 14.4 Millionen Franken verdiente.
Niemand will Misstöne beim „Fireside Chat”.
Hinweis: In einer früheren Version gab es eine falsche Angabe zum Umgang mit den DORA-Richtlinien, da die Universität Zürich den Autor*innen ein veraltetes Dokument zugeschickt hat. Wir haben diese Passage nun korrigiert.
Eine längere Version dieser Recherche gibt’s bei der Republik zu lesen.
Sie wurde mit Unterstützung von JournaFONDS und investigativ.ch recherchiert und umgesetzt. Herzlichen Dank!


Hör dir den Podcast dazu an:
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 380 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 20’020 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 13’300 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 6’460 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?