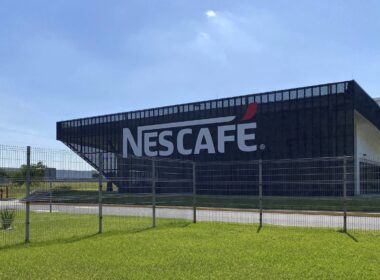Mitte März dieses Jahres kam mein Airbnb-Host in mein Zimmer und fragte mich peinlich berührt, ob ich nebst Nahrungsmitteln vielleicht auch Tampons bräuchte. „Die Quarantäne kann eventuell länger gehen und für alle gelten”, meinte er damals. Jetzt, mehr als hundert Tage später, ist mir bewusst, welches Glück ich gehabt habe, dass ich gerade bei diesem Host und seiner Familie gelandet bin.
Ende März. Die Pandemie beginnt, sich unaufhaltsam über die ganze Welt zu erstrecken. Trotzdem verzichte ich auf einen Rückflug in die Schweiz. Denn ich bin hierhin gekommen, um zu bleiben: um langfristig soziale und politische Bewegungen in Südamerika journalistisch zu begleiten.
Aber Corona hat auch mich ausser Gefecht gesetzt. Seit fast fünf Monaten beschränkt sich mein Leben auf ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus, zusammen mit 20 anderen Menschen. Der Hausflur ist jetzt unsere Stadt, eine soziale Begegnungszone, die ein bisschen Normalität versprüht und vieles erträglicher macht.
Neben der Familie des Hosts und ein paar venezolanischen Tourist*innen, die wegen der Grenzschliessung festsitzen, wohnen hier noch ein ungarischer Verschwörungstheoretiker sowie die Angestellten der Familie. Sie wurden kurzerhand einquartiert. Denn: Lockdown in Kolumbien bedeutet, eingesperrt zu sein. Und wer ausbricht, wird mit umgerechnet 250 Schweizer Franken gebüsst. Das entspricht einem durchschnittlichen Monatslohn.
Einen Tag in der Woche für Einkäufe
Hier in Santa Marta, einer Ortschaft an der Karibikküste Kolumbiens, gilt das Pico y Cédula: Anhand der Endziffer des Personalausweises wird den Bürger*innen ein Wochentag für Einkäufe zugeteilt, an denen sie das Haus verlassen dürfen. Die Nummern werden an den Eingängen der Einkaufszentren kontrolliert. Mein Tag ist der Montag. Aber im letzten Monat war an drei Montagen jeweils ein Feiertag. Als ich deshalb versuchte, am Dienstag darauf das Nötigste einzukaufen, wurde ich überall abgewiesen. Mein Recht auf den Einkauf war verfallen. Die lokalen Märkte in den ärmeren Viertel nehmen das nicht so genau, dort findet man allerdings nur eine beschränkte Anzahl Produkte.
Grundsätzlich gelten in Kolumbien nationale Bestimmungen zur Quarantäne, doch die Regent*innen der verschiedenen Departemente und Gemeinden haben einen gewissen Handlungsspielraum, wenn es um die Durchsetzung der Massnahmen geht. So liefern sich Präsident Iván Duque und Claudia López, die Bürgermeisterin Bogotas, seit Anfang der Quarantäne einen Schlagabtausch auf Twitter. Die eine Verwaltungsebene führt Massnahmen ein, die andere hebt sie wieder auf, und so weiter. Seit Juli gilt in Kolumbiens Hauptstadt alerta roja – Alarmstufe rot. Die Notfallstationen sind zu mehr als 89 % ausgelastet.
Epizentrum Karibik
Seit etwas mehr als einem Monat steigen die Zahlen rapide an. Kolumbien ist jetzt bei 400’000 Infizierten und konstant rund 10’000 Neuinfektionen pro Tag. Und das bei täglich etwa 30’000 Tests – man kann nur vermuten, wie hoch die Zahlen in Wirklichkeit sind. Laut WHO entfällt fast die Hälfte aller gemeldeten Infektionen und der rund 13’000 Corona-Toten Kolumbiens auf Santa Marta, Cartagena und Baranquilla, also auf Kolumbiens Karibikküste. Seit letzter Woche sind in Santa Marta die Spitäler voll. Ein schwerer Krankheitsverlauf ist für viele das Todesurteil.
Von Montag bis Freitag komme ich gut mit meiner Situation als Corona-Gefangene klar – Hausflur sei Dank. Natürlich habe ich meine schwachen Momente, in denen ich Leute auf Instagram stalke oder Geld für ein Handy-Game ausgebe. Ich kenne das lateinamerikanische Netflix-Programm auswendig (Ja, Dark auf Spanisch!). Am Wochenende, wenn plötzlich alles stillsteht und ich nicht in meinem Remote-Job arbeite, telefoniere ich mit meinen Schweizer Freundinnen und laufe sechs bis acht Kilometer – von Wand zu Wand. Aber das ist alles halb so wild. Ich habe genug zu essen, ein regelmässiges Einkommen und bin gesund.
Komplette Ausgangssperre für über 70-jährige
Schwieriger ist die Lage für die 72-jährige Señora, die im Haus lebt. Einmal pro Monat holt sie ihre Rente persönlich am Schalter der Banco Agrario ab. In Kolumbien sei das ein kultureller Brauch, erklärt man mir im Haus. Ältere Menschen würden diese Art der Auszahlung bevorzugen, weil sie unter anderem Missbräuche von Bankkarten befürchten. Doch oft finden sie sich dann in einer langen Schlange von mehreren Metern unter der karibischen Sonne wieder und verharren zwei Stunden vor dem Eingang.
Die Señora hat Glück. Sie kennt die Bankangestellten und darf im Auto warten, bis sie zu ihr ans Fenster kommen. Seit Beginn der Pandemie ist es über 70-jährigen nur erlaubt, an diesem einen Tag im Monat das Haus zu verlassen. Ansonsten sind sie komplett zuhause isoliert. „Ich habe grosse Angst vor einer Ansteckung”, sagt sie mir eines Tages, während ihres abendlichen Spaziergangs im Flur, als ich sie darauf anspreche.
Angst vor Überfällen
Vordergründig hat die Corona-Schockstarre für Kolumbien auch seine positiven Seiten. Ausser in Bogota, wo die Kriminalität seit Anfang dieses Jahres steigt, sind die Zahlen rückläufig. Das ist aber nur Statistik, die Unsicherheit im Land nimmt spürbar zu. Im Quartier herrscht eine grosse Angst davor, überfallen zu werden. In Bogota wurde Ende Juni, mit dem Vorwand einer Paketlieferung, ein ganzer Wohnungskomplex ausgeraubt. Kleinere Delikte werden meistens gar nicht erst angezeigt, weil das Raubgut sowieso weg ist. Die Kriminalitätsstatistik ist deshalb kaum repräsentativ. Treiber der Kriminalität ist die Armut. Ganz besonders jetzt: Die meisten Bewohner*innen Kolumbiens sind nur schlecht oder gar nicht versichert. Viele stehen vor dem Nichts.
José, ein Venezolaner, der im selben Haus wohnt, kennt die Leute im Quartier und erklärt mir unbeeindruckt: „Alles, was nicht angemacht ist, wird gestohlen, mit oder ohne Quarantäne.” Ein Beispiel: Drei Kilogramm Kabel werden auf dem Schwarzmarkt für umgerechnet etwa 16 Schweizer Franken gehandelt. Davon kann eine vierköpfige Familie hier an der Küste etwa zwei Wochen lang leben. „Gestern ist sogar der Eisendeckel des Senklochs um die Ecke geklaut worden, auch den kann man verkaufen”, erzählt mir José. Er patrouilliert jede Nacht mit einem Gewehr, um unser Haus zu bewachen. Schon mehrmals musste er es auf potenzielle Räuber richten, um sie zu verjagen. Wenn er mir das jeweils lachend erzählt, packt mich kurz Panik – alles scheint mir hier irgendwie unwirklich.
Coronavirus zerstört Existenzen
Dass die Familie vergleichsweise privilegiert ist, bedeutet nicht, dass der Lockdown nicht auch ihn in eine bedrohliche ökonomische Schieflage bringt. Ohne Touristen fällt sein Einkommen weg, während die Ausgaben gleichbleiben. So wie meinem Host geht es vielen in der Mittelschicht. Alle Bars und kleineren Läden in Santa Martas Altstadt gingen in den ersten Wochen des Lockdowns Konkurs. Die Inhaber konnten Miete, Strom und Wasser nicht bezahlen. Die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik der UNO schätzt, dass aufgrund der Pandemie rund 16 Millionen Menschen in die extreme Armut abrutschen und insgesamt rund 83.4 Millionen von Hunger bedroht sind. Täglich erreichen uns Geschichten von Freunden der Familie, die ihre Läden schliessen mussten.

Präsident Iván Duque kennt keine Gnade, wenn es um die Verlängerung des Lockdowns geht, obwohl dieser teils gravierende Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Rund 50 % der Bewohner*innen der Grossstädte Kolumbiens arbeiten im informellen Sektor, sie verkaufen beispielsweise Kaffee oder Avocados auf der Strasse – und leben von der Hand in den Mund.
Wenn sie während des Lockdowns versuchen, etwas zu verkaufen, werden sie gebüsst. In Santa Marta schaut die Polizei allerdings oft weg. Die Hilfe, die von der Regierung Duques im März versprochen wurde, ist nur teilweise oder nie bei den Bedürftigen angekommen. Viele der Betroffenen sind erst gar nicht bei den Subventionssystemen registriert. Seit Monaten schlägt das UN-Flüchtlingshilfswerk Alarm, Aufnahmeländer wie Kolumbien während der Pandemie nicht im Stich zu lassen. Seit Ausbruch der Krise in Venezuela sind rund 1.8 Millionen Venezolaner*innen nach Kolumbien migriert.
Wie immer trifft es die Ärmsten
Tausende von ihnen warten an Busbahnhöfen kolumbianischer Städte auf die Rückkehr in ihr Heimatland: Mehr als 60’000 sind bereits zurückgekehrt. Dort geht es ihnen zwar auch nicht viel besser, aber sie haben wenigstens ein soziales Netzwerk. In Santa Marta wurden die Menschen aus Venezuela während der Quarantäne in frei stehenden Häusern der Stadt untergebracht. Diese verfügen weder über sanitäre Anlagen noch Strom. Zum Teil wohnen bis zu 15 Personen auf engstem Raum – seit fast fünf Monaten.
Private lokale Organisationen und Verbände haben zu Nahrungsspenden aufgerufen. Diese werden an die Bedürftigen verteilt. Auch meine „Gastfamilie” engagiert sich sozial, und auch aus dem Ausland erreichen private Spenden das Land. Aber weil der Lockdown schon so lange dauert, ist das nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Situation wird von Tag zu Tag prekärer.
In Kolumbien signalisiert ein rotes Tuch, das aus dem Fenster gehängt wird, dass ein Haushalt Hunger leidet. In den ärmeren Gegenden ist fast jedes Haus rot behängt. Die Situation, die sich mir offenbart, wenn wir auf Spendentour gehen, ist beklemmend.
Immerhin: Die sozialen Netzwerke in Kolumbien funktionieren gut. „Die Leute organisieren sich, hier wird niemand verhungern”, sagt mir mein Host. Doch die Leute leiden unter der ständigen Verlängerung der Quarantäne, und Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder haben drastisch zugenommen.
Präsident Duque meinte in einem Interview zur schrittweisen Reaktivierung der Wirtschaft, „dass wir jetzt mit dem Virus leben lernen müssen”, da hier die erste Welle ewig zu sein scheint, die Infektionszahlen nicht sinken, aber der Lockdown nicht ewig weitergehen kann. Aber wie soll in einem Staat mit OECD-Durchschnitt von 1,7 Krankenhausbetten pro 1’000 Einwohner*innen das Leben weitergehen? Und auch wenn sie tatsächlich einen Platz erhielten, könnten sich die meisten Bewohner*innen Kolumbiens einen Spitalaufenthalt nicht leisten. Die drei von Papst Franziskus gespendeten Beatmungsgeräte werden kaum ausreichen, um im Ernstfall 50 Millionen Menschen zu versorgen.
„Steck Dich bloss nicht an”
Die Situation scheint ausweglos. Und das gilt mehr oder weniger für ganz Lateinamerika sowie für alle anderen Länder, die nicht über einen europäischen OECD-Gesundheitsstandart verfügen. Es gilt hier bis auf Weiteres bloss eines: „Steck Dich bloss nicht an!” Das gilt auch für mich; ich habe Asthma. Wenn ich einkaufe, wasche ich alles mit Seife und ziehe danach meine Kleidung im Gang aus.
Langsam und schmerzhaft wird uns bewusst, dass die Pandemie auf der Südhalbkugel vielleicht nie wirklich ein Ende finden wird. Täglich erinnere ich mich daran, wie das Lachen und die Musikant*innen im März vom einen auf den anderen Tag von den Strassen Santa Martas verschwanden – und nur das Bellen der Strassenhunde übrig blieb.
Wenn mich mein Host komisch ansieht und wieder einmal fragt, wieso ich überhaupt noch hier bin, weiss ich manchmal nicht, was ich ihm antworten soll. Ich verfüge in dieser Situation über andere Möglichkeiten als er, weil mein Pass eine andere Farbe hat als seiner. Ein ungutes Gefühl, das mich hier jeden Tag begleitet.
Aber bereut habe ich es kein einziges Mal, mich für diese Realität entschieden zu haben. Auch wenn ich seit vier Monaten eingesperrt bin. Ich habe viel gelernt, was ich, wie so viele Leute, verlernt hatte. Zum Beispiel: eine Situation einfach auszuhalten. Denn weiter geht es immer. Die Frage ist nur wie.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 32 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1924 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1120 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 544 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?