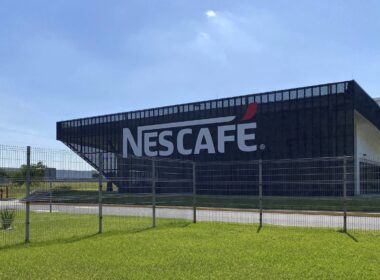Grüne Streifen am Horizont. An den Berghängen in der Region Valparaíso, rund eine Stunde nördlich der Hauptstadt Santiago, wachsen seit den 90er-Jahren Avocados für den europäischen Markt. Die ursprüngliche Flora wird dafür plattgewalzt. Stattdessen entstehen in schier unendlich langen Ketten Avocadoplantagen, und jedes Jahr werden es mehr.
Bewässert werden die Plantagen durch Tröpfchenbewässerung. In kilometerlangen Schläuchen wird Wasser in die Berge gepumpt. Unten im Tal wird es derweil immer trockener: Die Quellen der lokalen Wasserversorgung sinken jährlich.
„In trockenen Jahren bekommen wir einfachen Bauern praktisch kein Wasser mehr für unsere Felder”, erzählt der Landwirt Marcelo Díaz. 2014 kämpfte er gegen die Ausbreitung der Avocadoplantagen, nachdem es im Winter jenes Jahres kaum mehr regnete. Damals breiteten sich die Plantagen massiv aus. Von Díaz’ Haus aus waren gerodete Wälder zu sehen. Hubschrauber flogen über die Felder, um grossflächig Pestizide zu spritzen.
Das Wasserproblem, das mit den gigantischen Avocado-Monokulturen einhergeht, ist mittlerweile gut bekannt. In deutschsprachigen Medien wurde in den letzten Jahren grossflächig darüber berichtet. Über andere Probleme, die der Anbau der Trend-Frucht mit sich bringt, wird hingegen kaum berichtet: Der massive Pestizideinsatz, die prekären Arbeitsbedingungen und die Tatsache, dass lokale Kritiker*innen physische Bedrohungen erfahren, haben im Zuge der massiven Ausbreitung der Avocadoplantagen das Leben der ansässigen Bevölkerung tiefgreifend verändert.
Die Letzten im Kampf
Harte Arbeit, miese Löhne und fehlende Sicherheitsbestimmungen veranlassten 2017 eine Gruppe von Arbeiter*innen in Llay-Llay eine Gewerkschaft zu gründen. „Zu Beginn hatten wir 150 Mitglieder”, erzählt Alberto Carrasco. „Doch dann wurden fast alle entlassen.” Die Verwaltung war mit der Gewerkschaft nicht einverstanden und entliess einen Grossteil der Mitglieder. Die Gewerkschaft holte Rechtshilfe und konnte so zumindest Abfindungen bewirken. Seitdem kämpft sie für das Mindeste. In verschiedenen Rechtsstreiten konnte bewirkt werden, dass fehlende Sozialbeiträge gezahlt wurden und sich die Arbeitsbedingungen leicht verbesserten.
Wir sind im Zentrum der Kleinstadt Llay-Llay, rund zwanzig Männer sitzen in einem Saal. Alle haben Hygienemasken an, ihre Gesichter und Hände bezeugen die Jahre der schweren Handarbeit unter der Sonne. Sie sind der harte Kern der bislang einzigen Gewerkschaft auf Avocadoplantagen in Chile.

Die Arbeit hat die Männer gezeichnet. Den ganzen Tag lang an steilen Hängen Avocados zu pflücken, ist schwierig und anstrengend. Sie alle leiden unter Rücken und Gelenkschmerzen. Bei der Ernte werden um die 30 kg schwere Körbe am Rücken getragen, mit denen hoch und runter gelaufen werden muss. Verletzungen werden nur zum Teil der Versicherung gemeldet, um so die Tarife gering zu halten. Auf den Feldern gibt es keine Hygieneanlagen, gegessen wird zwischen Rattengift und gespritzten Bäumen.
Nachdem die Arbeiter in die Gewerkschaft eingetreten sind, wurde ihnen verboten, bei der Ernte zu arbeiten. Angeblich, um ihre Gesundheit zu schützen. Doch sie vermuten hinter der Massnahme Repressalien. Bei der Ernte werden sie nach der geernteten Menge Avocados bezahlt. Je mehr geerntet wird, desto höher der Lohn. „Heute sind wir hauptsächlich für die Bewässerung zuständig. Das hat unseren Lohn mehr als halbiert”, meinen die Arbeiter einstimmig. Ein normaler Basislohn beträgt in den Avocadoplantagen um die 350 Franken. Während der Ernte können schnelle Pflücker*innen bis zu 1’000 Franken verdienen.
Nach der Ernte kommen die Avocados in riesige Verpackungsanlagen direkt neben den Feldern. Bis zu zwölf Stunden am Tag wird hier neben Maschinenlärm und unter ständigem Produktionsdruck gearbeitet. Arbeiter*innen, die sich 2017 der Gewerkschaft anschlossen und daraufhin entlassen wurden, erzählen von schlechter Behandlung durch die Vorgesetzten. „Wir wurden ständig angeschrien und beschimpft. Wer sich wehrte oder krank wurde, verlor den Job.” Während der Arbeitszeit hätten sie sich wie „Arbeitssklav*innen” gefühlt: „Sie herrschten über unsere Zeit.” Die Mittagspausen seien oft spontan gestrichen, die Arbeitszeit oft spontan um zwei oder drei Stunden verlängert worden. Widerspruch: zwecklos.
Marcela, eine ehemalige Arbeiterin, erinnert sich, dass eine Arbeitskollegin, dem Dauerdruck schutzlos ausgeliefert, im Stress mit der Hand in eine Maschine geriet. Diese musste darauf amputiert werden.
„Wir wurden schrecklich behandelt.” Jeden Tag machte man ihnen bewusst, dass man sie sofort auswechseln könne. „Die Chefin sagte mir immer wieder, es gäbe genügend Menschen, die einen Job bräuchten.” Ein anderer erzählt: „Bis heute kommen jeden Tag neue Arbeiter*innen, da die alten den Druck nicht mehr aushalten.”
Seit sich 2017 die Gewerkschaft gegründet hat, werden immer mehr Arbeiter*innen per Subunternehmen angestellt. Es handelt sich dabei meist um Besitzer von Kleinbussen, die mit den Unternehmen Verträge abschliessen. Die Konsequenzen sind fehlende Arbeitsverträge und Sicherheiten. Die Arbeiter*innen erzählen, dass Angestellte bei Subunternehmen tiefere Löhne haben, bei Unfällen ins öffentliche Spital verwiesen werden und bei Krankheit kein Anrecht auf Fortzahlung des Lohns haben – meist werden sie einfach entlassen. Für diese Arbeiter*innen ist es fast unmöglich, einer Gewerkschaft beizutreten.

Eine „grüne Wüste”
Auf seinem Telefon zeigt Bahamondes, der Präsident der Gewerkschaft, einen toten Fuchs. Die Arbeiter treibt der massenhafte Tod von Tieren auf den Plantagen um. Bei der Arbeit sehen sie vor allem tote Füchse, Eulen und Ratten. Alle völlig ausgetrocknet. Verantwortlich dafür machen sie den massen- und fehlerhaften Einsatz von Rattengift. Das Gift sollte eigentlich in lange, enge Plastikröhren gesteckt und auf den Feldern verteilt werden. Doch es wird häufig nicht richtig verlegt und nach Erreichen des Ablaufdatums auf dem Feld entsorgt.
„Avocadoplantagen sind grüne Wüsten”, sagte die Aktivistin Maria Elena Rozas. In Avocadoplantagen werden mindestens 15 verschiedene hochgiftige Pestizide eingesetzt. „Viele kommen aus der Europäischen Union und eines der am meisten eingesetzten von Syngenta aus der Schweiz”, erzählt Rozas. Gemeint ist Thiamethoxam, welches in der EU weitgehend verboten ist, in der Schweiz und Chile aber noch verwendet werden darf. Das Insektizid wird für das massive Bienensterben mitverantwortlich gemacht.
Rozas zählt weitere Pestizide auf: Neben dem bekannten Glyphosat nennt sie auch Chlorthalonil, welches ebenfalls von Syngenta vertrieben wird und in der Schweiz verboten ist. Dieses Fungizid ist krebserregend und wird zur Bekämpfung des Pilzbefalls der Avocadobäume eingesetzt. „Die Avocadoplantagen setzen einen Cocktail an Giften ein, die jegliche Biodiversität auslöschen”, so die Aktivistin. „Hier gibt es nichts mehr – ausser Avocadobäume.”

Gift aus der Luft
Aber nicht nur die Biodiversität wird durch das Gift ausgelöscht. „Diese Pestizide zerstören nicht nur Fauna und Flora”, sagt Rozas, „auch die lokale Bevölkerung wird vergiftet.” Besonders dann, wenn die Chemikalien per Hubschrauber und Drohnen gespritzt werden. Eigentlich müsste die lokale Bevölkerung dann jeweils vorgewarnt werden, damit sie sich nicht im Freiem aufhält, während die Gifte gespritzt werden.
Doch das wird sie nicht: Laut Aussagen von Nachbar*innen der Plantagen wurden sie tatsächlich noch nie vorgewarnt, bevor die toxischen Wirkstoffe über ihren Köpfen freigesetzt wurden. Nach mehrmaligem Protest haben sie zumindest erreicht, dass die Hubschrauber ihre Runden etwas weiter vom Dorf entfernt drehen.
Den Geografen Jean-Pierre Francois von der Universidad de Playa Ancha aus Valparaíso besorgt die derzeitige Entwicklung. „Wir haben Satellitenfotografien verglichen und beobachten ein ständiges Ausweiten der Avocadoplantagen.”
Auch ihn beschäftigen die gesundheitlichen Schäden für die Bevölkerung. „Es gibt wenige Studien zum Einsatz von Pestiziden auf Monokulturen”, sagt Francois. „Aber alle, die es gibt, sprechen dafür, dass die Pestizide das Risiko, an Krebs zu erkranken, massiv erhöhen und zu Unfruchtbarkeit führen.” Für die Studien wurden teilweise auch Schulkinder untersucht, die nie selber auf Plantagen waren. Und auch bei ihnen wurden extrem erhöhte Schadstoffwerte gefunden. „Der Einsatz von Pestiziden vergiftet ganze Landstriche”, sagt der Professor.
Auch das Grundwasser wird mit den toxischen Chemikalien kontaminiert. Dies beweist der Geologe Román Quiroz. Er hat die Messwerte von Natrium- und Chloridverbindungen in verschiedenen Trinkwasserquellen in Petorca, etwa eine halbe Stunde von Llay-Llay entfernt, gemessen. Petorca wurde weltweit bekannt, weil hier die Avocadoplantagen ganze Ortschaften ausgetrocknet haben. Die, die noch Wasser haben, weisen deutlich höhere Werte an Natriumionen vor. Während Chloridionen kaum vorhanden sind. Dies beweist, laut Quiróz, den Einfluss von Pestiziden. Dessen Einsatz fördert die Mengan an Natriumionen, verringert allerdings den Anteil an konservativen Chloridverbindungen. Leider werden keinen anderen chemischen Stoffe gemessen, sagt der Geologe. „Aber es lässt sich vermuten, dass auch Giftstoffe aus den Avocadoplantagen im Trinkwasser nachgewiesen werden können.“

Der Lokalbaron
Nachdem 2015 die Menschen kurzzeitig gegen die Avocadoplantagen auf die Strasse gegangen sind, kehrte zuletzt scheinbar über längere Zeit hinweg Ruhe ein. Jorge Schmidt, dem die meisten Avocadoplantagen in Llay-Llay gehören, hatte ein System von Zuckerbrot und Peitsche implementiert. Er finanzierte zum einen den Ausbau von Schulen, Strassen und Kirchen. Zum anderen sei er unerbittlich gegen seine Kritiker*innen vorgegangen, erzählt der zu Beginn des Texts erwähnte Landwirt Marcelo Díaz.
Díaz war lange Vorstandsmitglied einer lokalen Organisation zur Bewässerung der Felder – und öffentlicher Kritiker der Plantagen. Um ihn loszuwerden, habe Schmidt der lokalen Wasserorganisation angeboten, dringend benötigte Modernisierungen zu finanzieren. „Im Gegenzug stellte er eine einzige Forderung”, sagt Díaz. „Nämlich, dass ich aus dem Gremium austreten muss.”

Und das ist nur ein Beispiel. Als im Oktober 2019 das ganze Land von wochenlangen Protesten erschüttert wurde (das Lamm berichtete), fürchtete Schmidt, dass sich die Wut auch gegen ihn entladen würde. Die Lehrerin Alejandra war damals mit ihrer 15-jährigen Tochter unterwegs, um selbstgemachte Plakate aufzuhängen. „Wir verlangten ein Ende der Polizeigewalt und ein neues Rentensystem”, erzählt Alejandra.
Plötzlich hielt ein weisser Wagen neben ihr an. Im Wagen sass der Chef des Sicherheitsdienstes der Plantage. Er verlangte, dass sie die Plakate abnehme, und fragte mehrmals, ob sie etwas gegen die Avocadoplantagen habe. Als sich Alejandra weigerte, die Plakate abzunehmen, fuhr ein Pick-up auf. Muskulöse Männer entstiegen ihm und stellten sich als Angestellte von Herrn Schmidt vor. Sie behaupteten, sie seien ehemalige Soldaten und hätten das Recht, Waffen auf sich zu tragen. Schliesslich zeigten sie ihr mehrere Gewehre auf der Ladefläche des Pick-ups. „Das war ein klarer Versuch, mich und meine Tochter einzuschüchtern.” Die Mutter erzählt, sie habe von weiteren ähnlichen Vorfällen gehört, bei denen die Wächter sogar in die Luft geschossen hätten.
In den darauffolgenden Wochen sei das weisse Auto immer wieder vor Alejandras Haustür aufgetaucht. Ihre Tochter traute sich nicht mehr allein aus dem Haus. Alejandras Ehemann arbeitete zu diesem Zeitpunkt auf der Plantage. Er habe die Wächter auf die Vorkommnisse angesprochen – und sei sofort entlassen worden, erzählt die Lehrerin. „Das wird allen passieren, die uns kritisieren”, habe der Chef des Sicherheitsdiensts wenig später in einer Mitarbeiter*innen-Versammlung angekündigt.
Unsere Kontaktversuche über die offizielle Webseite von Jorge Schmidt waren leider nicht erfolgreich, weder per E‑Mail noch per Telefon. Der Plantagenbesitzer bewirbt dort angeblich sozial verträgliche Arbeitsbedingungen, die Unterstützung von Fussballclubs und öffentlichen Schulen sowie den geringen Wasserverbrauch aufgrund der Tröpfchenbewasserung. Die „guten Praktiken” lässt er sich international zertifizieren. Bei einer Nachfrage bei Sedex, die laut der Homepage die guten Arbeitsbedingungen zertifiziert, konnte die Zertifizierung nicht bestätigt werden. Es wurde sogar unterstrichen, dass Sedex keine Zertifikate ausgibt.
Mächtige Verbündete
November 2019, im Club de La Unión, dem Restaurant für Llay-Llays lokale Elite. Von der sozialen Revolte aufgeschreckt versammeln sich der nationale Landwirtschaftsminister, mehrere Vorsitzende von Lokalbehörden und die Avocado-Barone der Region, unter ihnen Jorge Schmidt. Vor dem Restaurant haben sich Marinesoldaten in Kampfformation positioniert, um gemeinsam mit der Polizei eine wütende Menge davon abzuhalten, das Restaurant zu stürmen.

Das Treffen belegt die hervorragenden Verbindungen der Plantagenbesitzer zu höchsten Ebenen der Regierung. Sie erhalten Subventionen für die Installation der künstlichen Bewässerung und geniessen das Privileg, weitgehend von staatlichen Kontrollen der Bedingungen auf ihren Plantagen befreit zu sein. In der Provinz von San Felipe, in der Llay-Llay liegt, gibt es etwa nur 150 Prozentstellen zur staatlichen Kontrolle der Arbeitsbedingungen.
Der Kampf gegen die Avocado-Barone wird sich deshalb auf nationaler Ebene entscheiden müssen. Diesen Oktober wird in Chile über eine Totalrevision der Verfassung abgestimmt. Für viele ein Hoffnungsschimmer im Widerstand gegen die Zerstörung von Mensch und Natur. Und damit auch gegen die Riesenplantagen – und ihre Arbeitsplätze. Das weiss auch Gewerkschafter Alberto Carrasco. Natürlich mache er sich Sorgen. „Aber wir müssen auch die Qualität der Arbeitsplätze anschauen”, sagt er. „Und die ist das Allerletzte.”
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 23 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1456 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 805 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 391 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?