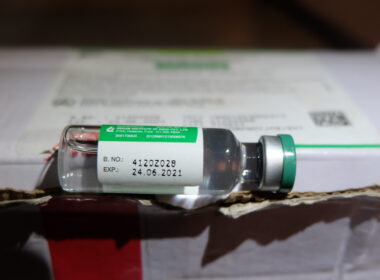Die zweite Welle der Pandemie habe die Schweiz „grad e chli verwütscht”, plauderte Ueli Maurer kürzlich in einem bundesrätlichen Video in die Kamera. Offenbar war die Regierung davon überrascht worden, dass die Fallzahlen zu Beginn der kalten Jahreszeit explodierten. Dabei hatten Epidemiolog:innen längst auf deren exponentielle Zunahme hingewiesen. Hören mochte das kaum jemand, zu sehr hatten sommerliche Temperaturen und Containment den Anschein von Normalität in die aufgescheuchte Schweiz zurückgebracht.
Auch in wirtschaftlichen Fragen ist eine ähnliche Verdrängungsleistung zu beobachten: Während in der Schweiz aber epidemiologisch längst wieder die Notlage herrscht, wähnt man sich volkswirtschaftlich noch beinahe in der warmen Jahreszeit. Derzeit dürften jene Ökonom:innen, die Vorhersagen treffen, mit dem Rotstift über ihren Büchern und Modellen brüten. Sie hatten in ihren Prognosen verhältnismässig rosige Basisszenarien gemalt, in denen keine zweite Welle durch die Schweiz rollt. Noch Ende Oktober zitierte die Nachrichtenagentur sda die Chefin von Adecco Schweiz: Es sei im Schweizer Arbeitsmarkt keine Krise zu befürchten.
Der Begriff der Krise ist umkämpft. Sein Einsatz wird von politischen Akteur:innen behutsam abgewogen. Ueli Maurer etwa wollte ihn an der Krisen-Pressekonferenz Anfang November partout nicht in den Mund nehmen. Mit dem schillernden Ausdruck droht man Konsument:innen zu verängstigen und politische Koordinaten zu verschieben: Politische Massnahmen werden plötzlich denkbar, die zuvor ausgeschlossen waren. Wenn die Wirtschaft eines Landes aber um über fünf Prozent schrumpft, dann muss man von einer Krise sprechen. Und genau das sagt der Internationale Währungsfonds (IWF) der Schweiz für dieses Jahr voraus.
Der wirtschaftliche Einbruch ist ein ungleichförmiger Prozess. Er ruiniert die einen, während bei anderen die Kassen klingeln. Amazon-Chef Jeff Bezos zählt seine Milliarden, während Besitzer:innen von Restaurants und Hotels den Medien ihre Misere klagen. Doch wie steht es um jene, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind und die sich kaum öffentlich zu Wort melden können?
„Für Hilfskräfte in der Gastronomie ist die Lage dramatisch”
„Wir beobachten schon seit Wochen, dass deutlich mehr Menschen Unterstützung benötigen als im Sommer. Derzeit sehen wir uns einer regelrechten Flut von Hilfesuchenden gegenüber, die sich für staatliche Leistungen anmelden wollen.” Das sagt Fabio Weiler, Co-Leiter des Kafi Klick im Gespräch mit das Lamm. Das Internet-Café unterstützt armutsbetroffene Menschen in der Stadt Zürich, besonders jene, die keinen Computer besitzen, um Formulare und Anträge auszufüllen.
Zusätzlich zur üblichen Bürokratie seien die Menschen in Not während der Pandemie auch auf hohe digitale Hürden gestossen, sagt Weiler. Bei der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilfe (UFS) beobachtet man derweil keine Zunahme der Anfragen, wie Geschäftsleiter Andreas Hediger erklärt. Man erhalte aber auch in normalen Zeiten mehr Gesuche für rechtliche Unterstützung, als man bewältigen könne.
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) hat im Frühling einen leichten Anstieg der Anmeldungen registriert. Über den Sommer seien sie aber wieder auf das durchschnittliche Niveau zurückgegangen. Ende September – also bevor die Covid-Fallzahlen explodierten – schrieb die SKOS, dass dieser Rückgang vermutlich auf Arbeitslosenversicherung, Kurzarbeitsmassnahmen und Erwerbsersatz zurückzuführen sei. Eine Prognose sei derzeit sehr schwierig, da die Entwicklung von den weiteren staatlichen Reaktionen abhänge, erklärt SKOS-Sprecherin Ingrid Hess nun auf Anfrage. Derzeit geht man beim Fachverband davon aus, dass bis 2022 etwa 28 Prozent mehr Menschen Sozialhilfe beziehen müssen.
Detailliert dokumentiert ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Das Bundesamt für Statistik (BFS) weist für das dritte Quartal 2020 rund 260’000 Erwerbslose aus, das sind 35’000 mehr als im Vorjahr. Diese Zahl sei in der aktuellen Situation aber ein unzuverlässiger Indikator für die Entwicklung, sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB).
„Wir verzeichnen deutlich mehr Stellensuchende als Anfang Jahr”, so Lampart gegenüber das Lamm. Dazu komme die immense Anzahl an Arbeitenden in Kurzarbeit. „Derzeit deuten nicht nur die Indikatoren auf eine Verschärfung hin, wir kriegen auch entsprechende Meldungen von unseren Mitgliedern”, sagt der SGB-Ökonom.
Dies bestätigt auch ein Monitoring der Jobvermittlungsplattform der Regionalen Arbeitsämter (RAV): Die Anzahl der Stellensuchenden schoss ab Mitte März regelrecht in die Höhe. Im Sommer stabilisierte sich die Lage auf hohem Niveau, um dann im Herbst erneut anzuziehen. Das BFS zählte im Oktober über 241’000 Stellensuchende – über ein Drittel mehr als im Vormonat. Und dies, während gleichzeitig die offenen Stellen stark rückläufig sind.
Das Team des Kafi Klick helfe derzeit bis zu zehn Arbeitssuchenden, sich auf dieselbe Stelle zu bewerben, sagt Co-Leiter Weiler. Besonders dramatisch sei die Situation für ungelernte Hilfskräfte in der Gastronomie. Aber auch in der Reinigung und in Teilen des Baugewerbes präsentiere sich die Lage für wenig qualifizierte Arbeiter:innen düster.
Als hätte man in der Schweiz zehn Wochen nicht gearbeitet
Wie hart die Pandemie den Arbeitsmarkt tatsächlich getroffen hat, zeigen Zahlen der International Labour Organization (ILO). Laut deren Covid-Monitor sind im zweiten Quartal 2020 weltweit über 17 Prozent aller Arbeitsstunden weggefallen. Auf Anfrage liefert die UNO-Sonderorganisation auch Zahlen zur Schweiz: In den ersten neun Monaten sind demnach Arbeitsstunden von umgerechnet 770’000 Vollzeit-Arbeitsplätzen weniger geleistet worden als im Vorjahr.
Die Schweiz zählt rund fünf Millionen Beschäftigte, die sich umgerechnet nicht ganz vier Millionen Vollzeitstellen teilen. Die Pandemie hatte also denselben Effekt, wie wenn sämtliche Lohnabhängigen in der Schweiz für zehn Wochen nicht gearbeitet hätten. Oder wie wenn kein Arbeitsplatz existiert hätte. Dazu zählen die verlorenen Stunden wegen Arbeitslosigkeit, aber auch wegen Kurzarbeit.
Die gesellschaftlichen Auswirkungen wären deutlich dramatischer ausgefallen, hätte der Staat den Einbruch nicht mit erweiterter Kurzarbeitsentschädigung aufgefangen. Damit wurden vorerst viele Entlassungen verhindert. Bislang sind laut Oliver Schärli vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 8.3 Milliarden Franken dafür aufgewendet worden. Während der härtesten Phase im Frühling kostete die Massnahme täglich 100 Millionen Franken, derzeit sind es rund 20 Millionen. „Aber wir verzeichnen wieder eine Zunahme von Anträgen”, erklärte Schärli Anfang November vor der Presse.
Die staatlichen Massnahmen vom Frühling sind beispiellos. Neben der Ausweitung von Kurzarbeit wurde auch der Zugang zu Krediten erleichtert und Betreibungen sistiert. Das gesamte Paket beläuft sich auf rund 70 Milliarden Franken – rund zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der Schweiz. Der Absturz der Ökonomie konnte so ausgebremst, eine Entlassungswelle abgeflacht werden. Der IWF sah im Oktober – noch vor der zweiten Welle – dennoch einen Wirtschaftseinbruch von minus 5.3 Prozent voraus, der stärkste Einbruch seit Dekaden.
Mit dem staatlichen Paket vom Frühling waren auch viele Firmenpleiten aufgeschoben worden. Darum blieben zum Beispiel die Konkursmeldungen im Kanton Zürich deutlich hinter den letzten drei Jahren zurück. Das ändert sich aber gerade: Vor einigen Tagen teilten die Konjunkturforscher:innen der KOF mit, dass die Anzahl der Konkurse im Kanton Zürich und in der Nordwestschweiz über den Normalbereich hinausgeschossen seien. Dabei sind die meisten staatlichen Massnahmen noch nicht sehr lange ausgelaufen.
Das liberale Dogma vom Sparen
Ob der Staat nun wieder im selben Masse interveniert, ist mehr als fraglich. Die Kulanz der ersten Welle ist vorbei, mittlerweile wird über Hilfsmassnahmen hitzig debattiert. Die vereinfachte Kreditvergabe lief im Juli aus, und statt sie zu erneuern, wird über sogenannte Härtefallregelungen gestritten: die Rettung von bedrohten Firmen nach Einzelfallprüfung, also keine breite Stützung wie im Frühling. Offenbar dreht das Spargetriebe im politischen Räderwerk. Das alte Dogma der Neoliberalen: bloss kein staatliches Geld ausgeben! Die dadurch verursachten Schäden werden als „Strukturbereinigung” angepriesen, ganz so, als seien Konkurse und menschliches Elend ein naturwüchsiger Prozess zum Nutzen der wirtschaftlichen Entwicklung.
Wie nahe diese Ideologie an den Sozialdarwinismus gebaut ist, erweist sich derzeit. Offenbar hat sich die Regierung – auch auf Drängen einiger Wirtschaftsverbände – entschieden, einen Teil der älteren Bevölkerung für den Staatshaushalt zu opfern. Weniger drastisch kann man den Zusammenhang kaum benennen. Dass dieser Weg auch ökonomisch fatal ist, haben kürzlich 60 Ökonom:innen in einem offenen Brief erklärt: Sie fordern einen Lockdown und staatliche Stützung.
In der Schweiz, einem Gläubigerstaat mit tiefen Staatsschulden und eigener Zentralbank, wären die notwendigen Massnahmen zumindest mittelfristig problemlos zu finanzieren. SGB-Chefökonom Lampart weist zudem darauf hin, dass bei den Krankenkassen Reserven von über elf Milliarden Franken angehäuft wurden. Der Gewerkschaftsbund fordert nun, dass diese an die Haushalte zurückfliessen, um den Konsum zu stärken.
Die Entscheidung für das Sparen statt für das Leben vermittelt sich bereits durch die Institutionen. Weiler vom Kafi Klick sagt: „Im Frühling war die Stimmung eher: Wir lassen niemanden im Stich. Jetzt ziehen die Ämter deutlich die Schraube an. Wir müssen mit unseren Besucher:innen ständig Sanktionen anfechten.”
Von den komplexen Modellierungen der Ökonom:innen kriegen diese kaum etwas mit. Auch die Debatten in den Parlamenten dürften viele nur als fernes Rauschen hören. Die Folgen hingegen spüren sie am eigenen Leib. Mittlerweile harren die Hilfesuchenden bis zu zweieinhalb Stunden in der Kälte vor dem Kafi Klick aus, die Institution darf aus Pandemie-Gründen ihre Räume nicht öffnen. „Wir merken, dass die Leute mehr und mehr unter Druck geraten”, so Weiler.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 28 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1716 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 980 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 476 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?