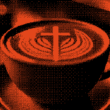„Dieses Jahr gibt es keine grosse feministische Demonstration zum Internationalen Frauentag. Grund sind die Corona-Massnahmen”, sagt Elham Barjas, feministische Aktivistin aus Beirut am Tag vor dem 8. März. Stattdessen würden diverse Webseminare zu Feminismus und Frauenrechten durchgeführt, um gleichwohl eine grosse Anzahl Menschen erreichen zu können.
Seit Beginn der Massendemonstrationen im Oktober 2019, in Zuge derer die Regierung unter dem korrupten Milliardär Saad Hariri zu Fall gebracht wurde, standen die Frauen an der vordersten Front der revolutionären Protestbewegung. Sie waren es, die die Initiative ergriffen. Sie waren es, die sich den Schlägertruppen des schiitischen Hizbullah entgegensetzten.
Dies mitunter deshalb, weil sie am stärksten von struktureller Ungleichbehandlung betroffen sind.

Libanon steht im jährlich vom Weltwirtschaftsforum (WEF) erstellten Global Gender Gap Index auf Platz 145 von 153. Frauen verdienen um ein Vielfaches weniger als Männer, sind innerhalb der Familie abhängig von deren Lohn und haben gesetzlich nur geringen bis gar keinen Schutz. Oft ist ihr Zugang zu Leistungen und Arbeit abhängig von Familienbeziehungen. Durch das im Nahen Osten verbreitete Kafala-System, das den legalen Aufenthaltsstatus von Gastarbeiter:innen an den Vertrag mit den – meist privaten – Arbeitgeber:innen koppelt, sind viele von ihnen Ausbeutung, ausbleibenden Lohnzahlungen, sexualisierter Gewalt oder der Konfiszierung des Reisepasses ausgesetzt.
Die unterschiedlichen Formen der Unterdrückung der Frauen im Libanon – sei es am Arbeitsplatz, in der Familie oder in der Öffentlichkeit – sind eine direkte Folge des konfessionellen politischen Systems.
Diese nach dem Ende des Bürgerkrieges 1990 wieder instandgesetzte Verbindung von Politik und Religion sieht ein komplexes Wahlprozedere und einem nach religiöser Herkunft festgelegten Mechanismus in der Besetzung politischer Ämter vor. Der Konfessionalismus hat nicht nur zu massiver Korruption und Klientelismus geführt, sondern auch Parteien hervorgebracht, die über die Politik hinaus beinahe jeden Bereich des Alltags der Menschen bestimmen. Stets auf Basis der Religionszugehörigkeit.

So ist ein Grossteil der Frauen in ihrem Alltag abhängig von einer religiösen Gruppe oder der entsprechenden Partei. Über die Loyalität zu diesen erhalten sie Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung.
Aufgabe der feministischen Bewegung sei es deshalb auch, überhaupt ein Bewusstsein für die zur Normalität gewordenen Zwänge der religiösen Herkunft zu schaffen, wie Barjas meint. Neben der Organisation von nicht-religiösen feministischen Zirkeln müssten auch über die Parteien Frauen erreicht werden. Aufgrund der Verwobenheit von Religion, Politik, Gesellschaft und Alltag müssen sich die feministischen Gruppen immer auch damit auseinandersetzen, wie sich die Religionsgemeinschaften von innen her feministisch umdeuten lassen.

„Seit dem 17. Oktober findet bei einigen progressiven Parteien ein Umdenken statt”, führt Barjas aus. „Die oppositionellen Gruppen setzen sich nun mit Frauen‑, LGBTIQ- und den Rechten von Gastarbeiter:innen auseinander. Doch auf staatlicher Ebene ist die Diskriminierung immer noch dieselbe.” Die in den oppositionellen Parteien wachsende Denkweise sei ein erster Schritt hin zu einem „extrem progressiven Feminismus”.
Strasse, Räte, Barrikade
Der Ursprung der staatlichen Diskriminierung liegt darin, dass es per Verfassung ermöglicht wird, dass die 18 verschiedenen Religionsgemeinschaften frauenfeindliche Gesetze erlassen können. So werden beispielsweise die Gesetze über den Familienstand von jeder Konfession separat geregelt. Sie legen nicht nur den Mann als Oberhaupt der Familie fest, sondern sorgen auch dafür, dass sich die Frauen und Kinder der Religion des Mannes anschliessen müssen und in die patriarchalen Strukturen der Religionsgemeinschaften hineingezogen werden.
Um die Abhängigkeit von den Männern und den Religionsgemeinschaften zu brechen, ist die Einführung eines Zivilrechts zur Durchsetzung der Gleichberechtigung eine der Hauptforderungen der feministischen Bewegung.
So finden in Beirut seit dem 17. Oktober 2019 regelmässig Proteste von Frauen vor den Einrichtungen der religiösen Räte wie dem Hohen Islamischen Rat der Schiiten, dem offiziellen Repräsentationsorgan der Schiit:innen im Libanon, statt. Neben dem übergeordneten Ziel der Einführung eines Zivilrechts fordern sie konkret vor allem das Sorgerecht für die eigenen Kinder.

Die organisierten feministischen Gruppen unterstützen Frauen aus unterschiedlichen Lebensbereichen in ihren jeweiligen Kämpfen, wie Barjas meint. Ob mit religiösem oder atheistischem Hintergrund, ob Student:in oder Gastarbeiter:in – der Kampf der Frauen sei ein Kampf gegen das System. „Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir uns vernetzen. Gerade jetzt, während Corona”, fügt sie an.
Vor allem die Gastarbeiter:innen wurden hart von der Krise getroffen. Laut Amnesty International lebten 2019 ungefähr 250’000 von ihnen im Libanon, ein Grossteil davon Frauen aus ostafrikanischen Ländern wie Äthiopien. Viele dieser Frauen sind über das Kafala-System angestellt. Um ein entsprechendes Visum zu erhalten, müssen sie stets den Namen der Arbeitgeber:innen angeben.
Im Zuge der Corona-Krise verloren viele der Gastarbeiter:innen ihre Erwerbsarbeit. „Diejenigen, die noch immer arbeiten können, erhalten zum Teil ihren Lohn nicht mehr. Und wenn, dann in Libanesischen Pfund”, sagt Barjas. „Das bedeutet, dass sie ihren Familien zu Hause kein Geld mehr zusenden können.”

Im Vergleich zum US-Dollar hat das Libanesische Pfund im letzten Jahr massiv an Wert verloren. Mittlerweile erhält man auf dem Schwarzmarkt für 10’000 Libanesische Pfund einen läppischen Dollar.
Unter anderem deshalb wollen viele Gastarbeiter:innen den Libanon verlassen. Einige erwägen sogar die Rückreise in das bürgerkriegsgefährdete Äthiopien. Doch da viele von ihnen nicht mehr im Besitz eines Passes sind, wird ihnen die Ausreise untersagt.
Wie auch mit den religiösen Frauen vor den schiitischen Räten demonstrieren die feministischen Gruppen Seite an Seite mit den Gastarbeiter:innen vor den Botschaften und Ministerien und fordern Ausreiseerlaubnisse und ein Ende des Kafala-Systems.

„Wir wollen unsere Rechte einfordern”, sagt Barjas. „Nicht nur auf der Strasse, sondern auch vor Gericht.”
Bis es soweit kommt, vernetzen sich die Frauen weiterhin so gut es geht, betreiben Aufklärungsarbeit und tragen wo immer möglich ihre Wut auf die Strasse.
Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die angestaute Wut der stark unter der Wirtschaftskrise leidenden Menschen im Libanon wieder zu Grossdemonstrationen in den Strassen von Beirut führen wird. Anzeichen dafür liefern dieser Tage vereinzelte Protestaktionen und Strassenbarrikaden. An vorderster Front: die Frauen.

Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 14 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 988 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 490 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 238 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?