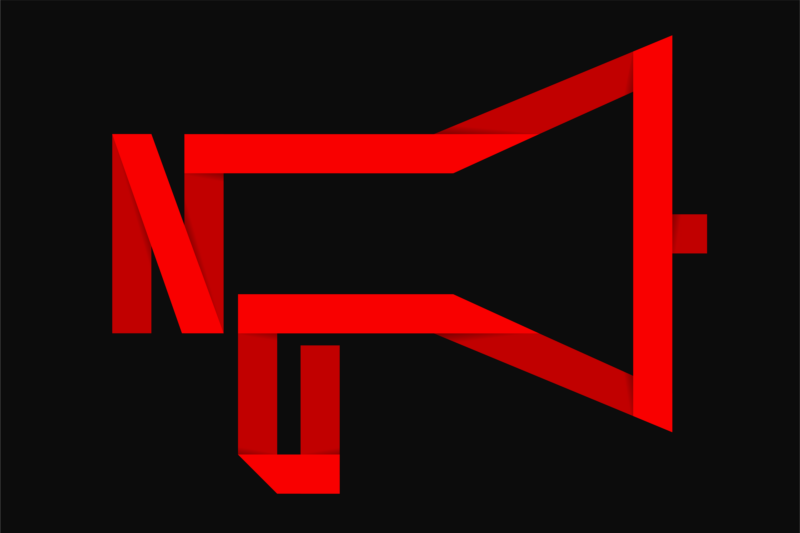In einem Kommentar zeigen Journalist*innen, die sich mit einem Thema vertieft befasst haben, üblicherweise auf, welche Meinung sie durch die Recherche entwickelt haben. Dies ist ein solcher Kommentar. Und zwar zum neuen Filmgesetz, über das wir am 15. Mai abstimmen. Nur: Anstatt einer Meinung hat sich bei mir in erster Linie ein grosses Fragezeichen entwickelt. Ein Fragezeichen, das sich nicht nur hinter die Lex Netflix setzen lässt.
Vier Prozent ihres Schweizer Umsatzes sollen Streaminganbieter*innen wie Netflix, Prime Video oder Disney+ zukünftig in die hiesige Filmbranche investieren. So sieht es das neue Filmgesetz, auch Lex Netflix genannt, vor. Drei Jungparteien haben dazu das Referendum ergriffen: die Junge GLP, die Junge SVP und der Jungfreisinn. Ihr Hauptargument gegen das Filmgesetz: Eine solche Investitionspflicht würde schliesslich auf dem Buckel der Jungen ausgetragen.
In der Hoffnung, dieses oder jenes Argument besser einordnen zu können, schaute ich mir vor ein paar Tagen die Arena zum neuen Filmgesetz an: „Von Ihnen habe ich noch nie das Wort Konsument gehört”, wirft Jungfreisinnigen-Präsident Matthias Müller der Mitte-Ständerätin Andrea Gmür vor. Gmür befürwortet das neue Filmgesetz. Müller gehört zu den Gegner*innen der Lex Netflix. Deren Hauptargument: Die Konsument*innen würden im Regen stehen gelassen und müssten eine Annahme des neuen Gesetzes mit höheren Abogebühren bezahlen. Denn die Streamingkonzerne würden die Mehrkosten auf die Abonnent*innen abwälzen.
Am 15. Mai kommt die Abstimmung zum sogenannten Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur an die Urne. Kurz wird die Vorlage auch Filmgesetz oder Lex Netflix genannt. Laut dem neuen Gesetz müssten Streamingdienste wie Netflix, Prime Video und Disney+ neu vier Prozent des Umsatzes, den sie in der Schweiz erwirtschaften, in das Schweizer Filmschaffen investieren. Dasselbe würde auch für ausländische Fernsehsender gelten, sofern sie gezielt Werbung für das Schweizer Publikum senden und auf dem Schweizer Werbemarkt Geld verdienen. Für private Schweizer Fernsehsender gilt diese Investitionspflicht bereits heute.
Laut dem Bund sollen mittels des neuen Filmgesetzes 18 Millionen Franken mehr in den Schweizer Film fliessen. Wichtig: Bei diesen 18 Millionen handelt es sich nicht um geschenkte Gelder, sondern um Investitionen. Laut eigenen Angaben plant Netflix, bis 2023 so oder so 500 Millionen in den deutschsprachigen Raum zu investieren. Mit einer Investitionspflicht könnte die Schweiz sicherstellen, dass ein Teil des Geldes in die Umsetzung von Schweizer Filmprojekten fliesst.
Der Schweizer Film erhält bereits heute Gelder. Laut einem Bericht der Aargauer Zeitung zahlten Bund und Regionen durchschnittlich 39 Millionen pro Jahr. Die SRG und private Sender gaben weitere 42 Millionen pro Jahr für den Schweizer Film aus. Über private Finanzierung kamen weitere 24 Millionen Franken hinzu. Das macht 105 Millionen Franken pro Jahr. Die häufig genannten 120 Millionen entsprächen laut Aargauer Zeitung dem Finanzvolumen von 2019 und nicht den jährlichen Subventionen durch die öffentliche Hand.
Neben der Investitionspflicht würde es mit dem neuen Gesetz für Streamingdienste eine Mindestquote von 30 Prozent für europäische Produktionen geben. Bei den privaten Fernsehfirmen gibt es das bereits heute. Auch andere europäische Länder kennen ähnliche Investitionspflichten und Mindestquoten.
Dreist versuche man hier, die Konsument*innen um ihr Geld zu bringen – so auch die Kernbotschaft eines Werbespots der Zürcher Jungfreisinnigen gegen das neue Filmgesetz. Der Plot: Ein junger Mann macht es sich mit seiner Begleitung vor dem Laptop gemütlich, sie durchforsten das Angebot von Netflix. Schleichend wird ihm eine 20er-Note aus der Hosentasche gezogen – scheinbar symbolisch für die steigenden Abopreise. Als er kurzfristig Kondome kaufen will, fehlt ihm dafür das Bargeld, wodurch der Höhepunkt des romantischen Streamingabends wohl ins Wasser fällt. Schuld daran: das neue Filmgesetz.
Einmal abgesehen davon, dass Jungfreisinnige wohl eher twinten als mit einem 20er-Nötli zum Kiosk zu rennen und der hier abgebildete Zusammenhang zwischen Abopreisen und Verhütung im besten Fall an den Haaren herbeigezogen und im schlimmsten Fall unangenehm peinlich ist, lässt sich auch darüber streiten, ob die Abopreise bei einem Ja zum neuen Filmgesetz überhaupt steigen würden. Denn obwohl es eine zentrale Information für den öffentlichen Diskurs rund um das neue Filmgesetz wäre, beziehen die grossen Streaminganbieter*innen keine Stellung dazu, was die Annahme des Filmgesetzes für die Abopreise heissen könnte (das Lamm berichtete).
Dieses undemokratische Schweigen von Netflix und Co. ist zweifelsohne fraglich. Doch bei dem einen grossen Fragezeichen, dass meiner Meinung nach über der gesamten Lex-Netflix-Frage hängt, geht es noch um etwas anderes. Denn offensichtlich reagieren weder die Konsument*innen noch die bürgerlichen Jungparteien auf jede Preiserhöhung gleich.
Preiserhöhung ist nicht gleich Preiserhöhung
2014, zum Marktstart von Netflix in der Schweiz, kostete das Standard-Abo 12.90 Franken (HD, zwei Geräte). 2015, 2017, 2019 und zuletzt 2022 hat Netflix die Preise erhöht. Seit Januar 2022 zahlen Schweizer Kund:innen für das Standard-Abo monatlich 18.90 Franken. In nur sieben Jahren ist der Preis für ein Netflix-Abo in der Schweiz also um fast 50 Prozent gestiegen. Eine Welle der Empörung blieb jedoch aus. Bürgerliche Jungparteien, die im Namen der gebeutelten Konsument*innen das Wort ergreifen? Ein entsetzter Jungfreisinn, der Netflix im Namen der Abonnent*innen die Leviten liest? Fehlanzeige.
Preiserhöhung scheint also nicht gleich Preiserhöhung zu sein: Während die eine für grosses Entsetzen sorgt, geht die andere fast unbemerkt über die Bühne. Während die eine Art von Preiserhöhung eine Gegenleistung mit sich bringen würde – nämlich ein vielfältigeres Filmangebot auf den Streamingseiten –, brachte die andere keinen Mehrwert. Zumindest nicht für uns Konsument*innen. Für Netflix schon: Denn dort kassierte man mehr Cash ein. Bleibt die Frage, was mit diesem Geld finanziert wurde.
Die kurze Antwort darauf lautet wohl: das Leben von Reed Hastings, Gründer von Netflix. Sein Vermögen wird vom Forbes Magazin auf 2.7 Milliarden US-Dollar geschätzt. 2021 flossen je 35 Millionen an die zwei Netflix CEOs Hastings und Ted Sarandos. Zum Vermögen von Amazon- und Prime-Video-Besitzer Jeff Bezos muss man wohl an dieser Stelle nichts schreiben. Und auch bei Disney+ fliessen Millionen für Managerlöhne ab. Managerlöhne, die unter anderem über Schweizer Streamingabos bezahlt werden.
Und nicht nur Streamingdienste bitten uns immer wieder zur Kasse, ohne auf grossen Widerstand zu treffen. Gemäss Mieterinnen- und Mieterverband haben Schweizer Mieter*innen seit 2006 rund 78 Milliarden Franken zu viel Miete bezahlt. Die SP nannte es einen „volkswirtschaftlichen Skandal” – das grosse Entsetzen blieb jedoch aus. Vor wenigen Wochen wurde publik, dass die Benzinpreise trotz der wieder sinkenden Ölpreise auf einem hohen Niveau verharrten. Der Grund: Die Erdölkonzerne scheinen von der momentanen Lage auf dem Ölmarkt profitieren zu wollen. Die empörten Arena-Auftritte oder frechen Werbespots blieben aber auch hier aus.
Zahlen für die Superreichen
Seit dem Jahr 2000 hat sich die Anzahl Milliardär*innen weltweit mehr als verfünffacht. Ihr Vermögen hat sich sogar mehr als verzehnfacht. Das Geld, das sich da angesammelt hat, ist nicht vom Himmel gefallen. Es wurde von jemandem bezahlt. Über die Miete, an der Tanksäule oder eben auch mit einem Streamingabo.
Wieso das niemanden stört, während man sich gleichzeitig sinnvolle Investitionen in unsere Gesellschaft nicht leisten will – das ist mein grosses Fragezeichen. Investitionen in den Klimaschutz? Wer soll das bezahlen. Ein wenig mehr hinlegen, um von Putins Erdgas wegzukommen? Viel zu teuer! Netflix, den Immobilienhaien und Big Oil ohne Gegenleistung unser schwer verdientes Geld abgeben: kein Problem. Der Profit von Konzernen, CEOs und Multimilliardär*innen scheint schlichtweg unantastbar.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 18 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1196 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 630 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 306 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?