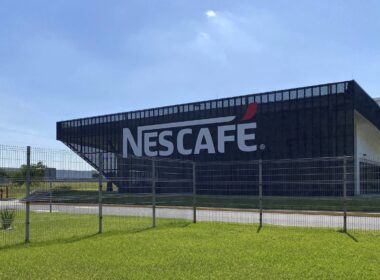Gross hängt sie über dem Eingang zur U‑Bahn-Station von Ñuñoa in Santiago – die Schweizer Uhr. Langsam bewegt sich der Sekundenzeiger vorwärts und bleibt für einen kleinen Moment auf der vollen Minute stehen. Die Menschen gehen daran vorbei, niemand scheint diese Schweizer Genauigkeit zu beachten.
Fremd wirkt sie an diesem Ort in Chile, wo es üblicherweise keine öffentlichen Uhren gibt. Und wenn, dann funktionieren sie meist nicht. Hier betritt man so etwas wie eine kleine Schweiz – denn die Uhr gehört zum Ausstellungsraum „Suizspacio” in der U‑Bahn-Station, die unweit des „Schweizer Viertels” liegt.
Zwischen den Strassen Dublé Almeyda und José Domingo Cañas prägen Schweizer Alpen die Wandverzierungen. Hier stehen die Schweizer Schule und der Schweizer Club von Santiago, gegründet vor etwa 100 Jahren. Denn Chile wird wie viele andere Staaten auf dem amerikanischen Kontinent durch Kolonialisierung und Migration europäischer Herkunft geprägt – darunter auch aus der Schweiz.

Eingeladen wurden sie, die Schweizer*innen, vor mehr als hundert Jahren vom chilenischen Staat, der seinerseits Gebiete der Indigenen erobert hatte, die Teil des eigenen Staatsprojektes werden sollten. Dies unter der rassistischen Vorstellung, man wolle das Land und die Bevölkerung europäisieren und „weisser machen”.
Denn, so meinte die damalige Elite, die Europäer*innen seien als „Rasse” weiter entwickelt. Ein Gedankenzug, der sich zum Teil bis heute fortsetzt in Ideen und Traditionen, die wie die Zeiger einer chilenischen Kirchturmuhr seit Jahren stillstehen.
Die Einsetzbarkeit des „Guten”
Sie wirkt wie eine Geschichte ohne Verlierer*innen, von Fleiss und dem unermüdlichen Aufbau von Reichtum: die Geschichte der Schweizer Siedler*innen im Süden Chiles.
Doch die Realität sieht anders aus: Ende des 19. Jahrhunderts eroberte der chilenische Staat mit Waffengewalt weite Teile im heutigen Süden Chiles. Die indigenen Völker, die selbstverwaltet vor Ort lebten, wurden ermordet, enteignet, entrechtet und in Reservate gesteckt. Das Land wurde an Siedler*innen verteilt.
Und genau hier beginnt die Geschichte der Schweizer*innen, aufgeschrieben in eigenen Aufsätzen und Büchern: Sie erzählen von der eigenen Armut in der Schweiz, von Unternehmen, die für die Reise warben, und Gemeindeverwaltungen, die ihren armen Bevölkerungsteil gerne am anderen Ende der Welt sahen.
Sie beschreiben mit übergenauer Exaktheit, welches Schiff jede Familie genommen hat, mit wie viel Material sie ihr Haus gebaut haben und wie viel es am Anfang kostete, die Bäume der Wälder zu fällen und erste Saat auszustreuen. Bis sie schlussendlich zu stolzen Landbesitzer*innen wurden.
Mehr als hundert Jahre später sitzen auch im Schweizer Club in Santiago Nachfahr*innen jener Schweizer*innen, die sich im jungen Chile eine Zukunft aufgebaut haben. Sie sind Teil des Direktoriums des Clubs und schreiben zusammen ein Buch, in dem sie ihre Familiengeschichten sammeln. Lange Stammbäume und Wappen begleiten die ausgedruckten Texte.
María Inés Baeriswyl, eine ältere Frau, die sich in ihren Sätzen genau ausdrückt, beginnt am Tisch im Schweizer Club zu erzählen. Ihre Familie wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Patagonien im Süden des Landes angesiedelt, am sogenannten Ende der Welt. In der Nähe von Punta Arenas, wo ehemals nur eine Gefängniskolonie bestand. Ursprünglich kamen sie aus Fribourg, der katholische Hintergrund passte dem chilenischen Staat, der ebenfalls katholisch geprägt war.

„Wir waren Teil der chilenischen Hoheitsgründung”, meint Baeriswyl. Die Siedler*innen sollten das Anrecht des chilenischen Staates auf die Gebiete rechtfertigen, doch „es waren unwirtliche Ländereien, niemand wollte hier leben”, Einzig zwischen den Monaten Oktober und März ist es im Süden möglich, Landwirtschaft zu betreiben.
Die Erzählungen sind geprägt von harter Arbeit, Fleiss, dem Gefühl der Überlegenheit und davon, einen wichtigen Beitrag für Chile geleistet zu haben – was das auch immer bedeuten mag. Dabei wird die eigene Geschichte als jene der Unbeteiligten dargestellt, die mitten in einen laufenden Konflikt zwischen dem chilenischen Staat und den Indigenen gerieten.
So ist sich die Gruppe der Nachfahr*innen der Siedler*innen einig: Die Schweizer*innen waren besonders respektvoll. Der Bruder von María Inés Baeriswyl, Fernando, meint: „Die Engländer und deren Unternehmen hatten besonders Probleme mit den Indigenen und dem Diebstahl von Vieh.”
Die Reaktion auf den Diebstahl war die Jagd auf Indigene. Es kam zu unzähligen Massakern im Süden Chiles. Doch die Schweizer*innen seien nicht beteiligt gewesen, behauptet die Gemeinschaft, man hätte den Dialog und gegenseitigen Austausch gefördert.
Die meisten Schweizer*innen kamen Ende des 19. Jahrhunderts in die heutige Araucanía, die zwischen Patagonien, ganz im Süden, und der Hauptstadt Santiago liegt. Dort lebten zuvor die indigenen Mapuche.
Patricia Mendoza, die ebenfalls am Tisch des Schweizer Clubs sitzt und deren Familie in der Araucanía lebt, schildert das Zusammenspiel wie folgt: „Die Mapuche, oder auch Araukaner, wie sie eigentlich heissen, lebten auf anderen Ländereien [als die Schweizer*innen, Anm. d. Red.]. Ausserdem waren sie vom technologischen Fortschritt und Fleiss der Schweizer fasziniert. Ich glaube, man kann sich das so vorstellen: Da kommt man zu den Indianern, zündet ein Streichholz an und sie bestaunen die Flamme.”
Die Indigenen hätten viel lernen wollen, meint Mendoza. Viele begannen zudem, für die Schweizer*innen zu arbeiten, für Mendoza ein Beweis des friedlichen Zusammenlebens.

Entgegen dieser harmonischen und hegemonialen Darstellung kämpft heute ein Teil der Mapuche um die Rückgabe von Ländereien und die Anerkennung der eigenen Kultur. Teil des politischen Kampfes ist die Anerkennung ihres eigenen Namens. Weg vom kolonialen Generikum der „Indianer” hin zur Eigenbezeichnung.
Während Mapuche – übersetzbar als Menschen der Erde – die Eigenbezeichnung ist, verwenden konservative Historiker*innen immer noch den Begriff Araukaner, der durch die den Mapuche feindlich gesinnten Inka geprägt wurde. Alle Völker am Rand des Herrschaftsgebietes der Inka wurden von diesen so genannt und der Begriff wurde später von den Spanier*innen übernommen.
Manche Mapuche führen den Konflikt im akademischen Rahmen, andere in der Politik, über Landbesetzungen und zum Teil auch mit Waffengewalt. Wobei auch Ländereien der Siedler*innen besetzt und deren Familien bedroht werden. Mendoza fragt sich: „Warum müssen die Siedler für einen Fehler des Staates einstehen?” Schliesslich habe der Staat den Siedler*innen leeres Land versprochen.
Enrique Ceppi, ein Nachfahre von Migrant*innen aus dem Tessin, ergänzt: „Die Schweizer sind in einen Konflikt geraten, der zwischen den Indigenen und dem chilenischen Staat ausgetragen wird. Heute sind sie die Leidtragenden.”
Diese Position wird auch gegenüber der Schweizer Botschaft ausgespielt. Anfang April verlangte die Abgeordnete Flor Weisse, Schweizer Nachfahrin und Mitglied der rechtsextremen Partei Unión Demócrata Independiente, der Botschafter solle wegen der Besetzungen von Ländereien, die Schweizer Siedler*innen gehörten, eingreifen.
Gegenüber lokalen Medien sagte Weisse: „Unsere Landsleute sollten uns helfen, da sich die Staaten um ihre Leute kümmern sollten.” Die Opferposition mischt sich mit dem Stolz, ein neues Leben aufgebaut zu haben, trotz aller Widrigkeiten.
„Unsere Vorfahren mussten unheimlich arbeiten, es waren fleissige Leute”, sagt Baeriswyl. „Immer wieder mussten sie erneut aufstehen.” Ceppi meint: „Für die Schweizer bedeutete die Arbeit Würde.”
Frei nach der „protestantischen Ethik” von Max Weber würde man im katholischen Chile Arbeit nicht so wertschätzen, man vermeide es, sie auszuführen. Die meisten der Anwesenden im Schweizer Club sprechen kein Schweizerdeutsch, Französisch oder Italienisch mehr. Ihre Familien sind Teil der chilenischen Elite geworden.

Zu den Schweizer Nachfahr*innen gehört unter anderem Irací Hassler, die derzeitige kommunistische Bürgermeisterin von Santiago. Oder auch Hernán Büchi, der ehemalige Finanzminister der Militärdiktatur, der mittlerweile in Zug wohnt.
Büchi war federführend bei den neoliberalen Reformen der Achtzigerjahre und verliess Chile im Jahr 2017 aufgrund der „rechtlichen Unsicherheit”, die durch die sozialen Proteste geschaffen wurde.
Schweizer Verbindungen
Während vor hundert Jahren eine Rückreise in die Schweiz ein Ding der Unmöglichkeit schien, erzählen die heutigen Siedler*innen von Reisen, die sie in ihre zweite „Heimat” unternehmen.
Sie erzählen vom Gefühl des Stolzes, als sie ihre Schweizer Pässe bekamen, von der Angst vor einer möglichen Einbürgerungsprüfung in der Botschaft oder den nötigen Reisen in die Schweiz, um anerkannt zu werden, bis zur Übergabe der Militärdienstunterlagen.
Was bedeutet es schlussendlich für sie, Schweizer*in zu sein? Es sei der Stolz auf ihre europäische Herkunft, meint die Gemeinschaft unisono. Ein Stolz – so scheint es –, der vor allem dazu dient, sich der eigenen Privilegien und Möglichkeiten zu versichern. Zum Beispiel jener, in politisch schwierigen Zeiten zurückzukehren.
Ceppi wurde während der Militärdiktatur aus der Universität geworfen und aufgrund der Herausgabe einer oppositionellen Zeitung verfolgt. Er lief Gefahr, einer der Tausenden von gefolterten und ermordeten Oppositionellen zu werden, weshalb er floh und in der Schweiz ohne Probleme aufgenommen wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Geflüchteten aus Chile, denen es die Schweiz sehr schwer machte, vor der Verfolgung zu fliehen.
Während Ceppi die Verfolgung von rechts erlebte, sind viele der Anwesenden eher über die linke Politik des aktuellen Präsidenten bekümmert. Wobei es nicht um das Ermorden von Oppositionellen geht, sondern um die Möglichkeit höherer Steuern und das bislang irreale Schreckgespenst von Enteignungen.
Chile erlebte vor drei Jahren einen sozialen Aufstand und hat derzeit eine linksreformistische Regierung, die zum Teil im Konflikt mit den Wirtschaftsverbänden steht. Im Schweizer Club sind die Meinungen dazu gespalten, Fragen werden nicht gerne gehört.
Ceppi meint: „Wir sind hier, um über unsere Verbindung zur Schweiz zu reden. Nicht über Politik.” Es seien die Statuten, die festlegten, dass im Club weder über Politik noch Religion gesprochen werde. Man wolle damit Konflikte vermeiden und sich auf das besinnen, was verbindet.
Nicht für alle offen
Die Beziehung zu Europa wird derweil von jung auf geknüpft: mit regelmässigen traditionellen Festen und dem Feiern des 1. Augusts, aber auch mit dem Entsenden der Kinder auf Privatschulen, die sich an europäischen oder US-amerikanischen Bildungssystemen orientieren.
Diese Schulen nennen sich École Française, Nido de Aguilas (Adlerhorst), Schweizer Schule oder English School. Meist wird dort auch die eine oder andere Fremdsprache gelernt, zum Teil findet der Unterricht zweisprachig statt und den Schüler:innen wird die Möglichkeit gegeben, einen westlichen Schulabschluss zu bekommen.
Für Kinder von Schweizer*innen gibt es zusätzlich die Möglichkeit, an Camps der Swiss Community teilzunehmen. Die 24-jährige Francisca Espinoza Trombert, die Tochter eines Paares aus dem Schweizer Club, ist Teil des Parlaments der jugendlichen Auslandschweizer*innen und war bereits im Nationalrat, um die Schweizer*innen im Ausland zu repräsentieren.
Für Trombert bedeutet die Schweiz Solidarität und Gemeinschaftssinn. „Es ist ein Land, das weniger individualistisch ist, man sorgt füreinander, man schützt die Umwelt.” Die Strassen seien sauber und sicher. „Man kann ohne Angst allein in der Nacht herumlaufen”, merkt Espinoza an. All das habe ihr auf ihren Reisen sehr gefallen.
Zwischen den Eindrücken, die bei kurzzeitigen Reisen entstanden sind, ist der 24-Jährigen durchaus bewusst, dass sie dank dem roten Pass in den Genuss diverser Privilegien kommt. Gefördert wird dies unter anderem durch die Schweizer Botschaft, die regelmässig aufzeigt, welche Stipendien und anderen Möglichkeiten es gibt, um eine gewisse Zeit in der Schweiz zu leben.
Zurück zur Uhr am U‑Bahnhof von Ñuñoa. Der Schweizer Botschafter Arno Wick erklärt auf Anfrage, dass die Uhr auch ein Versuch sei, den öffentlichen Raum nach Schweizer Vorbild zu gestalten. Das „zeitlose Design” symbolisiere die Schweizer „Pünktlichkeit und Genauigkeit”, so Wick.
Im Inneren der Metrostation findet derzeit eine Ausstellung statt mit dem Titel „Was kann die Technologie für die Umwelt tun?”. Vorgestellt werden Schweizer Unternehmen und Start-ups, die im Umweltbereich tätig sind. So will Wick die Schweiz darstellen: „Modern, innovativ und umweltschützend.”
Die Uhr tickt unentwegt weiter, die Menschen laufen unberührt daran vorbei. Und so wirkt dieses kleine Schweizer Symbol wie ein Portal in eine andere Welt – das allerdings nicht allen offensteht.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 39 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 2288 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 1365 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 663 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?