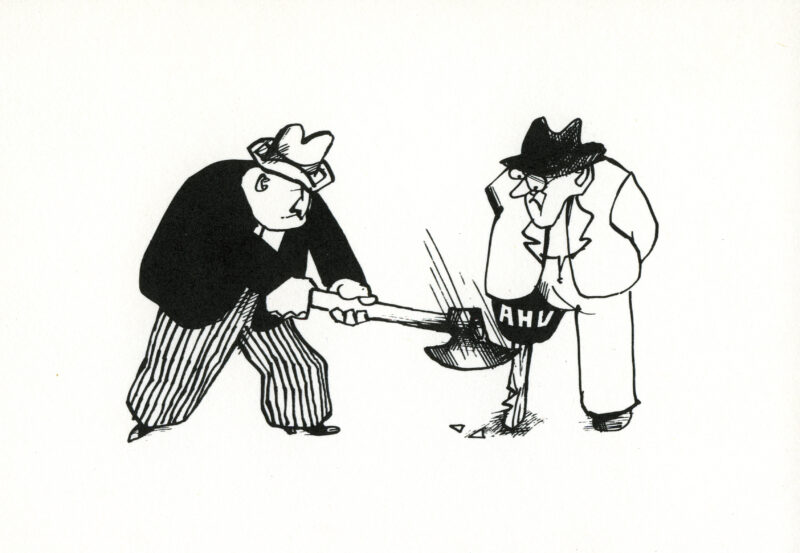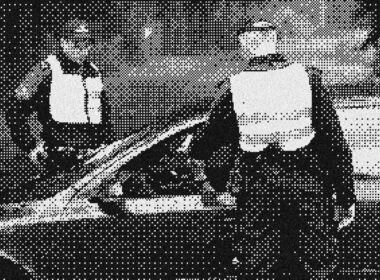Es ist der Kern linker Politik, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Dinge nicht so sein müssen, wie sie sind; dass Krisen keine Notwendigkeiten, sondern die Konsequenzen von politischen Entscheidungen sind; dass eine bessere Welt möglich ist, auch, oder gerade, wenn diese Vorstellung dem „gesunden Menschenverstand” widerspricht.
Das gilt auch im Kleinen, also für die Schweiz. Kaum an einem anderen Ort scheint die Idee, eine nachhaltige und soziale politische Lösung finden zu können, so hoffnungslos wie in der Altersvorsorge. Besonders die AHV, so die Erzählung, befindet sich in einer zyklisch wiederkehrenden Krise.
Um diese zu mildern, tischt die Politik der Stimmbevölkerung seit Jahren die immergleichen Lösungsvorschläge auf, um angebliche Lücken zu stopfen: Erhöhung des Rentenalters, Senkung des Umwandlungssatzes in der zweiten Säule, höhere Mehrwertsteuer. Ein unappetitliches Büffet an Tiefkühlspeisen, die man alle paar Jahre in der parlamentarischen Mikrowelle wieder aufwärmt.
Auf dem Rücken der Frauen
Auch die aktuelle AHV-Reform, über welche die Stimmbevölkerung diesen Sonntag abstimmt, reiht sich in diese Tradition ein. 25 Jahre nach der letzten erfolgreichen AHV-Reform sollen erneut Frauen die AHV sanieren, und das, obwohl sie heute rund 35 Prozent weniger Rente erhalten.
Zwar ist das Gleichstellungsargument der Befürworter*innen der Vorlage nicht mehr als ein Feigenblatt, aber es ist trotzdem wichtig aufzuzeigen, welche Unverschämtheit sich dahinter versteckt: Die erste Frau, die aufgrund der AHV-Reform länger arbeiten müsste, war 10, als Frauen sich das Stimmrecht erkämpften und die Schweiz eine Demokratie wurde; sie war 27, als 1988 das Eherecht revidiert wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt durfte ihr Ehemann ihr verbieten, zu arbeiten.
Letztes Jahr verschärfte das Bundesgericht für diese Frau auch noch das Unterhaltsrecht (das Lamm berichtete), was ihr Armutsrisiko nach der Scheidung weiter erhöhen dürfte: Bereits heute ist die Wahrscheinlichkeit, erstmalig Sozialhilfe beantragen zu müssen, für Frauen nach einer Scheidung mehr als 300 Prozent höher als für ihre Ex-Partner. Und diese Frau soll jetzt länger arbeiten, um das wichtigste Sozialwerk einer Gesellschaft zu sanieren, die ihr Versprechen für materielle Gleichstellung nie eingelöst hat.
Es sollte also ein Einfaches sein, dieser fantasielosen Politik einen Gegenentwurf gegenüberzustellen und aufzuzeigen, dass die Krise in der Altersvorsorge keine Notwendigkeit ist – dass alles auch ganz anders sein könnte.
Doch viel zu oft haben die SP und die Gewerkschaften genau diese Chance vergeben.
Ein verhängnisvoller Kompromiss
Als sich vor genau 50 Jahren, nach einer langen Phase der Hochkonjunktur, die reale Chance bot, die AHV zu einer staatlichen Volkspension auszubauen, die mindestens 60 Prozent des Lohns vor der Pension versichern sollte, kniffen SP und die Gewerkschaften.
Die Partei der Arbeit (PdA) wollte mit einer Initiative die AHV auf Kosten der damals noch freiwilligen betrieblichen Pensionskassen ausbauen und den Bundesteil auf mindestens einen Drittel festlegen. Dafür hätten Unternehmen und Wohlhabende stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Fern von einer perfekten Lösung, aber doch ein Fenster in eine bessere Welt.
Doch es kam ganz anders, die SP und die Gewerkschaften – letztere sorgten sich um ihre Posten in den betrieblichen Pensionskassen – schlossen sich im Nationalrat dem Gegenvorschlag zur PdA-Initiative der Bürgerlichen an. Die SP zog für diesen Kompromiss sogar ihre eigene AHV-Ausbauinitiative zurück, die PdA-Initiative erlitt in der Folge Schiffbruch an der Urne und das Drei-Säulen-System, mit all seinen institutionalisierten Ungerechtigkeiten, war geboren.
Als es 1984 dann darum ging, ihren Teil des Kompromisses von 1972 einzulösen, ignorierten die bürgerlichen Parteien in der Ausarbeitung des BVG-Gesetzes ihr Versprechen, dass die AHV und Pensionskasse zusammen die gewohnte Lebensführung garantieren sollten. Sie setzten den Einstiegslohn so hoch an, dass viele Frauen mit ihren niedrigen Löhnen und mit ihrer Teilzeitarbeit erst gar nicht in der zweiten Säule versichert wurden. „Die Linke wurden 1972 über den Tisch gezogen”, behauptet nicht der Autor dieser Zeilen, sondern der Basler Historiker Martin Lengwiler.
Aber es greift zu kurz, die Linke als Opfer eines gewieften Taschenspielers darzustellen. In den vergangenen Jahren hat sie immer wieder mitgeholfen, die Krise der AHV als Fakt darzustellen und die gleichen Lösungen, die heute als Abbau verschrien werden, aufgetischt.
Für mehr soziale Gerechtigkeit
2017 schrieb die SP in ihren Unterlagen zur Altersvorsorge 2020, welche die erste und die zweite Säule gemeinsam reformieren wollte, dass bei der AHV der Finanzbedarf steige, wenn die Babyboom-Generation pensioniert werde. „Ohne Gegenmassnahmen wird sich dieser Trend noch verstärken.” Deswegen sollten, neben deutlich sozialeren Ausgleichsmassnahmen als bei der aktuellen Vorlage, das Rentenalter der Frauen steigen, der Umwandlungssatz in der zweiten Säule sinken und die Mehrwertsteuer steigen.
Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss (SP) verteidigte damals die Erhöhung des Frauenrentenalters gegen linke Einwände damit, dass „Rentenalter und Lohngleichheit nicht am selben Tisch verhandelt [werden]. Das eine kann nicht gegen das andere eingetauscht werden.” Beide Argumente werden heute von der Gegenseite bemüht.
In welche Zwickmühle sich die linke AHV-Politik seit 1972 manövriert hat, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass man sich die letzten 0,3 Lohnprozente – die primäre Finanzierungsquelle der AHV – 2019 mit milliardenschweren Steuergeschenken an Unternehmen erkaufen musste. 1972 lagen bis zu 25 Lohnprozente auf dem Tisch.
Es ist aber nicht so, als gäbe es keine linken Vorschläge für eine nachhaltige und gerechte Altersvorsorge. Die Gewerkschaften haben eine Initiative für eine 13. AHV-Rente eingereicht. SP-Nationalrätin Jaqueline Badran wird nicht müde zu erklären, dass man deutlich mehr Lohnprozente von der ineffizienten zweiten Säule in die AHV verschieben müsste. Beide haben recht.
Und es ist ermutigend, mit welcher Vehemenz sich SP und Gewerkschaften gegen die vorliegende AHV-Reform stellen – nicht aus identitätspolitischem Kitsch, wie die Gegner*innen unredlicherweise behaupten, sondern für mehr soziale Gerechtigkeit.
Deswegen braucht es ein doppeltes Nein, und in Zukunft wieder mehr Mut, Chance für eine bessere Welt dann zu ergreifen, wenn sie sich präsentiert.
Dieser Artikel ist zuerst bei der P.S.-Zeitung erschienen. Die P.S.-Zeitung gehört wie das Lamm zu den verlagsunabhängigen Medien der Schweiz.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 6 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 572 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 210 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 102 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?