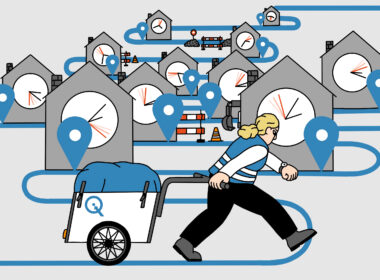Das Lamm: Martin Lengwiler, diesen Sonntag stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung wieder einmal über eine AHV-Reform ab. Sie haben zur Entstehung des Drei-Säulen-Modells, wie wir es heute kennen, geforscht. Dabei spielt die AHV-Abstimmung vor genau 50 Jahren eine zentrale Rolle.
Martin Lengwiler: Genau, 1972 hat die Schweiz die Systemfrage gestellt und sich für das heutige Drei-Säulen-Modell entschieden. Das war die Weichenstellung in Richtung Altersvorsorge, wie wir sie heute kennen.

Dr. Martin Lengwiler ist Professor für Neuere Allgemeine Geschichte an der Universität Basel. Sein Forschungsschwerpunkt liegt unter anderem auf der Geschichte des Schweizer Sozialstaats.
Machen wir zuerst einen Schritt zurück: Wie war die Altersvorsorge vor 1972 organisiert?
Das AHV-Gesetz trat 1948 nach eine sogenannten Jahrhundertabstimmung im Jahr zuvor in Kraft. Bei einer Stimmbeteiligung von 80 Prozent stimmten 80 Prozent mit Ja. Am Tag der Abstimmung herrschte Euphorie im ganzen Land, tags darauf folgte aber bereits die grosse Ernüchterung. Die AHV konnte keine existenzsichernden Renten auszahlen, vor allem für jene Jahrgänge, die 1948 bereits im Pensionsalter standen.
In den 1950er- und 1960er-Jahren folgten deswegen all paar Jahre erfolgreiche AHV-Reformen – ein Reformzyklus, den man sich heute kaum noch vorstellen kann. Dabei ging es immer darum, näher an existenzsichernde AHV-Renten zu kommen.
Aber die Geschichte der AHV kann man nicht verstehen ohne die Geschichte der Pensionskassen. Diese breiteten sich seit dem Ersten Weltkrieg aus. Sie wurden vor allem von Arbeitgeber*innen als Privatversicherungen begründet und zusammen mit Arbeitnehmer*innenvertretungen verwaltet.
Über die Hälfte der Arbeiter*innen war aber 1970 nicht in einer Pensionskasse versichert.
Ja, die Kassen waren auch überhaupt nicht niederschwellig organisiert. Zum Beispiel durften die Arbeitgeber*innen oft das angesparte Kapital behalten, wenn die Arbeiter*innen den Job wechselten. Die Pensionskassen waren so auch ein Zückerchen, mit dem die Arbeitgeber*innen die Arbeiter*innen an sich binden konnten.
Dabei waren die Rentenleistungen, die die Pensionskassen auszahlten, sehr unterschiedlich: Beamt*innen hatten bereits damals sehr gute Pensionskassen und erhielten höhere Renten als aus der AHV. In der Industrie hingegen kam es auf die Branche an, wie hoch die Pensionskassenleistungen ausfielen.
Es gab aber auch Auflagen. Wenn eine Pensionskasse staatlich subventioniert oder unterstützt wurde, mussten diese Kassen paritätisch organisiert sein. Das bedeutet, dass die Gewerkschaften und Arbeitgeber*innen die Pensionskassen gemeinsam verwalteten. Und das sollte sich 1972 als politisch entscheidend erweisen.
Okay, Zwischenbilanz: Vor 1972 gab es eine AHV, die keine existenzsichernde Renten auszahlen konnte, und freiwillige Pensionskassen, die viele Arbeiter*innen ausschloss und sehr unterschiedliche Renten auszahlten. Wie kam es also zur Abstimmung von 1972?
Mit den verschiedenen Reformen in den 1950er und 1960er Reformen erreichte die AHV Ende 1960er-Jahre das existenzsichernde Niveau. Gleichzeitig begann die Linke, über die Landesgrenzen hinauszuschauen und realisierte, dass Deutschland oder Frankreich das Wirtschaftswachstum der Nachkriegsjahre dafür verwendet hatten, ihre staatliche Altersvorsorge nicht nur zur Sicherung der Existenz im Alter auszubauen, sondern auch zur Fortsetzung der gewohnten Lebensführung. Das entspricht etwa 60 Prozent des Lohns vor der Pension.
Um das für die Schweiz zu erreichen, lancierte sowohl die Sozialdemokratische Partei als auch die kommunistische Partei der Arbeit (PdA) Ende der 1960er-Jahre fast zeitgleich je eine Volksinitiative, die die AHV ausbauen wollte.
Wie unterschieden sich die Initiativen?
Für beide Parteien war klar, dass sie in ihre Initiative auch die vielen betrieblichen Pensionskassen einbeziehen mussten. Die PdA wollte sie verstaatlichen und die AHV so stark ausbauen, dass sie allein mindestens 60 Prozent des Lohns vor der Pension abdecken würde. Es wäre faktisch das Ende der betrieblichen Pensionskassen gewesen.
Die SP-Initiative wollte zwar auch die AHV ausbauen und das 60-Prozent-Ziel erreichen, allerdings unter Einbezug der Pensionskassen, ohne deren Existenz in Frage zu stellen. Das hat viel mit den Gewerkschaften zu tun: Deren Vertreter*innen hätten mit einer Verstaatlichung der Pensionskassen ihre Posten verloren und hatten somit kein Interesse, die AHV auf Kosten der Pensionskassen zu stärken. Aber über die Initiative der SP wurde gar nie abgestimmt, weil sich die Sozialdemokrat*innen in der Nationalratsdebatte auf einen Kompromiss mit den Bürgerlichen einliessen.
Wie kam es dazu?
Die Bürgerlichen hatten die berechtigte Sorge, dass die SP-Initiative bei einer Abstimmung gegen die PdA-Initiative angenommen würde. Deshalb einigten sie sich mit der SP auf einen Gegenvorschlag zur PdA-Initiative. Dieser umfasste das heutige Drei-Säulen-Modell. Im Gegenzug zog die SP ihre Initiative zurück.
Es war ein klassischer Kompromiss: Die Bürgerlichen schluckten das Obligatorium in der zweiten Säule – Pensionskassenbeiträge sind seither für Arbeitnehmende und ‑gebende obligatorisch – und das 60-Prozent-Ziel in der Verfassung. Die SP nahm dafür in Kauf, dass der Ausbau der Altersvorsorge in Zukunft eher in der zweiten Säule als in der AHV stattfinden würde.
Der Gegenvorschlag wirkte, die PdA-Initiative wurde hochkant abgelehnt. Aus heutiger Sicht eine verpasste Chance der Linken, die nun um jedes Lohnprozent in der AHV kämpfen muss.
Das kann man natürlich so sehen, wobei eine Verstaatlichung der Pensionskassen für die Linken ein Kraftakt gewesen wäre und eigene Probleme mit sich gebracht hätte.
Aber der viel grössere Skandal ist, was in der Folge zwischen 1972 und 1984 passiert ist. Denn: Das 60-Prozent-Ziel, also die Fortsetzung der gewohnten Lebensführung, für das die SP ihre Initiative zurückgezogen hat, wurde nie umgesetzt. Es steht zwar heute noch in der Bundesverfassung, wurde aber 1984 faktisch gekippt.
Was ist 1984 passiert?
Kurz nach der Abstimmung über die PdA-Initiative endet die Phase der Hochkonjunktur der Nachkriegsjahre. Es folgen zwei Rezessionen in den 1970er-Jahren. Als es dann darum ging, den Gegenvorschlag von 1972 in ein Gesetz umzuformulieren, kippten die Bürgerlichen das 60-Prozent-Ziel aus dem Gesetz. Es steht zwar bis heute in der Verfassung, dass die AHV und die Pensionskassen die Fortsetzung der „gewohnten Lebenshaltung“ garantieren sollen, aber im Gesetz über die berufliche Vorsorge (BVG-Gesetz) ist davon nichts mehr zu finden.
Dafür hat man mit einem zu hohen Eintrittslohn dafür gesorgt, dass ein grosser Teil der Bevölkerung, der wenig verdient oder Teilzeit arbeitete – also vor allem Frauen –, nicht in der Pensionskasse versichert wurde. Alle die Löcher, die wir heute noch immer stopfen, hat man 1984 in Kauf genommen, weil man das 60-Prozent-Ziel gekippt hat.
Heute sagen viele Versicherungsexpert*innen: Die Linke wurde 1972 über den Tisch gezogen. Die AHV und die Pensionskassen erreichen heute in vielen Fällen noch nicht das Rentenniveau, das 1972 versprochen wurde.
War die Geschlechterfrage 1972 und 1984 bereits ein Thema?
Nein, kaum. In den Reformen der 1950er- und 1960er-Jahre konnte man die Situation der Frauen verbessern, etwa mit der Senkung des Rentenalters 1957. Die Idee dahinter war damals weniger patriarchal als dass das heute dargestellt wird. Man wusste, dass die Witwenrenten katastrophal und die Renten auf kleine Einkommen, die meistens von Frauen erzielt wurden, zu tief waren. Deswegen kam man den Frauen mit einer Senkung des Frauenrentenalters entgegen.
1972 war die Geschlechterfrage kein Thema. Bei der Ausarbeitung des BVG-Gesetzes 1984 wusste man zwar, dass mit dem hohen Eintrittslohn viele Frauen nicht versichert würden, aber das war auch dann kein grosses politisches Thema. Und dies, obwohl der Gleichstellungsartikel bereits seit 1981 in Kraft war.
Heute, 50 Jahre nach der Weichenstellung, stimmen wir über eine weitere AHV-Reform ab. Die Linken kritisieren die Rentenlücke für Frauen in der zweiten Säule, die Befürworter*innen argumentieren für eine Trennung der ersten und zweiten Säule. Ist eine solche Trennung überhaupt sinnvoll, wenn man sich die Geschichte anschaut?
Wenn man ehrlich ist, muss man die beiden Säulen gemeinsam behandeln. Die drei Säulen stehen ja auch für ein gemeinsames Haus, die Altersvorsorge. Und das Drei-Säulen-Modell hat auch seine Vorteile: Die AHV hat zwar ein demographisches Problem, aber keines mit Anlagen am Kapitalmarkt. Die zweite Säule hingegen hat ein Anlage‑, aber kein Demographieproblem. Mit Blick auf die internationale Ebene kann durchaus sagen, dass dieser Mix von Risiken gar nicht so abwegig ist.
Politisch aber ist die Verknüpfung der beiden Säulen toxisch, auch wenn sie technisch und inhaltlich gesehen sinnvoll ist. Die Altersvorsorge in der Schweiz hat heute ein Komplexitätsproblem, weil man sich 1972 für den komplizierteren Weg des Drei-Säulen-Modells entschieden hat, anstatt auf ein Versicherungssystem zu setzen.
Jetzt hat man zwei Säulen, mit denen man nicht zufrieden ist und die reformiert werden müssen. Das führt bei jeder Reform zu einer Vervielfachung der Nein-Stimmen. Das macht es politisch nicht einfach.
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 12 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 884 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 420 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 204 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Löse direkt über den Twint-Button ein Soli-Abo für CHF 60 im Jahr!