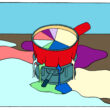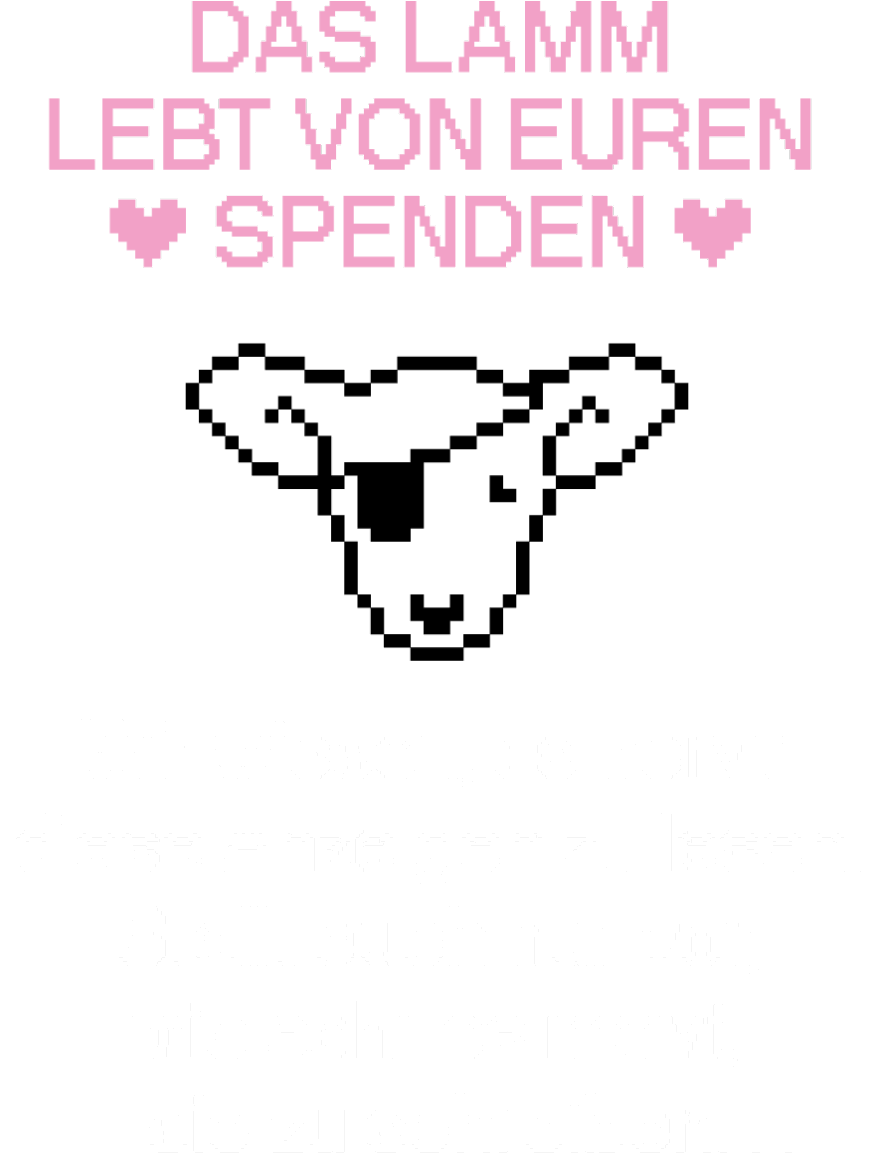“Alle bewaffneten Gruppen müssen ihre Waffen niederlegen und die PKK muss sich auflösen”, verkündete PKK-Mitgründer Abdullah Öcalan in seiner Botschaft am 27. Februar. Eine Delegation der türkischen linken DEM-Partei verlas seine Botschaft. Der Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sitzt seit 1999 auf der Gefängnisinsel İmralı in der Türkei. In seiner Erklärung mit dem Titel „Aufruf für Frieden und eine demokratische Gesellschaft“ äusserte er sich zur Zukunft der kurdischen Frage.
Millionen Menschen in Kurdistan und weltweit verfolgten den Aufruf Öcalans, internationale Medien berichteten ausführlich und mehrere Regierungen gaben Stellungnahmen ab. Die Botschaft wurde seit Wochen erwartet und sorgt nun für neue politische Diskussionen. Nun steht die PKK vor der Entscheidung, ob sie sich entwaffnen und selbst auflösen soll. Dieser Schritt könnte ein entscheidender Wendepunkt im jahrzehntelangen Konflikt zwischen der Arbeiterpartei und dem türkischen Staat sein.
Ist die türkische Regierung wirklich bereit, Verantwortung für die Situation zu übernehmen?
Die PKK war 1978 aus der kurdischen Aufstandsbewegung entstanden, nachdem die Kurd*innen jahrzehntelang vom türkischen Staat als Minderheit diskriminiert, unterdrückt und systematisch aus demokratischen Prozessen ausgeschlossen worden waren. Seit fast fünfzig Jahren kämpft die Partei als Teil einer breiten kurdischen Bewegung für die Rechte der kurdischen Bevölkerung und den Aufbau demokratischer Strukturen. Gleichzeitig kämpft sie mit militärischen Guerilla-Taktiken für die Selbstverteidigung autonomer Gebiete und gegen türkische Annexionsversuche und Angriffe.
Nach der Verlesung der Botschaft auf Kurdisch und Türkisch zitierte der DEM-Partei-Politiker Sırrı Süreyya Önder die abschliessenden Worte Öcalans an die Delegation: „Eine Entwaffnung der PKK und ihre Auflösung seien nur möglich, wenn eine demokratische Politik etabliert und eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen werde.”
Damit liegt die Verantwortung nun beim türkischen Staat. Gerade in den vergangenen Wochen wurden erneut mehrere kurdische Bürgermeister abgesetzt, zahlreiche Oppositionelle verhaftet und die Angriffe des türkischen Militärs auf kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordost-Syrien fortgesetzt. Ist die Regierung wirklich bereit, Verantwortung zu übernehmen?
Plötzliche Wende nach jahrelanger Isolation
Noch vor wenigen Monaten schien ein solcher Schritt in Richtung Friedensabkommen unvorstellbar. Schliesslich gab es dreieinhalb Jahre lang kein Lebenszeichen von Öcalan, der in Totalisolationshaft sass. Alle Besuchsanträge seiner Verteidiger wurden seit 2019 abgelehnt.
Doch im Oktober 2024 kam es zu einer unerwarteten Wende: Während die türkischen Angriffe auf die kurdische Bewegung zunahmen, machte Devlet Bahçeli, Vorsitzender der ultrarechten MHP, einen überraschenden Vorschlag. Er stellte Öcalan eine mögliche Freilassung in Aussicht, sofern dieser im türkischen Parlament die Selbstauflösung der PKK verkünde.
Klar ist: die kurdische Realität kann nicht länger ignoriert werden.
Kurz danach durfte Öcalan erstmals nach 43 Monaten einen Familienbesuch seines Neffen auf der Gefängnisinsel empfangen und am 28. Dezember 2024 reisten ausserdem zwei DEM-Abgeordnete für das erste Gespräch in zehn Jahren nach İmralı.
Nach einem zweiten Gespräch mit den Abgeordneten am 22. Januar 2025 erklärten DEM-Vertretende vor der Presse, dass Öcalan an einer „gesellschaftsorientierten Lösung“ arbeite, die über den Dialog zwischen der Regierung und İmralı hinausgehe. Das Thema müsse auf einem „demokratischen Rechtsweg“ im Parlament behandelt werden und eine Waffenniederlegung setze voraus, dass zunächst die Ursachen des Konflikts beseitigt sind.
Öcalan betrachtet die Neuordnung des Nahen Ostens durch imperiale Grossmächte und die darauf folgenden Kriege in Israel/Palästina, im Libanon und in Syrien als grosse Bedrohung für alle Menschen in der Region – und für jede Aussicht auf eine demokratische Zukunft. Ebenso kritisch betrachtet er das Festhalten am gewaltvollen Status quo. Er schlägt als politische Perspektive einen dritten Weg vor: „Die einzige Lösung, die sowohl die Türkei als auch Syrien, den Irak und sogar den Iran retten wird, besteht darin, eine Grundlage für die Demokratisierung zu schaffen, indem mit allen Völkern Frieden geschlossen wird.“
Die PKK entstand in einer Zeit weltweiter nationaler Befreiungskämpfe und orientierte sich am Realsozialismus.
Nach dem Besuch auf İmralı im Januar fanden Gespräche mit weiteren Akteur*innen statt, darunter führende Politiker*innen der türkischen Parteien, inhaftierte HDP-Politiker*innen wie Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ sowie Vertreter*innen der kurdischen Regionalregierung im Nordirak. Alle äusserten, noch vor der Veröffentlichung von Öcalans Aufruf, ihre Unterstützung und Zuversicht für einen möglichen Lösungsprozess.
Die Absichten des türkischen Staates bleiben spekulativ. Möglicherweise verfolgt Erdoğan das Ziel, sich eine weitere Amtszeit zu sichern – durch eine Verfassungsänderung, die ihm eine erneute Kandidatur ermöglicht. Der Vorsitzende der ultrarechten MHP Devlet Bahçeli hingegen warnt seit Monaten davor, dass die Türkei durch die Neuordnung der Region in Gefahr sei. Daher scheint Erdoğan – ähnlich wie Mustafa Kemal Atatürk 1919 – die Unterstützung der Kurd*innen sichern zu wollen.
Klar ist: die kurdische Realität kann nicht länger ignoriert werden. Der Türkei ist es nicht gelungen, die PKK militärisch zu besiegen. Sie steckt in einer tiefgreifenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Krise und in Syrien und im Irak ist die kurdische Autonomie bereits Realität. Daher ist es denkbar, dass eine Lösung der kurdischen Frage auch für die türkische Regierung vorteilhafter wäre, als die Fortsetzung des Konflikts.
Jahrzehntelange Suche nach einer demokratischen Lösung
Einige sehen in dem Aufruf Öcalans eine Kapitulation, andere freuen sich über das mögliche Ende des blutigen Krieges. Wieder andere sehen eine neue Ära des Friedens und der Demokratie anbrechen. Viele sind jedoch verunsichert, was der Aufruf nun bedeutet. Zum besseren Verständnis lohnt sich ein historischer Blick auf die Suche nach einer Lösung dieses von Öcalan als „gordischer Knoten“ bezeichneten Problems.
Mit dem Demokratischen Konföderalismus bietet Öcalan einen Gegenentwurf, der eine demokratische, ökologische und auf Frauenbefreiung basierende Gesellschaft anstrebt.
Der kurdische Befreiungskampf in der Türkei ist eine Reaktion auf die Unterdrückung der kurdischen Identität durch den türkischen Nationalstaat. Dessen Grenzen wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Vertrag von Lausanne festgelegt, basierend auf den Interessen westlicher Kolonialmächte.
Gegen die rücksichtslosen Grenzziehungen und den Imperialismus formierte sich in den 1970er Jahren Widerstand. In diesem Kontext wurde 1978 mitunter von Öcalan die PKK gegründet. Der 1984 beginnende Guerillakrieg weckte Hoffnungen auf Veränderung und Selbstbestimmung, forderte im Kampf gegen die zweitgrösste Armee der NATO jedoch auch Zehntausende von Leben.
Die PKK entstand in einer Zeit weltweiter nationaler Befreiungskämpfe und orientierte sich am Realsozialismus. Ihr Ziel war die Gründung eines Nationalstaats auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Auch nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus blieb die PKK aktiv und erweiterte ihre soziale Basis, indem sie einen gesellschaftsorientierten demokratischen Sozialismus, Konföderalismus und die Frage der Frauenbefreiung in den Mittelpunkt ihres Kampfes stellte.
Nach dem ersten Waffenstillstand 1993 suchten Öcalan und die PKK eine politische Lösung im Dialog mit dem türkischen Präsidenten Turgut Özal, der jedoch unter dubiosen Umständen starb, kurz bevor er auf den Waffenstillstand reagieren wollte. In den folgenden Jahren kam es zu einem Krieg, der Zerstörungen und die Vertreibung von Millionen Kurd*innen zur Folge hatte.
Über 4’000 kurdische Dörfer wurden vernichtet und zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen, während die türkische Gesellschaft weitgehend schweigend zusah. Trotz der internationalen Unterstützung für die Türkei, der Kriminalisierung der PKK als Terrororganisation und schonungsloser Repression blieb Öcalan um eine politische Lösung des Problems bemüht.
Schliesslich wurde er 1999 im Rahmen einer von den USA geführten internationalen Operation in Kenia gefangen genommen und an die Türkei ausgeliefert, nachdem er mehrere Monate lang erfolglos in Europa um internationale Unterstützung für die Lösung der kurdischen Frage gesucht hatte.
Die Verschleppung und Isolation Öcalans auf der Gefängnisinsel İmralı führte jedoch nicht zum angestrebten Ergebnis. Trotz der Repression gewann die PKK weiter an Einfluss. Und auch Öcalans Denken blieb dank seiner tausend Seiten umfassenden Gefängnisschriften zentral. Darin kritisiert Öcalan die zerstörerische kapitalistische Moderne und entwickelte mit dem Konzept des Demokratischen Konföderalismus einen Gegenentwurf, der eine demokratische, ökologische Gesellschaft auf der Grundlage der Frauenbefreiung anstrebt.
Seine Ideen beeinflussen nicht nur Millionen Kurd*innen, sondern politische Bewegungen im gesamten Nahen Osten, indem sie alternative Lösungsansätze für bestehende Konflikte bieten.
Im Aufruf Öcalans sieht die PKK keineswegs ein Ende, sondern im Gegenteil einen „völligen Neuanfang”, den sie „vollständig unterstützt”.
Öcalan argumentiert, dass das Recht auf Selbstbestimmung nicht mit der Gründung neuer Nationalstaaten gleichzusetzen ist, da dies die bestehenden Probleme nur verschärfen würde. Stattdessen schlägt er in seiner Formel „Demokratie plus Staat als allgemeine öffentliche Autorität“ vor, den Dialog als Grundlage für demokratische Politik zu nutzen. Im Kern dieser Idee steht die radikale Selbstorganisation, die den Staat entweder begrenzt oder ganz überflüssig macht.
Eine solche demokratisch organisierte Gesellschaft wäre in der Lage, den Staat zu kontrollieren, anstatt von ihm kontrolliert zu werden. Öcalans Konzept könnte eine Grundlage für ein friedliches Zusammenleben von Kurd*innen und Türk*innen in einem Land bieten – und auch darüber hinaus als politischer Leitfaden dienen.
Das ist nicht das Ende
Öcalan ist davon überzeugt, dass die Entstehung der PKK auf die politischen und militärischen Bedingungen ihrer Zeit zurückzuführen sei. Die Partei müsse ihre Methoden an die heutige Welt anpassen – sowohl um auf die geopolitischen Entwicklungen in der Region zu reagieren, aber auch um den bereits Anfang der 2000er begonnenen Übergang zu einer dezentralisierten Organisationsform zu vollziehen.
Schon damals betonte Öcalan, dass dieser Schritt einen „totalen Freiheits- und Demokratiekampf anstatt eines Bürgerkrieges“ einleiten sollte. Er fordert, dass sich sowohl die PKK als auch der türkische Staat verändern müssen, um den Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten. Die kurdische Frage sei im Kern eine Frage von Demokratie und Freiheit. Damit untergräbt Öcalan das Argument der Türkei, das Problem sei nur die PKK und ihre Waffen.
„Seit Jahren fordern europäische Länder – darunter auch die Schweiz – eine Lösung durch Dialog. Nun wäre dieser möglich.”
Dilan Çetinkaya, Co-Vorsitzende vom kurdischen Dachverband in der Schweiz
Für ihn sind „die Achtung der Identitäten, der freie Ausdruck und die demokratische Selbstorganisation jedes Teils der Gesellschaft auf der Grundlage ihrer eigenen sozioökonomischen und politischen Strukturen nur durch die Existenz einer demokratischen Gesellschaft und eines demokratischen politischen Raums möglich”.
Die PKK hat den Aufruf Öcalans angenommen und am 1. März einen Waffenstillstand verkündet. Im Aufruf sieht die Partei keineswegs ein Ende, sondern im Gegenteil einen „völligen Neuanfang”, den sie „vollständig unterstützt” und für den sie „alle erforderlichen Schritte einhalten und umsetzen wird”. Gleichzeitig wird betont, dass „für den Erfolg dieses Prozesses geeignete politische und rechtliche Rahmenbedingungen notwendig“ seien.
Der türkische Staat muss nun zeigen, inwieweit er bereit ist, sich an diesem Prozess zu beteiligen, um den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen. Der Staat müsse konkrete Schritte wie verfassungsrechtliche Änderungen und eine demokratische Transformation einleiten, um die Rechte der kurdischen Bevölkerung zu garantieren, betont Nilufer Koç, Sprecherin für Aussenbeziehungen des Nationalkongresses Kurdistan (KNK), gegenüber das Lamm. „Die Freilassung Öcalans ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Friedensprozesses. Es ist notwendig, dass er direkt an einem Kongress zur Auflösung der PKK teilnimmt und frei mit der Öffentlichkeit kommunizieren kann”, so Koç.
„Seit Jahren fordern europäische Länder – darunter auch die Schweiz – eine Lösung durch Dialog. Nun wäre dieser möglich”, meint Dilan Çetinkaya, Co-Vorsitzende vom kurdischen Dachverband in der Schweiz CDK‑S gegenüber das Lamm. „Daher sollte Öcalans Aufruf unterstützt werden.”
Journalismus kostet
Die Produktion dieses Artikels nahm 20 Stunden in Anspruch. Um alle Kosten zu decken, müssten wir mit diesem Artikel CHF 1300 einnehmen.
Als Leser*in von das Lamm konsumierst du unsere Texte, Bilder und Videos gratis. Und das wird auch immer so bleiben. Denn: mit Paywall keine Demokratie. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktion unserer Inhalte gratis ist. Die trockene Rechnung sieht so aus:
Wir haben einen Lohndeckel bei CHF 22. Die gewerkschaftliche Empfehlung wäre CHF 35 pro Stunde.
CHF 700 → 35 CHF/h für Lohn der Schreibenden, Redigat, Korrektorat (Produktion)
CHF 340 → 17 CHF/h für Fixkosten (Raum- & Servermiete, Programme usw.)
CHF 260 pro Artikel → Backoffice, Kommunikation, IT, Bildredaktion, Marketing usw.
Weitere Informationen zu unseren Finanzen findest du hier.
Solidarisches Abo
Nur durch Abos erhalten wir finanzielle Sicherheit. Mit deinem Soli-Abo ab 60 CHF im Jahr oder 5 CHF im Monat unterstützt du uns nachhaltig und machst Journalismus demokratisch zugänglich. Wer kann, darf auch gerne einen höheren Beitrag zahlen.
Ihr unterstützt mit eurem Abo das, was ihr ohnehin von uns erhaltet: sorgfältig recherchierte Informationen, kritisch aufbereitet. So haltet ihr unser Magazin am Leben und stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen – Zugang zu fundiertem Journalismus abseits von schnellen News und Clickbait erhalten.
In der kriselnden Medienwelt ist es ohnehin fast unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da das Lamm unkommerziell ausgerichtet ist, keine Werbung schaltet und für alle frei zugänglich bleiben will, sind wir um so mehr auf eure solidarischen Abos angewiesen. Unser Lohn ist unmittelbar an eure Abos und Spenden geknüpft. Je weniger Abos, desto weniger Lohn haben wir – und somit weniger Ressourcen für das, was wir tun: Kritischen Journalismus für alle.
Einzelspende
Ihr wollt uns lieber einmalig unterstützen?